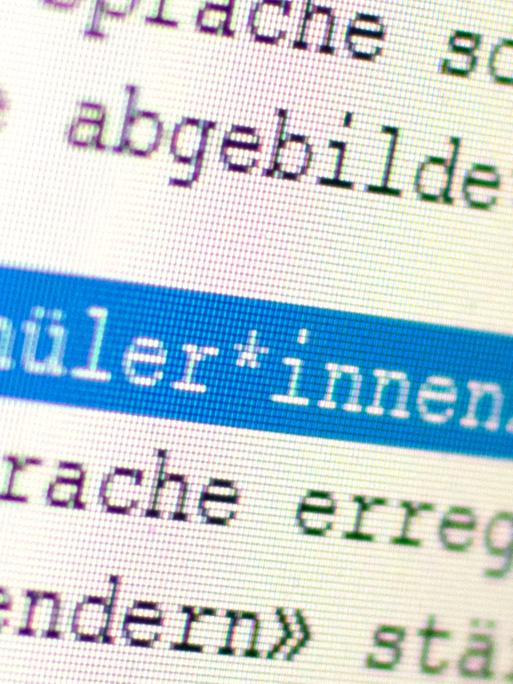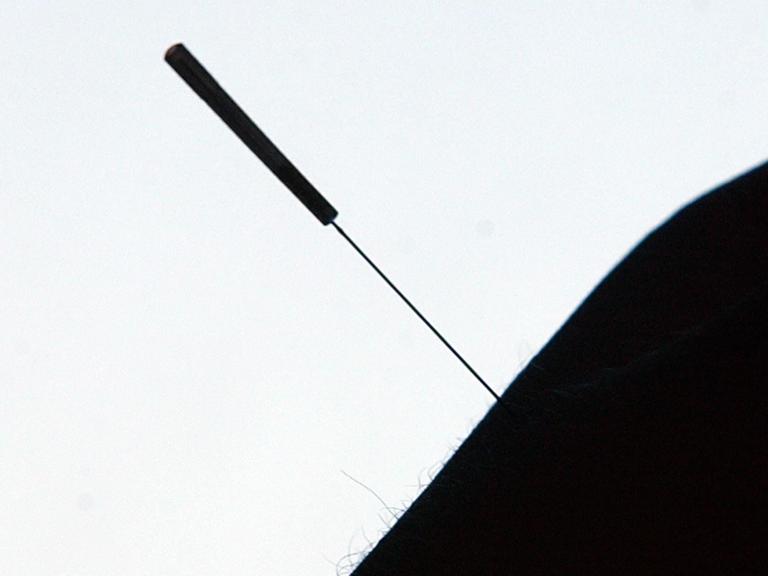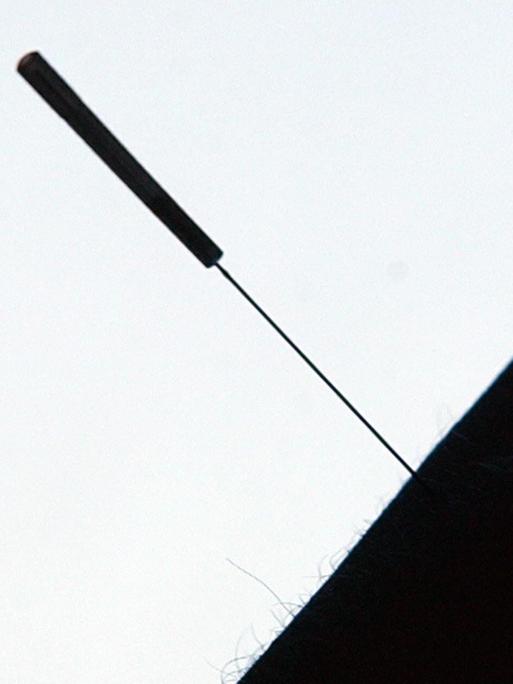Genderverbot

In der gesprochenen Sprache ist die verwendete Pause vor „innen“ ein alter Hut, für den es sogar einen Namen gibt: Glottisschlag © picture alliance / SZ Photo / Stephan Rumpf
Rückschritt per Gesetz
04:34 Minuten

Die Debatte um geschlechtergerechte Sprache flammt erneut auf – diesmal durch ein geplantes Verbot der Merz-Regierung. Ausgerechnet jene, die vor einem angeblichen Sprachzwang warnten, wollen nun selbst ein Genderverbot einführen.
Müssen wir schon wieder übers Gendern sprechen? Wir müssen. Denn unter der Merz-Regierung ist jetzt das eingetreten, wovor Merz und Co. uns in den letzten Jahren in aller Ausdrücklichkeit gewarnt haben: die politische Indoktrination der Sprache. Zunächst im Kanzleramt selbst, dann im Bildungsministerium und nun auch durch den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, welcher sich zudem für eine flächendeckende Regelung für die gesamte Bundesrepublik einsetzt – die eines Genderverbots.
Es wurden viele Diskussionen über das Thema „geschlechtergerechte Sprache“ geführt, für das sich nach wie vor nicht alle erwärmen können. Und das ist auch in Ordnung. Wandel und Fortschritt brauchen eben Zeit, Geduld und Austausch. Doch nun legt die Bundesregierung offenbar den Rückwärtsgang – und zwar mit voller Beschleunigung.
Der prophezeite Sprachzwang wird nun von genau denen umgesetzt, die Angst davor geschürt und die Debatte um geschlechtergerechte Sprache angeheizt haben.
Dabei stimmt das Argument gegen einen solchen Zwang rechtlich gesehen sogar – jedenfalls, was das Verbot des Genderns angeht. Denn Regelungen, die es staatlichen Stellen verbieten, geschlechtergerecht zu schreiben, verstoßen gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz aus Artikel 3 GG.
Zudem stehen die Verbote im Widerspruch zur Rechtslage in der Privatwirtschaft und den Wertungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Daneben kommen – je nach Bereich – eine Verletzung der Rundfunk-, Wissenschafts-, Meinungs-, und Kunstfreiheit aus Artikel 5 GG in Betracht.
Kulturstaatsminister Weimer argumentiert dennoch, man müsse für die Verständlichkeit der deutschen Sprache mit Verboten sorgen. Dabei scheint er zu übersehen, dass es sich bei geschlechtergerechter Sprache um eine Form des sprachlichen Wandels handelt, welcher vom Rat für deutsche Rechtschreibung als vereinbar mit der deutschen Sprache angesehen wird.
Die Pause vorm "*innen" ist ein alter Hut
In der gesprochenen Sprache ist beispielsweise die verwendete Pause vor „innen“ ohnehin ein alter Hut, und zwar so alt, dass es auch einen Namen dafür gibt: Glottisschlag. Ohne diesen gäbe es zum Beispiel kein Spiegelei.
Ein solcher Glottisschlag, also eine Pause beziehungsweise eine Trennung zwischen persönlichen Befindlichkeiten und politischer Verantwortung, wäre auch beim Thema der geschlechtergerechten Sprache wünschenswert. Denn was nicht vergessen werden darf: Die Sprache ist eines der wichtigsten Werkzeuge von Rechtspopulist*innen.
Verbot des Genderns und der Regenbogenflagge tragen zur Spaltung bei
Gerade bei Themen, die als gesellschaftlich spaltende propagiert werden, sollte man deswegen genauer hinsehen. Wie erst kürzlich bei der Flaggenfrage für den Bundestag zum Christopher Street Day, als die Regenbogenfahne, die seit Jahre gehisst wird, nun auf einmal zu einer solchen Spaltung beitragen sollte.
Warum also dieser, „künstliche Widerstand“ konservativer Politiker, wenn es um queere Themen geht? Die Wissenschaftlerin Sara Ahmed erklärt, dass queere Menschen mit ihrer bloßen Existenz heteronormative Werte verschieben. Damit ist Queerness ein existenzieller Angriff gegen ein System, dass auf binären Geschlechterrollen und Heteronormativität basiert und eine entsprechende Machtverteilung rechtfertigt.
Alles, was Queerness sichtbar macht, wie die geschlechtergerechte Sprache oder das Hissen der Regenbogenflagge, macht auch sichtbar, dass dieses System der Machtverteilung nur eine Konstruktion ist. Je mehr das in Frage gestellt und dekonstruiert wird, desto größer der Backlash seitens derer, die davon derzeit noch profitieren.
Und das zeigt wiederum vor allem zwei Dinge: dass dieses System sehr fragil ist und langsam, aber sicher ins Wanken gerät.
Darum müssen wir vielleicht auch noch ein paar Mal über das Thema Gendern sprechen, aber vor allem weiter kritisch auf das schauen, was unsere Bundesregierung als nächstes plant. Denn echter Fortschritt von „Innen“, oder Friedrich?