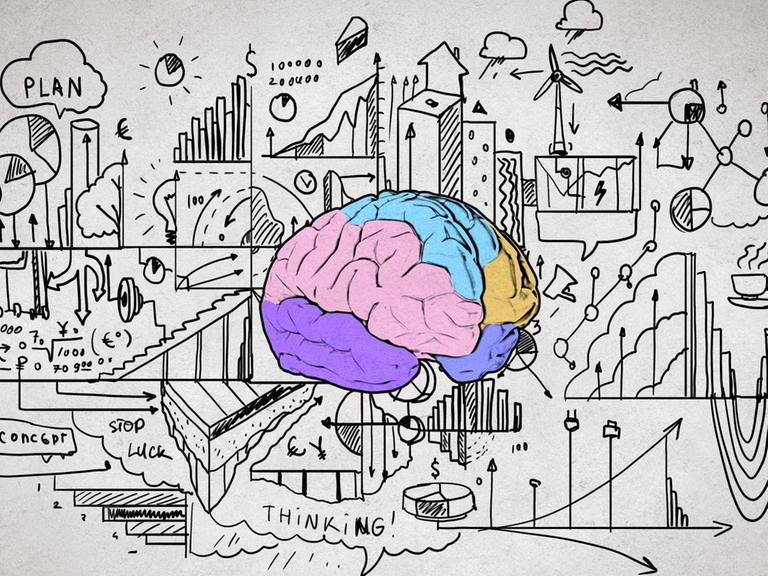Psyche

Ständiger Begleiter: das Smartphone buhlt um Aufmerksamkeit © picture alliance / Zoonar / Dmitrii Marchenko
Smartphones schaden der Konzentration nicht unbedingt - doch Verzicht tut gut!

Es summt und pingt und fordert ständig unsere Aufmerksamkeit: das Smartphone als ständiger Begleiter bringt Probleme mit sich. Über Konzentrationsmangel und Aufmerksamkeitsdefizite wird diskutiert - gibt es dafür wissenschaftliche Belege?
Kein Handygedaddel mehr in der großen Pause – als erstes Bundesland hat Hessen im jetzt angelaufenen Schuljahr die private Nutzung von Smartphones in Schulen verboten. Es gehe dabei um die psychische Gesundheit und die Lernfähigkeit junger Menschen, heißt es aus dem Bildungsministerium.
Auch Erwachsene klagen darüber, wie das Smartphone ihren Alltag beherrscht. Das Handy schadet der Konzentration, der Dauer-Dopaminrausch durch TikTok und Co verringert die Aufmerksamkeitsspanne – so die weit verbreitete Annahme. Die Wissenschaft bestätigt das allerdings nicht so pauschal.
Konzentrationskiller Smartphone?
Bei Kindern und Jugendlichen ist die Studienlage recht eindeutig. Ist das Smartphone in der Nähe, sind sie häufig abgelenkt, ihre Lernleistung sinkt. Das zeigen verschiedene Studien aus Norwegen, Spanien, Tschechien, England und Schweden, die der Bildungsforscher Klaus Zierer miteinander verglichen hat.
Kindern fehlten auch Reize, wenn sie immer am Bildschirm klebten, warnt der Neurobiologe Martin Korte. Bewegung, Umgang mit anderen Menschen und weitere Herausforderungen seien wichtig. „Diese sich noch entwickelnden Gehirne lernen sehr viel über Informationen aus ihrer Umwelt“, betont Korte. Beide Forscher befürworten deshalb einen bewussteren Umgang mit dem Smartphone und klare Regeln zum Beispiel in der Schule.
Bei Erwachsenen kommen Studien hingegen zu widersprüchlichen Ergebnisse darüber, inwieweit das Smartphone-Zeitalter negative Spuren hinterlässt. Eine Gruppe um die Psychologin Denise Andrzejewski von der Universität Wien hat herausgefunden, dass sich Erwachsene heute sogar etwas besser konzentrieren können als in zurückliegenden Jahrzehnten. Ihre Metastudie basiert auf den Daten aus 179 Forschungsarbeiten, an denen mehr als 21.000 Personen teilnahmen.
Dagegen geht Gloria Mark von der University California Irvine davon aus, dass die Konzentrationsfähigkeit abgenommen hat. Seit 2004 beobachtet sie menschliche Aufmerksamkeit. Für ihre Studien ließ sie die Teilnehmenden einen Test am Computer absolvieren und beobachtete, wie lange sie sich einer Aufgabe widmeten, bevor sie ein anderes Bildschirmfenster öffneten. 2004 lag dieser Wert bei 2,5 Minuten, im Jahr 2019 nur noch bei 47 Sekunden – für Mark ein Indiz, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne kürzer wird. Andere Forscher sind jedoch der Ansicht, dass es sich nicht unbedingt um einen Mangel handeln muss, sondern sich darin lediglich zeigt, wie anpassungsfähig das menschliche Gehirn ist.
Dass das Handy selbst in ausgeschaltetem Zustand die Konzentration stört – mit diesem Befund sorgten Forscher der Universität Paderborn für Aufsehen. In einer kleinen Studie hatten sie 42 Probandinnen und Probanden Konzentrations- und Aufmerksamkeitsübungen machen lassen – eine Gruppe mit Smartphone auf dem Tisch, die anderen ohne. Das Ergebnis: die Gruppe mit Handy war langsamer und machte mehr Fehler.
Solche Experimente könnten Indizien liefern, bei allzu eindeutigen Forschungsergebnissen wäre Skepsis aber angebracht, meint der Psychologe Jan Röer von der Universität Witten-Herdecke. Menschliche Konzentration und Aufmerksamkeit ist schwierig zu erforschen, weil sie unterschiedliche Dimensionen hat, die schwierig voneinander abzugrenzen sind. Hinzu kommt, so Röer, dass Menschen häufig gar nicht wüssten, wovon sie abgelenkt seien.
Röer konnte diesen Effekt in einer Studie nachweisen, bei der die Teilnehmenden in zwei Gruppen Konzentrationsaufgaben lösen mussten und dabei Musik hörten. Einer Gruppe wurde vorher gesagt, dass Musik störe, der anderen Gruppe wurde erklärt, dass dies nicht der Fall sei. „Objektiv abgelenkt waren beide“, erklärt Röer. Subjektiv jedoch habe sich die Gruppe, die mit der „Entwarnung“ in den Test geschickt wurde, deutlich weniger abgelenkt gefühlt.
Geringere Aufmerksamkeitsspanne durch TikTok?
Welche Rolle für die Aufmerksamkeit spielen aber konkret Social-Media-Apps wie TikTok, die mit einem unendlichen Strom an kurzen schrillen Videos Milliarden User an sich fesselt? Eine neue Studie von Psychologinnen der Universität Hohenheim (die bisher nur als Preprint existiert) kommt zu einem gemischten Ergebnis. Einerseits stellt sie fest, dass Menschen, die nach eigener Aussage viel Zeit auf TikTok und Co verbringen, schlechter in Aufmerksamkeitstests abgeschnitten haben. Wenn man aber andererseits die objektive Zeit anschaut, die sie auf TikTok verbringen, dann ist der Zusammenhang nicht erkennbar. Es zeigte sich kein Unterschied in der Aufmerksamkeit von gelegentlichen und starken Usern.
Eine mögliche Erklärung für den Unterschied zwischen Selbstauskunft und objektiven Daten: Die „Heavy User“ schämen sich für ihre hohen Nutzungszeiten und schätzen ihre Aufmerksamkeit deshalb schlechter ein, als sie objektiv gemessen ausfällt.
Doch solche Studien haben auch den Schwachpunkt, dass sie nur Korrelationen aufzeigen, aber nicht zwangsläufig eine Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Die Mediennutzung könnte nicht der Grund für eine schlechtere Aufmerksamkeitsspanne oder Impulskontrolle sein, sondern andersherum: Menschen mit schlechter Impulskontrolle könnten auch häufiger ihr Smartphone nutzen. Die Befunde bleiben uneindeutig.
Das Smartphone: Risikofaktor für die psychische Gesundheit
Die psychische Gesundheit junger Menschen im Alter von 12 bis 25 Jahren hat sich im vergangenen Jahrzehnt verschlechtert, schreibt eine internationale Forschergruppe im Wissenschaftsmagazin „The Lancet“. Weltweit verzeichnen sie einen Anstieg an Schlaflosigkeit, Angstzuständen, Depressionen, psychischem Stress, aber auch Selbstverletzungen und Selbsttötungen.
Solche Probleme werden in wissenschaftlichen Arbeiten nicht singulär auf das Smartphone und die verstärkte Nutzung von sozialen Medien zurückgeführt. Bei Studien zu diesem Thema zeigen sich jedoch Zusammenhänge. Neurobiologe Korte warnt mit Blick auf Heranwachsende davor, dass ewiges Gedaddel vielfältige Nachteile habe. Insbesondere die Empathiefähigkeit werde beeinträchtigt, was die sozialen Beziehungen belaste. Einsamkeit und daraus folgende Erkrankungen wie Angstzustände und Depressionen können die Folge sein. Auch der ständige Abgleich mit idealisierten (Körper-)Bildern sei belastend.
Vor negativen Effekten warnt auch die Weltgesundheitsorganisation WHO. Bei jungen Menschen fühle sich inzwischen jeder Vierte einsam und sozial isoliert, trotz der nie dagewesenen Möglichkeiten zum Austausch mit anderen, die das Smartphone bietet. Vivek Murthy, der Co-Vorsitzende der WHO-Kommission, plädiert deshalb dafür, bewusst den direkten Austausch mit anderen zu suchen: „Es ist sehr wichtig, Orte und Räume in unserem Leben zu haben, wo wir von Angesicht zu Angesicht mit anderen Menschen interagieren können, ohne von der Technologie abgelenkt zu werden.“
Digital Detox: erstaunlich wirksam
Auch wenn sich Konzentrationsmängel und psychische Probleme nicht kausal auf die Handynutzung allein zurückführen lassen, scheint Verzicht oder zumindest bewusster Umgang deutliche positive Effekte zu haben. Gleich mehrere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass es Menschen besser geht, wenn sie ihr Smartphone häufiger in der Tasche lassen.
Eine internationale Forschungsgruppe blockierte mittels einer App das Internet auf dem Smartphone von insgesamt 470 Testpersonen. Anrufe und SMS waren weiter nutzbar, außerdem konnten die Teilnehmenden auch zum Beispiel am Computer zu Hause ins Internet gehen. Nach zwei Wochen gaben 90 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, dass es ihnen psychisch besser geht. Tests ergaben außerdem eine höhere Konzentrationsfähigkeit.
Die Donau-Universität Krems beschränkte bei über hundert Testteilnehmern die tägliche Smartphone-Nutzung. Hatten die Teilnehmenden der Studie vorher im Durchschnitt 4,5 Stunden täglich am Handy verbracht, waren im Testzeitraum nur zwei Stunden möglich. Nach drei Wochen verbesserte sich das Wohlbefinden deutlich. Depressive Symptome gingen um 27 Prozent zurück, Stress nahm um 16 Prozent ab, die Schlafqualität stieg um 18 Prozent und das allgemeine Wohlbefinden um 14 Prozent.
Smartphone-Nutzer haben es selbst in der Hand: alle gängigen Hersteller bieten sogenannte Fokus-Funktionen. Dort lässt sich das Ablenkungspotential des Handys reduzieren, indem Anrufe und Mitteilungen ganz abgeschaltet oder auf einen engen Kreis von Personen eingeschränkt werden. Andere Apps setzen auf spielerische Anreize, um das Handy nicht andauernd zu aktivieren: Bei FocusFriend hält eine kleine Comic-Bohne auf dem Smartphone Einzug. Sie soll nicht beim Stricken gestört werden, sonst ist ihr Arbeitsfortschritt dahin. Die App kam in den USA gut an und wurde zweitweise häufiger heruntergeladen als die populäre KI-Anwendung ChatGPT.
jk