Sprecher: Rosario Bona
Ton: Jan Pasemann
Regie: Stefanie Lazai
Redaktion: Martin Hartwig
Serielles Bauen

Plattenbauten aus DDR-Zeiten in Erfurt: Aber auch die aktuelle Bundesregierung begeistert sich wieder für das serielle Bauen als Mittel, um den akuten Wohnungsmangel zu lindern. © imago / Steve Bauerschmidt
Die Rückkehr des Plattenbaus
33:34 Minuten

Mit seriellem Bauen verbinden die meisten triste Plattenbauviertel, unwirtliche Trabantenstädte und soziale Brennpunkte. Trotzdem gilt es wieder als Zukunftskonzept, ist klimaschonend, günstig und schnell. Und aus früheren Fehlern lässt sich lernen.
„Also wir selber wollten unter gar keinen Umständen in die Vahr. Wir haben außerhalb Bremens im sogenannten Speckgürtel gewohnt und wollten dann in der Rente zurück wieder in die Stadt. Und da war ganz klar: Also unter gar keinen Umständen in die Vahr und Hochhaus war überhaupt kein Thema.“
Rolf Diehl steht vor einem Hochhaus, genauer vor dem Aalto Hochhaus, in dem er jetzt seit über 15 Jahren lebt. Es ist das Wahrzeichen der Neuen Vahr, einer Neubausiedlung am Rande von Bremen. Sven Regner hat ihr in „Neue Vahr Süd“ ein literarisches Denkmal gesetzt. Der Protagonist Herr Lehmann ist Lakonist, er hat eine trockene, schmucklose Ausdrucksweise.
Und so ist auch die Vahr, aus der er stammt: eine riesige Neubausiedlung, unzählige größtenteils mehrgeschossige lange Wohnblöcke, gebaut in den 50er- und 60er-Jahren. Schon in den 70er-Jahren geriet diese Bauweise allerdings schon wieder stark in die Kritik.

"Jetzt wohnen wir über 15 Jahre hier und ich würde mich nicht so für die Vahr engagieren, wenn es uns hier nicht gefallen würde", sagt Rolf Diehl, Bewohner des Aalto-Hochauses in der Vahr.© Manuel Waltz
„Nach wie vor werden überall in der Bundesrepublik Wohneinheiten übereinandergestapelt, das Hochhaus zum Patentrezept moderner Wohnplanung stilisiert. Und gerade das ist falsch. Und solche Konstruktionen sind zumindest für die dort heranwachsenden Kinder eine bedrückende Hypothek.“ – Hieß es im Südwestrundfunk.
Vorurteile halten sich bis heute
Und an dieser Sicht hat sich bis heute nicht viel geändert. Neubauviertel gelten als soziale Brennpunkte, Betonburgen in denen man in monotonen Blocks anonym aneinander vorbeilebt. Da wollten auch Rolf Diehl und seine Frau nicht hin. Nach längerer erfolgloser Suche haben sie sich dann aber doch noch eine Wohnung im Aalto-Hochhaus angesehen.
„Meine Frau geht zum Fenster, guckt raus, dreht sich wieder rum, guckt sich die Wohnung an und sagt: Hier gehe ich nicht wieder raus. Ja, jetzt wohnen wir über 15 Jahre hier und ich würde mich nicht so für die Vahr engagieren, wenn es uns hier nicht gefallen würde. Und dazu kommt natürlich dann auch noch das tolle Haus, in dem wir wohnen.“

Das Aalto-Hochhaus ist das Wahrzeichen des Viertels Neue Vahr, benannt nach seinem Erbauer, dem finnischen Architekten Alvar Aalto.© imago / wrongside pictures
Das viele Grün in der Vahr und der ungewöhnliche Schnitt der Wohnung gaben den Ausschlag, sagt Diehl. Er gibt jetzt Führungen im Aalto-Hochhaus, dem Wahrzeichen des Viertels, benannt nach seinem Erbauer, dem finnischen Architekten Alvar Aalto.
Rolf Diehl blickt über den Platz zu den anderen Wohnblöcken des Viertels. Anfang der 50er-Jahre war das alles hier eine feuchte Wiese, dann wurde es eines der größten Neubaugebiete im westlichen Nachkriegsdeutschland. Der Architekt Ernst May war Chefplaner der gewerkschaftseigenen Wohnungsbaugesellschaft „Neue Heimat“, die die Vahr errichtet hat. Er war schon vor dem Krieg einer der größten Verfechter des industriellen Bauens. Nach 1945, beim Wiederaufbau der zerstörten Städte schlägt dann seine große Stunde.
„Ich sehe die Aufgabe des modernen Städtebaus in erster Linie darin, die unübersehbaren Häusermeere, wie sie vorwiegend im Zeitalter der Industrialisierung entstanden, aufzulockern. Wir gliedern sie in Nachbarschaften von 5000 bis 10.000 Menschen. Dabei gilt es selbstverständlich, die Werte des Großstadtlebens als solche zu erhalten. Der Städtebauer von heute hat in erster Linie seine Aufgabe darin erblickt, wieder das soziale Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen zu wecken. Erst dann wird die Großstadt wieder eine wahre Heimat des Menschen werden“, sagte Ernst May.

Der Architekt Ernst May (r.) war schon vor dem Krieg einer der größten Verfechter des industriellen Bauens. Hier 1958 mit dem Ingenieur Reichow bei der Besprechung eines Bauplans.© picture-alliance/ dpa / Lothar Heidtmann
Seine Vision ist eine neue Art von Stadt, kein Gründerzeit-Stil mehr, keine Mietskasernen. Stattdessen viel Grün, offene Fluchten und dazwischen industriell hergestellte Wohnblöcke in Trabantenstädten. Er wollte sogar große Teile des historischen Wiesbaden abreißen und durch Wohnblocks ersetzen. Dazu kam es nicht.
Hier in der Neuen Vahr aber konnte er neue Maßstäbe setzen, weil in kürzester Zeit eine gewaltige Zahl von neuen Wohnungen geschaffen wurde. Aus ganz Europa kamen Delegationen, um sich anzuschauen, wie in einem bisher nicht gekannten Maß serieller Wohnungsbau betrieben wurde. Das hieß, dass man sich ganz konkret an der Arbeitsweise in anderen Industrien orientierte. Oberste Anforderung war, schnell und kostengünstig zu bauen.
Neue Vahr: unterschiedliche Architekten beteiligt
„Also alles, was in dem Sinne vorzufertigen war, wird man vorgefertigt haben. Denn sonst wäre es nicht möglich gewesen, das in dieser Geschwindigkeit durchzuziehen. Denn würde ich mir vorstellen, alleine wenn sie bei solch einem Gebäude hier jeden Balkon einzeln verschalen wollten, dann hätten sie das in der Zeit nie geschafft.“
Rolf Diehl ist noch heute begeistert. Das Besondere an der Neuen Vahr war, dass es unterschiedliche Architekturbüros waren, die jeweils einzelne Teile des Viertels planten und bauten. Dadurch fielen die Gebäude und Quartiere einerseits recht unterschiedlich aus. Andererseits hatten sie eine Reihe von Vorgaben, was die Verwendung vorgefertigter Teile angeht, etwa die, dass alle die gleichen Fenster nutzen mussten.
„Dadurch war es überhaupt möglich, dass man in vier Jahren 10.000 Wohnungen auf die Beine stellt. Das war eben auch das, was die Vahr so außergewöhnlich machte, dass man eben in allen höchsten Tönen darüber sprach, weil, so etwas kannte kein Mensch. Das, was hier gelungen ist in der Geschwindigkeit, ja.“
Serielles Bauen auch im Koalitionsvertrag
Aus diesem Grund begeistert sich neuerdings auch die Bundesregierung wieder für das serielle Bauen, soll laut Koalitionsvertrag ein Mittel sein, den akuten Wohnungsmangel zu lindern.
Bundesbauministerin Klara Geywitz: „Ein Punkt, auch um das Ganze zu beschleunigen, ist, dass wir Modelle starten werden für serielles Bauen, das entlastet unglaublich den Bauprozess, es macht ihn schneller, aber es vermeidet zum Beispiel auch Baulärm und eine sehr lange Bauzeit in den Innenstädten.“
Beim GdW, dem Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, in dem vor allem die großen Wohnungsbaugenossenschaften und die kommunalen und öffentlichen Bauträger organisiert sind, hat man das schon vor Jahren erkannt und 2018 eine europaweite Rahmenvereinbarung zum seriellen Bauen verabschiedet. Sie dient der schnellen Umsetzung von großen Projekten, erklärt Ingeborg Esser, die Hauptgeschäftsführerin des GdW. Allerdings sei es derzeit immer schwieriger, zu bauen und neuen Wohnraum zu schaffen, sagt sie.
„Wenn wir uns die Ziele der Bundesregierung ansehen von 400.000 Wohnungen, dann müssen wir natürlich konstatieren, dass das in der jetzigen Situation wahrscheinlich ohnehin nicht schaffbar ist. Wir haben einen massiven Rohstoffmangel, Baumaterialien, fehlen, Fachkräfte fehlen und insoweit wird das sehr schwierig werden. Aber das serielle und modulare Bauen kann einen Teil der gesamten Neubau-Tätigkeit abdecken. Und es bietet eben zusätzliche Kapazitäten, weil nicht vor Ort auf der Baustelle produziert wird, sondern in Hallen in einer geschützten Umgebung.“
Vermeidung von Bauschutt als Argument
Je mehr in einer Werkshalle vorbereitet wird, desto sparsamer wird auch mit dem Material umgegangen. Fortschritte in dieser Richtung sind auch bitternötig: Etwa die Hälfte des Mülls in Deutschland ist Bauschutt. Deshalb sei dieser Vorteil ein schlagendes Argument, sagt Esser. Aber nicht nur das.
„Wir stellen insgesamt fest, dass natürlich die in den Werken hinterlegten Qualitätssicherungskonzepte, die ja auch sehr stark, ich sage mal, aus der Automotiv-Industrie abgeguckt sind, dass die eben eine extrem hohe Qualität sicherstellen, die eben auf der Baustelle nicht immer sichergestellt ist. Heißt also konkret, dass wir mit Baumängeln bei den Projekten, die hier gebaut worden sind, überhaupt keine Probleme haben.“
Auch Einfamilienhäuser – sogenannte Fertighäuser – werden seit Jahren so produziert. Esser und auch der Bundesregierung geht es aber um Büro- und Mehrfamilienhäuser, große mehrstöckige Gebäude. Serienfertigung zielt vor allem auf große Stückzahlen. Viele Häuser, alle nach gleichem Muster, so wie bei der Neuen Vahr in Bremen. Wenn man dabei aber weder gleichförmig bauen noch neue Flächen versiegeln will, kommt man schnell in einen Zielkonflikt.
Und niemand will neue Trabantensiedlungen aus dem Boden stampfen. Dennoch gibt es, so Ingeborg Esser, auch in den Städten noch genügend Möglichkeiten für diese Art des Bauens, wo der Anteil seriell gefertigter Unterkünfte bei gerade mal vier Prozent liege.
„Also ich würde mal so sagen, wenn wir aller à la longue dahin kämen, dass das serielle und modulare Bauen zehn bis 15 Prozent der gesamten Bautätigkeit ausmacht, dann wäre das schon ein massiver Fortschritt.“
Industrieller Wohnungsbau in der DDR
Da war man in der DDR zumindest in dieser Hinsicht deutlich weiter. Auch im Osten herrschte nach dem Krieg extremer Mangel an Wohnraum. In den 50er-Jahren versuchte man dem mit dem zunächst mit Bau von sogenannten Arbeiterpalästen zu begegnen: repräsentative Großbauten mit klassizistischen, barocken und gotischen Anleihen. Am bekanntesten dafür dürfte die Berliner Stalinallee sein.
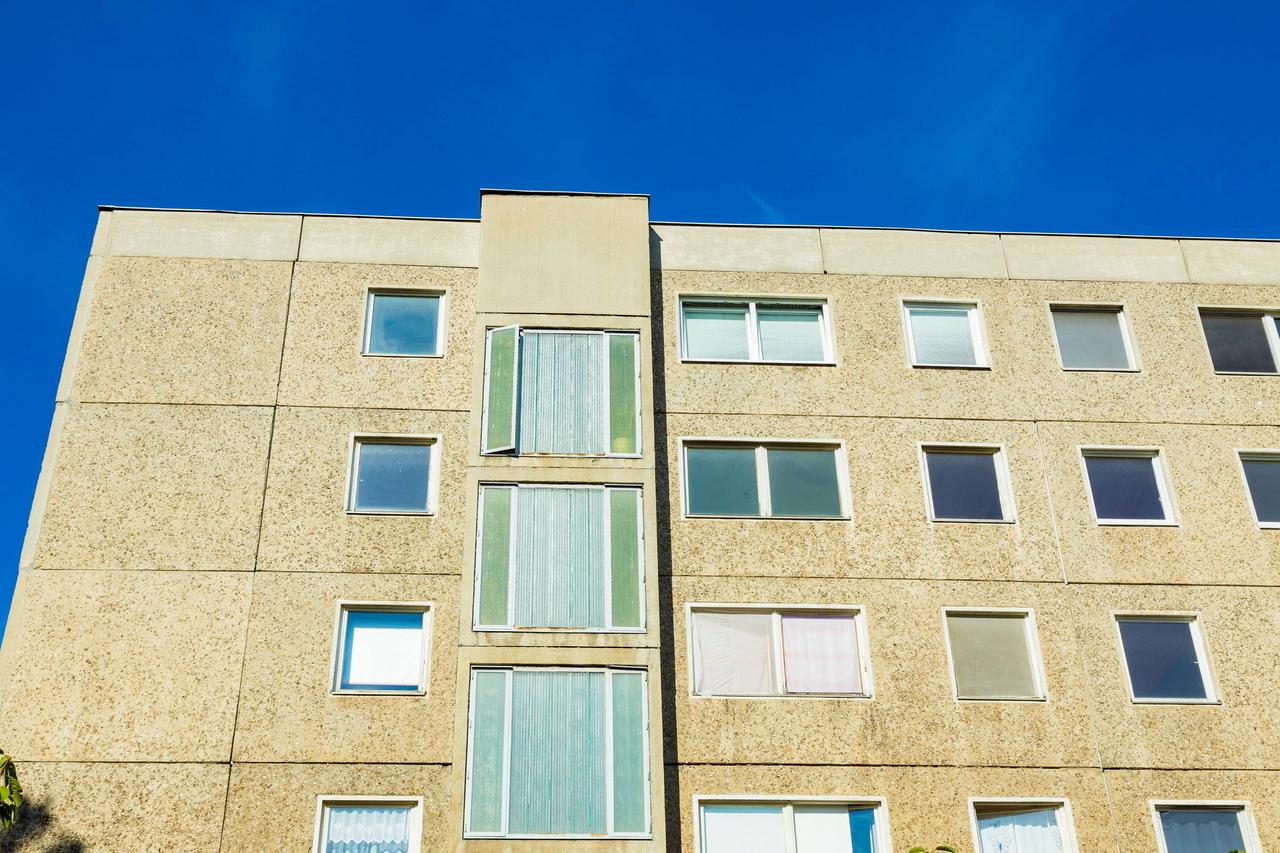
Normierung, Standardisierung und industrielle Vorproduktion gipfelten im DDR-Plattenbau vom Typ WBS 70.© imago / Sylvio Dittrich
Doch der Bedarf an Wohnraum war immens und die Ressourcen der frisch gegründeten DDR gaben den Bau einer ausreichenden Zahl von Arbeiterpalästen schlicht nicht her. Aus dieser Not heraus vollzog die SED in den 60er-Jahren einen radikalen Schwenk hin zur industriellen Herstellung von Wohnungen. Und das gleich mit voller Kraft: mit einem extrem hohen Grad an Normierung, Standardisierung und industrieller Vorproduktion. Dies gipfelte in der WBS 70, der 1970 vorgestellten Wohnungsbauserie, der berühmten Platte.
„Also ja, ich bin in der Platte sozusagen groß geworden und bin damit aufgewachsen und habe diese Gebäudestruktur oder diese, ja, dieser moderne, serielle Bau, der ist sozusagen für mich so, wie die Großmutter wahrscheinlich mit einem Fachwerkhaus vor 200 Jahren oder so, die unsere Vorfahren aufgewachsen sind. So bin ich natürlich mit der Platte aufgewachsen.“
Sagt Christoph Liepach. Er steht in Leipzig in der Kolonnadenstraße vor einigen Plattenbauten. Allerdings ist das hier kein Plattenbauviertel wie am Stadtrand in Grünau, Berlin-Marzahn oder Halle-Neustadt. Das hier ist die sogenannte Altstadtplatte, gebaut in der Innenstadt in Kleinserie aber auf Basis der WBS 70. Hier wohnt Christoph Liepach. Er ist Künstler und Verleger, hat bereits Ausstellungen zur WBS 70 gemacht und auch Bücher dazu herausgebracht. Er wehrt er sich dagegen, dass auf diese Viertel und die Bauten in denen er aufgewachsen ist und die ihn geprägt haben herabgeschaut wird.
„Und die Vorurteile sieht man ja auch, dass es Überschriften dann so gibt: Ha, diese grauen Betonwüsten und muss alles weg und wie auch immer. Ich empfinde sie jetzt auch nicht als sonderlich hübsch. Also was auch immer Schönheit sein mag. Aber es gibt wirklich ästhetisch gut gestaltete. Und es gibt so eine Durchschnittsplatte, wo ich auch sagen: Okay, finde ich jetzt auch nicht immer super. Aber es gibt schon auch schöne Lösung: Hier zum Beispiel wo wir jetzt sind mit den kleinen Vordächern und den schönen Balkonen und auch dieser Struktur, dass man nicht im rechten Winkel, sondern 45 Grad-Winkel noch hat. Das ist natürlich interessant. Ne?“
Viel Wohnraum mit möglichst wenig Ressourcen
Großtafelbauweise heißt die korrekte Bezeichnung für den Plattenbau. Großtafeln sind Platten, die in eigenen Werken hergestellt, dann auf die Baustellen gefahren und dort zusammengesetzt wurden. Wie hier bei den Gebäuden vor Christoph Liepach sieht man die Fugen noch, die zwischen diesen Tafeln entstehen. Die WBS 70 war extrem günstig in der Herstellung, genau 26 Zentimeter dick, bestand aus zwei Schichten Beton, dazwischen eine Kerndämmung. Verkehrsflächen wie Flure wurden sehr klein gehalten, mit möglichst wenig Ressourcen möglichst viel Wohnraum geschaffen. Und das gelang auch, in drei Jahrzehnten baute die DDR so über zwei Millionen Wohnungen.
„Jedes Wohnungsbaukombinat, wie ich auch mitbekommen habe, hat das auch anders gelöst. Also da gab es auch selbst in dieser Standardisierung des WBS 70 keine einheitliche Regelung, sondern es gab diesen übergeordneten Typ und der regelte sozusagen die Breiten und die Längen von solchen Gebäuden und Höhen und wie die Platten-Elemente im Grunde sind.“
Die Architektinnen und Architekten konnten damit frei umgehen, so wie das hier bei der Altstadtplatte passiert ist. Oft ging der Zielkonflikt „rationell versus individuell“ aber klar zu Gunsten von rationell aus. Wolfgang Junker, Minister für Wohnungsbau, verteidigte die Platte 1978 im RADIO der DDR etwas hilflos gegen den Vorwurf der Gleichförmigkeit.
„Es geht darum, sowohl rationell zu bauen als auch gute Wohnbedingungen für unsere Bürger zu schaffen. Das versteht man, in kurzen Worten gesagt, in der Wohnungsbauserie 1970. Hinzufügen möchte ich noch zu dieser Sache der Eintönigkeit, dass gerade durch die Gestaltung der Elemente dieser Wohnungsbauserie, dem entgegengewirkt wird ... Und wer die ersten neuen Häuser und Wohngebiete in dieser Serie in der Hauptstadt, aber auch an anderen Stellen der Republik sieht, in Neubrandenburg aber auch jetzt beginnend in Leipzig in Grünau, der weiß, dass also den Architekten, Ingenieuren und Bauarbeitern das schon ganz gut gelungen ist.“
Gleichförmigkeit aus Sparzwang
Schon in den 70er-Jahren mussten die Kombinate so stark sparen, dass sie praktisch alles gleich bauten. Je weniger unterschiedliche Teile, je gleichförmiger die Häuser, desto weniger Material und Arbeitskräfte braucht man. Und darum ging es in der Mangelwirtschaft. Deshalb glichen sich die Häuser und die Neubausiedlungen an den Stadträndern in der ganzen DDR. Beliebt waren sie dennoch, sie boten einen Komfort, den man in den Altbauten nicht fand.
Vor allem gab es Fernwärme und man musste keine Kohlen mehr aus dem Keller schleppen, wie das noch bis zur Wende in fast allen Altbauhäusern der Fall war. Nach außen waren die DDR-Platten meist mit Waschbeton verkleidet, so auch die Gebäude vor Christoph Liepach. Dazwischen aber gibt es Elemente aus braunen Kacheln, teilweise sogar Stuckteile aus Beton.
„Diese gedämpften Farben empfinde ich oft als angenehm, als guten Kontrast zu diesem sehr bunten, überall Werbung über allem. Das ist erst mal so meine Prägung, sage ich mal. Das kann jeder auch wieder anders empfinden. Deswegen. Ich plädiere schon für diesen Waschbeton, auch diese Fassaden, dass man sieht: Eine Platte ist eine Platte. Es ist kein geziegelter Bau. Es ist es kein, wie gesagt, kein Altbau“, sagt Christoph Liepach.
Diese Platten hier sind noch so, wie sie zu DDR-Zeiten gebaut wurden. Die Häuser in den großen Plattenbauvierteln dagegen sind heute meist saniert, die Fugen wurden geschlossen, Dämmung aufgebracht, die Fassaden verputzt und gestrichen, Bunt statt Waschbeton.
„Diese Struktur verschwindet immer mehr. Also diese Platten mit diesen Fugen, diese Strukturierung, diese geriffelten Steine, die da eingesetzt sind. Und das empfinde ich erst einmal als ehrlich. Das ist eine Platte für mich so dieser Betonbau, die Moderne zwar, und das ist auch wieder das Lustige, keine Moderne aus den Zwanzigern, die radikal clean ist, sondern hier wird wieder auch so eine Detailversessenheit reingebracht. Und dieser Bruch mit: Okay, wir haben eigentlich eine radikale Bauweise, die sehr modern ist, mit der man eigentlich sehr viel machen kann.
Und dann lehnt man sich wieder an so traditionellen Mustern an, dass man so Eingänge hat. Rechts und links gehen die Treppenhäuser auf, dass man wie hier diese Balustraden, diese Vordächer, dass man überlegt, wie kann man so Heimeligkeit dann wieder mit diesen Fliesen herstellen, dass man versucht, irgendwie eine Struktur zu schaffen, die eventuell ein bisschen altbaummäßig andeutet, die zwar schon vorgibt, eine Platte zu sein, aber so ein bisschen ... Und dieses, dieser Bruch, den finde ich ganz spannend.“
Bauhaus trieb serielles Bauen voran
Kaum eine Schule steht so für die Moderne wie das Bauhaus und tatsächlich waren es Mitglieder des Bauhauses, die schon in den 1920er-Jahren das modulare und serielle Bauen maßgeblich vorangetrieben haben. Der Umgang der DDR mit diesem Erbe war allerdings widersprüchlich und im Zuge der Formalismus-Debatte der 50er-Jahre sogar feindselig.
Die Staatsführung forderte den sozialistischen Realismus: Kunst, auch die Architektur sollte eine konkrete Aussage haben, möglichst die Aufopferung oder den Sieg der Arbeiterklasse darstellen. Die strenge Reduktion auf die Funktion und auf Form, wie sie das Bauhaus forderte, tat das nicht. Sie wurde deshalb als westlich imperialistisch bekämpft. Trotzdem: Mit Weimar, Dessau, Berlin befanden sich die wichtigen Wirkstätten des Bauhaus auf dem Gebiet der DDR und es gab ja auch viele Anknüpfungspunkte.

Baukasten-Prinzip: das Meisterhaus Kandinsky/Klee des Bauhausmeisters Walter Gropius in Dessau-Rosslau.© imago images / epd / Jens Schlüter
„Da gibt es zum Beispiel bei Walter Gropius immer wieder dieses schöne Argument, mit dem Baukasten zu arbeiten, also modular Architektur zu denken. Also es gibt ein paar Behauptungen, die eben auch sagen: Na ja, der Anker-Baustein-Kasten war sozusagen des Architekten liebstes Spielzeug, aus dem heraus eben auch dieser Gedanke eines Baukastensystems entstanden ist“, sagt Regina Bittner, Direktorin und Vorstand der Stiftung Bauhaus.
„Ein Zeugnis dafür bilden, glaube ich, gerade hier in Dessau besonders die Meisterhäuser für diese Idee sozusagen eines Bauens mit modularen Elementen, die man unendlich erweitern kann, aber zugleich eben auch mit dem Gedanken, einer strengen Reduktion der einzelnen Bauglieder und Bauelemente, sodass man daraus halt eben, unterschiedlichste Varianten generieren kann.“
In den Meisterhäusern lebten die führenden Köpfe des Bauhaus, Gropius selbst, aber auch Kandinsky oder Oskar Schlemmer. Sie sind aus rechteckigen Elementen zusammengesetzt, aus ineinander verschachtelten Würfeln und Quadern. Wie aus einem Baukasten. Im Zentrum der Bauhaus-Idee standen aber auch immer soziale Fragen.
Gerade durch die industrielle Bauweise sollte guter Wohnraum für Menschen geschaffen werden, die nur über kleine Einkommen verfügten und in bisher ärmlichen Verhältnissen wohnten. Diese Verhältnisse prangerten die Bauhäusler an und wollten sie beseitigen, so wie in der Stummfilmreihe "Wie wohnen wir gesund und wirtschaftlich?" aus den 1920er-Jahren.
„In dem Film wird ja so ganz propagandistisch auch gezeigt: die Berliner Hinterhöfe, ne? Fünf an der Zahl, immer tiefer, immer tiefer hinein, die wirklich schwierigen Lebensbedingungen, wo viele Familien auf engstem Raum in ganz dunklen Verhältnissen leben mussten. Und diese Wohnungsnot, das ist eine andere Wohnungsnot, sozusagen, Abhilfe zu verschaffen, mit Licht, Luft und Sonne eine neue Art von Wohnen für die breite Masse der Bevölkerung anzubieten. Das war ja auch ein sehr sozialdemokratisches, sozialreformerisches Projekt, dem sich die Vertreterinnen des Neuen Bauens natürlich auch verpflichtet gefühlt haben.“
Ökonomische Produktionsmethoden notwendig
Zum Neuen Bauen gehörten nicht nur Mitglieder des Bauhauses. Im Zentrum dieser Bewegung stand der Congrès Internationaux d’Architecture Moderne kurz CIAM, der erstmals 1928 in der Nähe von Lausanne zusammenkam. Hier erklärten die Mitglieder wie Le Corbussier, Gropius oder Ernst May die konsequente Abkehr von allen Vorbildern historischer Epochen und sprachen sich für die Rationalisierung und Standardisierung als notwendige ökonomische Produktionsmethode aus.
Das war der Bruch vor allem mit dem Historismus, mit dem Baustil der Gründerzeit, den aufwendigen Fassaden, mit Stuck und anderen schmückenden Elementen. Stattdessen sollten Häuser wie in einer Ford-Fabrik gebaut werden, rein funktional, rationell, kostengünstig. Heraus kam eine klare Form, glatte Fassaden, oft Weiß gehalten, mit Flachdächern, ähnlich dem heutigen Bauhausmuseum in Dessau.
„Das andere Beispiel, das für Dessau gerne immer wieder angeführt wird, um dort schon mal vorzuführen, wie tatsächlich dann eben auch mit Momenten der Vorfertigung gearbeitet worden war, ist ja die Siedlung in Dessau-Törten, die das Büro von Walter Gropius ja entworfen hat und dann eben auch mit - aber nur zum Teil - Elementen von Vorfertigung auf der Baustelle dann auch gearbeitet haben“, sagt Regina Bittner.
„Weswegen ich das so zögerlich oder ein bisschen verhalten sage, ist, weil zeitgleich im neuen Frankfurt unter Ernst May tatsächlich sozusagen in einer großen Halle vorgefertigte Elemente schon produziert worden sind, die dann in den großen Siedlungsprojekten des neuen Frankfurts entstanden war.“
In den 1920er-Jahren probierte May vor allem beim Neuen Frankfurt viele seiner Ideen aus und testete, was möglich war, auch gegen den Widerstand der Stadtverwaltung, wie er später im Radio erklärte.
„In Frankfurt am Main nahmen mir die Stadtverordneten die Sache nicht ab, und dann habe ich die ganzen Leute eingeladen. Habe das, nachdem die Keller ausgegraben waren, habe, dann nachgewiesen, dass in 48 Stunden ein zweistöckiger Bau komplett errichtet werden konnte, natürlich ohne Ausbau, der dauerte ungefähr fünf Monate, sodass sie dann überzeugt waren, dann die Fabrik aufgemacht wurde.“
„Das war also ein ganz anderer Maßstab, der zeitgleich zu dem, was hier in Dessau im kleinen Maßstab in der Siedlung Dessau-Törten entstanden ist, stattgefunden hat. Wird aber oft auch so ein bisschen eher im Schatten sozusagen der Bauhaus-Versuche beschrieben, ist aber eigentlich ein viel signifikant höheres Beispiel für die Vorfertigung im Bauen, die sozusagen in den 20er-Jahren schon Raum gegriffen hat.“
Serielles Bauen auch heute als Teil der Lösung
Heute, 100 Jahre, später gibt es immer noch einen immensen Bedarf an neuem Wohnraum. Das serielle Bauen soll zumindest ein Teil der Lösung sein, so sieht es die Bundesregierung. Und tatsächlich gibt es überraschend viele Parallelen und ähnliche Voraussetzungen: Es herrscht wieder Knappheit an Material und Arbeitskräften. Auch der Einsatz von Energie soll aus Klimaschutzgründen möglichst sparsam sein – auch im Betrieb der Wohnung.
All das sind Aspekte, bei denen die industrielle Bauweise ihre Vorteile ausspielen kann. Durch die Großwohnsiedlungen der Nachkriegszeit mit ihren sozialen Problemen haftet dem seriellen Bauen aber bis heute ein Stigma an. Zu Unrecht sagt Jutta Albus, die Professorin für ressourceneffizientes Bauen an der Universität Dortmund ist.
„Ich sehe auch diese Kritik, die dem seriellen Bauern oft unterstellt wird, dass es einfach ein sehr gleichförmiges Erscheinungsbild generiert. Und ich glaube, da müssen wir uns aber dann auch einfach mal fragen, inwieweit wir das auch beeinflussen können und wie wir das eigentlich verbessern sollten und auch nicht nur gegen dieses industrielle Bauen stellen, sondern einfach sagen: Welche Vorteile birgt es? Und wie kann man denn den gesamten Planungs- und dann auch Herstellungsprozess verbessern? Weil ich glaube, die Qualitäten, die sind sehr offensichtlich, dass man die einfach berücksichtigt und weiterbringt und das in einer Architektur umsetzt, die sich dann natürlich auch für alle in sehr positiver Erscheinung äußert.“
Knapp 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen stammen aus der Bau- und Gebäudewirtschaft. Und in Deutschland hat der Bau das zweite Mal in Folge die Klimaziele nicht eingehalten. Außerdem, so Albus, würden beim Bau gewaltige Mengen an Rohstoffen eingesetzt. Die Effizienz und die hohe Qualität des seriellen und modularen Bauens sei ein Schlüssel, hier gegenzusteuern.
„Ich bin mir im Klaren darüber, wir brauchen Material, und wir brauchen auch natürlich die Energie für den Bauprozess und den letztendlichen Betrieb. Aber insgesamt wäre für mich eigentlich die Idee, hinter dem Ganzen: So wenig wie möglich zu verbrauchen und das in einer Art kontrollierten Herangehensweise. Und das heißt eigentlich ein sehr überschaubarer, optimierter Planungs- und Bauprozess. Das birgt für mich dieses vorgefertigte Bauen. Und es birgt natürlich auch eine hohe Effizienz in der Ressourcennutzung, also in der Ressourcenschonung. Und es bietet auch die gestalterischen Qualitäten für die letztendliche Architekturumsetzung. Das muss man nur erkennen.“
Abwechslungsreiche, ansprechende und sich in die Umgebung einfügende Architektur sei seriell gefertigt genauso möglich wie auch in der konventionellen Bauweise, sagt Jutta Albus. Es liege an der Architektin oder dem Architekten, das umzusetzen.
Digitalisierung und Automatisierung entscheidend
Die Vorteile in Sachen Nachhaltigkeit sind auch für Sven Rickes und Ulf Bohne das schlagende Argument für eine industrielle Vorfertigung. 2020 haben sie mit einigen Mitstreitern das Start-up Imti gegründet. In einem Industriegebiet im niedersächsischen Stadthagen haben sie ein Musterhaus aufgebaut. Die Basis des Gebäudes bilden große Module, offene Rahmen die durch unterschiedliche Teile ausgebaut, verbunden und verkleidet werden können. Fast alles besteht aus Holz, das nachwächst und CO2 bindet, anstatt es freizusetzen.
„Heute haben wir die Möglichkeit, das Ganze komplett zu digitalisieren schon im Planungsprozess. Und wir können halt mit dem natürlichen, nachwachsenden Rohstoff Holz auch ganz anders in einer Fabrikumgebung arbeiten, in einem designten, orchestrierten Fertigungsprozess, der komplett digital gestützt ist. Und dann habe ich alle drei Effekte: Digitalisierung, Automatisierung und Industrialisierung“, sagt Sven Rickes.

Die Vorteile in Sachen Nachhaltigkeit sind auch für Sven Rickes (r.) und Ulf Bohne vom Start-up Imti das schlagende Argument für eine industrielle Vorfertigung.© Manuel Waltz
Digitalisierung und Automatisierung, das sind entscheidende Unterschiede zu früher, denn diese machen es möglich, seriell zu bauen, mit all seinen Vorteilen: günstig, effizient, sehr schnell, dabei energie- und materialsparend. Und das Entscheidende: dennoch variabel. So wie in der Autoindustrie: Der Prototyp der Massenfertigung, das Ford T-Modell, war immer gleich, es gab es sogar nur in einer Farbe. Heute werden Autos in individueller Massenfertigung produziert, am Fließband und standardisiert aber frei kombinierbar: Lederbezüge oder Stoff, großes Display oder kleines, Fließheck oder Kombi. So etwas ist auch im Bau möglich.
Das Musterhaus besteht aus drei Teilen, drei Modulen. Diese Module sind nicht starr und einheitlich, sondern sie bestehen aus einzelnen Segmenten – Submodulen – die unterschiedlich zusammengesetzt werden können.
„Wir haben einfach nur Tausende von Grundrissen analysiert, haben die Patterns abgeleitet. Also was wiederholt sich immer wieder, haben daraus ein Mustergebäude entwickelt und haben dieses Mustergebäude dann neu gedacht, in Bauteilen neu gedacht, aber eben nicht von Fassade zu Fassade in Raummodulen, sondern eben in Raumteilen“, erklärt Sven Rickes.
Vorgefertigt wird also keine Platte, sondern viele auch sehr unterschiedliche Einzelteile, das macht den Bau variabel. Sven Rickes und Ulf Bohne haben die Module digital Im Computer in Einzelteile zerlegt und nachgebaut, also sogenannte digitale Zwillinge. Möglich macht das das sogenannte Building Information Modeling, kurz BIM, oder auf Deutsch:
Bauwerksdatenmodellierung. Digital, mithilfe Künstlicher Intelligenz, entsteht daraus das ganze Haus in allen Einzelteilen. Und das sowohl optisch als auch mit ihren bauphysikalischen Eigenschaften: Also wie schwer ist es, welche Lasten kann dieses Teil tragen, auch wo die Leitungen verlaufen, wo die Anschlüsse…
„Und wenn du da oben auf dieses Modul drauf schaust, dann siehst du insgesamt sechs Segmente, die zu diesem Modul zusammengeführt werden. Die Segmente, die du da oben siehst, von diesen Segmenten haben wir über 500 Stück entwickelt.“
Offene Plattform für Architektinnen
Auf der offenen Plattform können sich Architektinnen und Architekten dieser Teile bedienen und damit ganz unterschiedliche Häuser bauen, an Grundrisse anpassen, in bestehende Rohbauten einfügen. Sie können auch selbst eigene Segmente kreieren und dann auf die Plattform hochladen und für andere nutzbar machen - ähnlich wie beim App Store oder bei Google Play.
Bis auf das Fundament verzichten Rickes und Bohne auf Beton. Ein zentraler Aspekt ist auch, dass die einzelnen Segmente wiederverwendet werden können. Alles lässt sich wieder auseinandernehmen, aufbereiten und dann wieder zu einem neuen Haus zusammensetzen. Wie, das zeigt Rickes in ein paar Minuten auf der von ihnen entwickelten App, die bei der Planung alle Regelwerke berücksichtigt. Auf seinem Laptop hat Rickes gerade für einen vorgegebenen Grundriss ein Haus geplant, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint.
„Und da ist das Gebäude, innerhalb von weniger als zwei Minuten steht hier ein fix und fertiges, genehmigungsfähiges, bauantragsreifes, baufertiges Gebäude. Das ist ein kompletter, vollwertiger digitaler Zwilling, mit allen Informationen über alle Bauteile und alle Details mit dem Preis auf den Cent genau, mit dem CO2-Speicher, der da drin ist, mit der konkreten Wohnfläche, Bruttogrundfläche, Grundstücksauslastung. Alles, was du dir vorstellen kannst. Alle Daten, die heute Monate kosten, um sie für ein Gebäude zu erstellen, geht innerhalb von weniger als zwei Minuten.“
Durch diese Technik könne die Planung extrem verkürzt werden. Und auch das Bauen, sagt Ulf Bohne, denn die einzelnen Segmente werden direkt digital in die Fabrik übermittelt, dort vollautomatisch hergestellt, dann auf die Baustelle gefahren und dort nur noch zusammengesetzt. Und das sei wegen der Automatisierung 20 Prozent günstiger als ein konventioneller Bau, so rechnet Ulf Bohne.
„Als Beispiel produzieren wir in einer automatisierten Fabrik eine Wohneinheit pro Stunde schlüsselfertig. Eine Wohneinheit pro Stunde, also ein 32-Familienhaus, wird in 32 Stunden produziert, muss dann natürlich noch aufgestellt werden. Und da brauchen wir auch keine zwei Jahre, wie in dieser Größenordnung das normalerweise dauern würde, sondern zwei Monate. Höchstens zwei Monate, weil, das muss fundamentiert werden, abgedichtet werden, oben, aber das heißt, wir beschleunigen den Prozess enorm. Und das ist die Zukunft für uns.“






