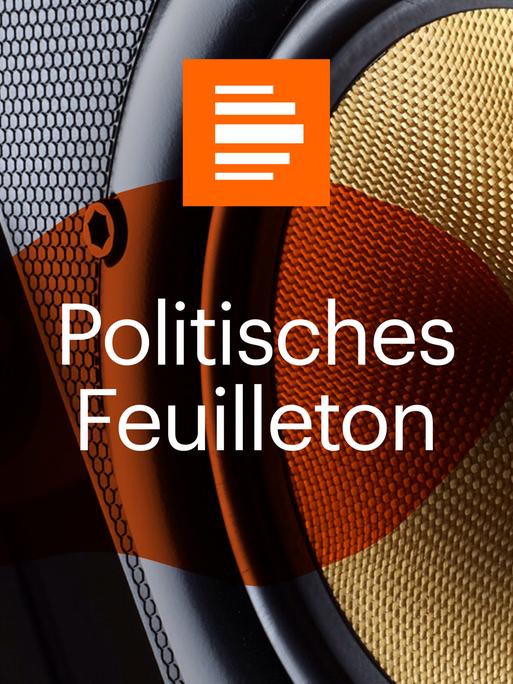Die Macht von Scham und Beschämung

Dass man sich schämt, ist zutiefst menschlich. Doch wofür man sich schämt, das ist kulturell geprägt. Die Scham dient einerseits dem Durchsetzen sozialer Regeln. Sie kann aber auch als politisches Machtinstrument missbraucht werden.
„Die Scham muss die Seite wechseln“ – mit diesem Satz sprach Gisèle Pelicot vielen Opfern sexueller Gewalt aus der Seele. Die Französin wurde jahrelang von ihrem Ehemann missbraucht, betäubt und anderen Männern zur Vergewaltigung überlassen.
„Die Scham muss die Seite wechseln“
Mit ihrem Satz ging die Entscheidung der Klägerin Pelicot einher, dass die Türen des Gerichtssaals im französischen Avignon im Herbst 2024 geöffnet werden sollen. Ihr Satz ging um die Welt und machte deutlich, dass Scham ein Gefühl ist, das durch gesellschaftliche Zuschreibungen entsteht und benutzt wird, um Menschen zum Schweigen zu bringen und ihnen die Macht zu nehmen.
Der Fall zeigte aber auch, dass Scham dazu beitragen kann, bestimmte Standards des zivilisierten Zusammenlebens zu bewahren. Frankreich hat seine Rechtsprechung entsprechend angepasst: Sexuelle Handlungen dürfen künftig nur mit ausdrücklicher Zustimmung erfolgen.
Inhalt
Scham – ein Gefühl, das unwillkürlich entsteht
Wie es sich anfühlen kann, sich zu schämen, wissen vermutlich die meisten: Das Blut schießt in den Kopf. Der ganze Körper wird heiß, die Haut kribbelt, das Herz rast. Der Atem wird flach, fast erstickt, während der Puls explodiert. Der Blick senkt sich. Jetzt sollte sich am besten der Erdboden auftun, damit man auf der Stelle verschwinden kann. Es ist ein Gefühl, das unwillkürlich entsteht.
Schämen ist zutiefst menschlich, doch wofür Menschen sich schämen, ist kulturell und historisch bedingt. Scham ist also nicht ausschließlich ein persönliches Empfinden, sondern spielt eine viel größere, manchmal sogar politische Rolle.
Von Flugscham bis Fleischscham
Unser Konsumverhalten sei heute oft von Schamsignalen begleitet, sagt der Philosoph Robert Pfaller, Autor von „Zwei Enthüllungen über die Scham“. Während man früher aufs Auto, das Eigenheim oder das Geschenkeverpacken vielleicht sogar stolz gewesen sei, schäme man sich heute dafür.
Von Flugscham bis Fleischscham, bei manchen Menschen regt sich inzwischen beim Griff ins Warenregal die innere Stimme und fragt: Brauche ich das wirklich? Steckt da vielleicht Kinderarbeit drin?
Der Soziologe Christian von Scheve von der Freien Universität Berlin unterscheidet moralische Scham von sozialer Scham. Erstere trete auf, wenn man den selbst gesetzten Standards, Normen und Erwartungen nicht gerecht werde.
Soziale Scham hingegen entstehe durch Ausschluss, Missachtung oder die Herabwürdigung einer kleinen Peergroup oder auch der ganzen Gesellschaft.
Scham als Sanktionsinstrument
Für den Soziologen ist die Angst vor der Scham „ein starkes soziales Regulationsmittel“. Leute an den Pranger zu stellen als „Strategie der Beschämung“ diene in informellen Kontexten dazu, Leute auf Linie zu halten.
Auch wenn es um Gesetze oder verbindlich festgelegte Verhaltensregeln geht, funktioniere dieser Mechanismus. Scham und Beschämung hält Christian von Scheve deshalb für effiziente und effektive Sanktionsinstrumente.
Der Philosoph Robert Pfaller hingegen sieht in der Auffassung, dass Scham durch den Blick von außen hervorgerufen wird, einen grundlegenden Irrtum. Wenn beispielsweise ein Konzern die Umwelt verpestet und dafür an den Pranger gestellt wird, fürchteten die Verantwortlichen im Konzern zwar, durch die Enthüllung Kunden zu verlieren. Sie empfänden aber vermutlich keine Schamgefühle.
Scham – die Instanz für den Augenschein
Pfaller bringt eine psychoanalytische Lesart der Scham ins Spiel. Demnach gebe es ähnlich wie beim Schuldgefühl eine innerpsychische Instanz, die bei Scham oder auch Höflichkeit wirksam sei.
Diese Instanz achte nur auf den Augenschein. Wolle man etwa jemanden herzlich die Hand schütteln, drücke aber zu fest zu oder halte die Hand zu lange fest, sei der Akt der Höflichkeit aus Sicht der Beobachtungsinstanz misslungen.
Scham hilft, die Form zu wahren
Sie fordere uns auch dazu auf, uns angemessen zu kleiden, im Restaurant etwas leiser zu sprechen oder Gäste einzuladen und uns zu revanchieren, wenn wir eingeladen wurden, meint Pfaller. Der Philosoph betont, dass es hier nicht um moralische Gesetze geht, sondern um „Gesetze, die auf das Erhalten eines Augenscheins ausgerichtet sind“.
Unabhängig davon, wie Scham genau ausgelöst wird, hat sie aber auch bei Pfaller eine normative Funktion, die dazu führt, dass Menschen sich weitestehend an die geltenden Regeln oder Konventionen halten.
Scham und gesellschaftlicher Protest
Was aber, wenn Teile der Gesellschaft bestimmte Standards anzweifeln, weil sie sich davon diskriminiert fühlen oder Normen und Regeln als nicht mehr zeitgemäß empfinden? Das Verschieben von Scham- oder Beschämungsgrenzen kann dann als gesellschaftlicher Protest sichtbar werden.
Als Beispiel nennt der Soziologe von Scheve die Schwulenbewegung Ende der 1970er-Jahre, aber auch aktuelle Proteste gegen Umweltsünden, Kriege oder politische Allianzen.
Bei den Demonstrationen im Jahr 2025 gegen die Zusammenarbeit mit demokratiefeindlichen Parteien wollten die Demonstrierenden vor allem zeigen, dass sie mit dem Rechtsruck in der Gesellschaft nicht einverstanden sind.
Eine Demonstrantin sagte, dass sie sich für die Vergangenheit Deutschlands schäme und sich deshalb auch für Menschen schäme, die heutzutage rechtsextreme Parteien wählten.
Wenn Schamgrenzen neu verhandelt werden
Auch beim Pelicot-Vergewaltigungsprozess wurde Scham neu verhandelt. Statt hinter verschlossenen Türen fand der Strafprozess im Licht der Öffentlichkeit statt. Damit setzte sich die Klägerin Gisèle Pelicot über die stillschweigende Annahme hinweg, dass sich Opfer sexualisierter Gewalt zu schämen hätten.
Sie als Opfer beschämte darüber hinaus den Täter mit dem Satz, die Scham müsse die Seite wechseln. Für ihr mutiges Rütteln an den Machtverhältnissen erhielt sie viel Zuspruch. Denn wer sich schämen soll, wird von denen entschieden, die die Macht für sich beanspruchen.
Trump spielt mit den Schamgefühlen mancher sozialer Gruppen
Doch nicht immer führt die Neuverhandlung der Schamgrenzen zu gesellschaftlichem Fortschritt. Es kommt darauf an, wer sie verschiebt und mit welcher Absicht. Soziologe von Scheve nennt US-Präsident Donald Trump als Beispiel.
Wenn Trump der ländlichen, weißen, männlichen Bevölkerung verspreche, dass er die Uhr zurückdrehen werde, spreche er gezielt das Schamgefühl dieser sozialen Gruppe an. Denn: Viele ihrer Verhaltensweisen gelten nicht mehr als zeitgemäß. Die Gruppe habe ihren Status verloren und werde heute für Dinge kritisiert, für die sie einst gelobt wurde, so der Soziologe.
Scham als Pendant zu Stolz und Ehre
An dieser Stelle ist es hilfreich, nochmals auf Robert Pfaller und seine These von Scham als innerer Beobachtungsinstanz zurückzukommen. Er argumentiert, dass Scham weniger mit moralischen Gesetzen als vielmehr mit Oberflächen und gesellschaftlichen Konventionen zu tun habe. Scham gehört damit in das kulturelle Feld von Stolz und Ehre. Oder, wie Pfaller sagt: „Stolz ist die positive Seite der Scham.“
Dabei geht nicht so sehr darum, dass man alles richtig gemacht hat, weil kein Fleck auf dem Hemd ist. Sondern um das, was verloren gehe, wenn man einen Fleck auf dem Hemd entdecke, erläutert der Philosoph. „Vorher ist man jemand.“ Das beziehe sich weniger auf das Handeln einer Person als auf ihr Sein und den Stolz, den diese Persönlichkeit ausstrahle.
Übertragen auf die abgewertete Gruppe der männlichen, weißen, ländlichen Bevölkerung bedeutet Trumps Versprechen also die Aussicht, von dem unangenehmen Gefühl der Scham befreit zu werden und endlich wieder jemand zu sein.
Shaming, Fremdschämen oder Cringe
Die Praxis des „an den Pranger-Stellens“ in den unregulierten Sozialen Medien ist heute Alltag. Jede Äußerung kann schnell zu Hass, Hetze und Bedrohungen führen. Wer eine andere Meinung vertritt, soll eingeschüchtert werden.
„Wir erleben sehr viele Situationen, wo eine gewaltige Angst vor dem Urteil anderer besteht, die einen peinlich finden“, sagt Robert Pfaller.
Fremdschämen, oder wie Jugendliche sagen: Cringe, gehe manchmal mit einem Gefühl der Überlegenheit einher, sagt Pfaller: „Man selbst ist stolz darauf, dass man so ein sensibles Gespür für die Peinlichkeit der anderen besitzt.“ Scham werde so zur Waffe in der Hand in den schärfer werdenden Distinktionskämpfen in der Gesellschaft mit dem Ziel, „andere zu deklassieren“, sagt Pfaller.
Scham erinnert uns daran, dass wir Teil von anderen sind
Beschämung kann aber wie im Fall Gisèle Pelicot zu gesellschaftlichem Fortschritt und dem Schutz der Unversehrtheit des Gegenübers führen. Darum ist es eine ständige Gesellschaftsaufgabe, die Interpretation von Scham und die Funktion von Beschämung zu definieren.
Scham erinnert daran, dass wir als Einzelpersonen immer Teil einer Gruppe, eines Staates, einer gemeinsamen Erde und somit einer gemeinsamen Geschichte sind. Dass sich unser Handeln auf andere auswirkt.
tha