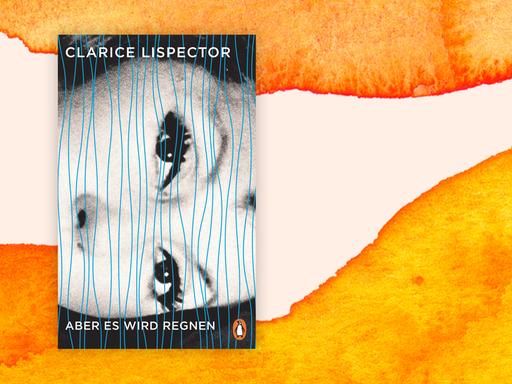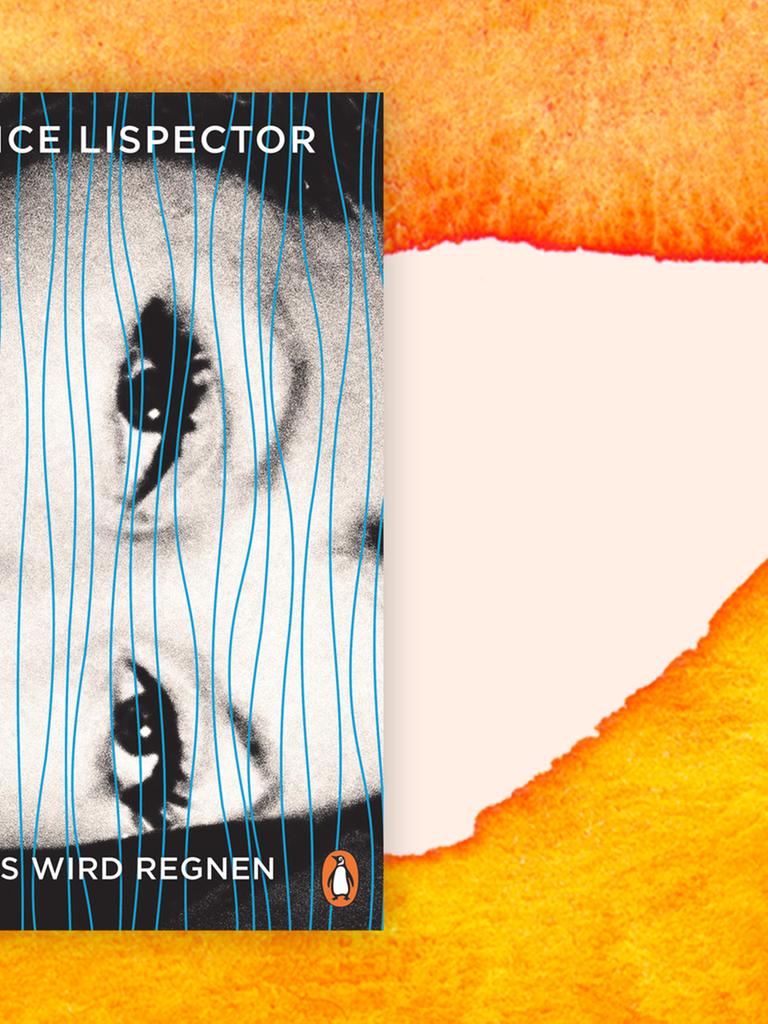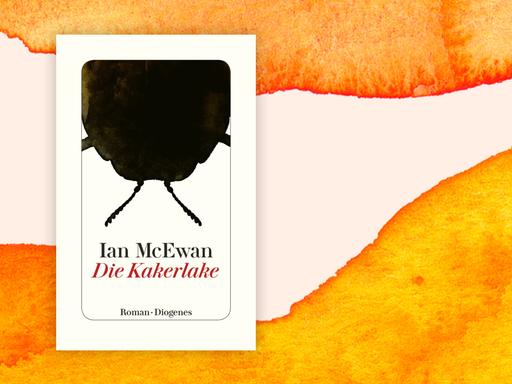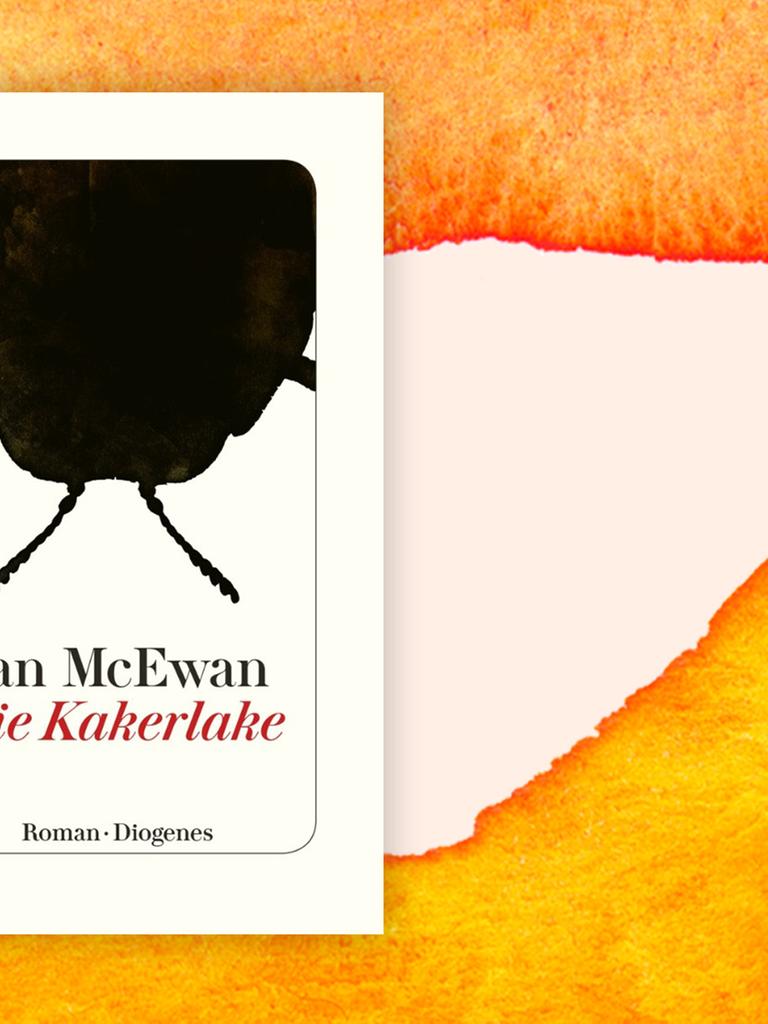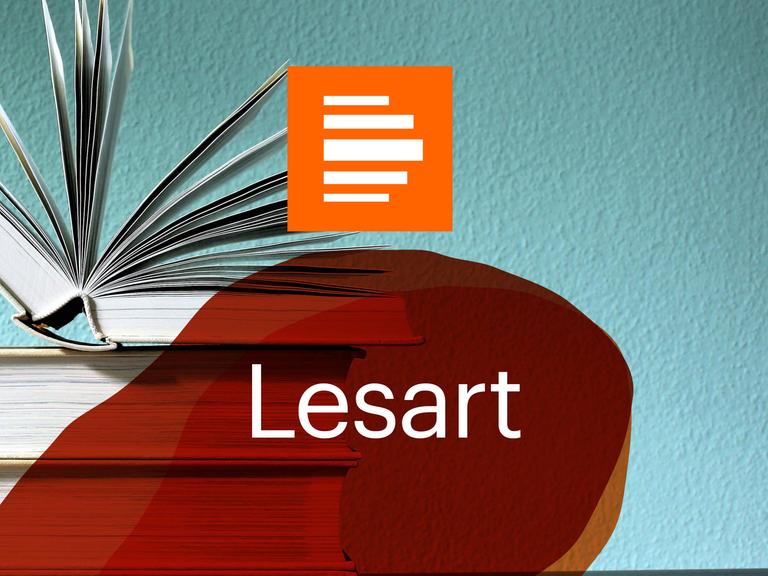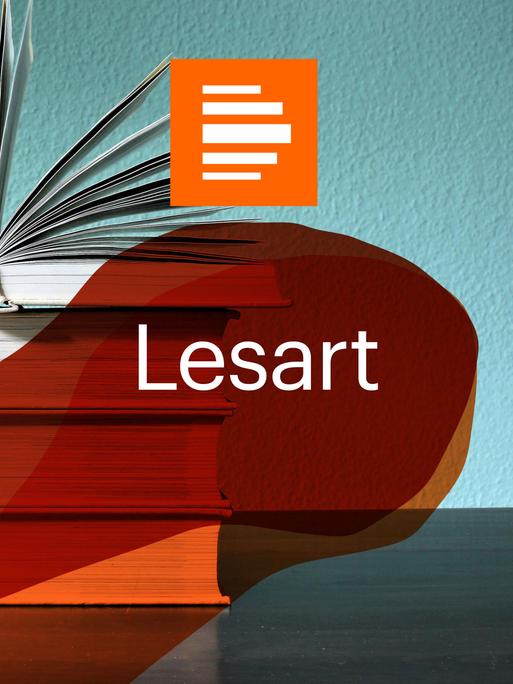Clarice Lispector: "Die Passion nach G.H."
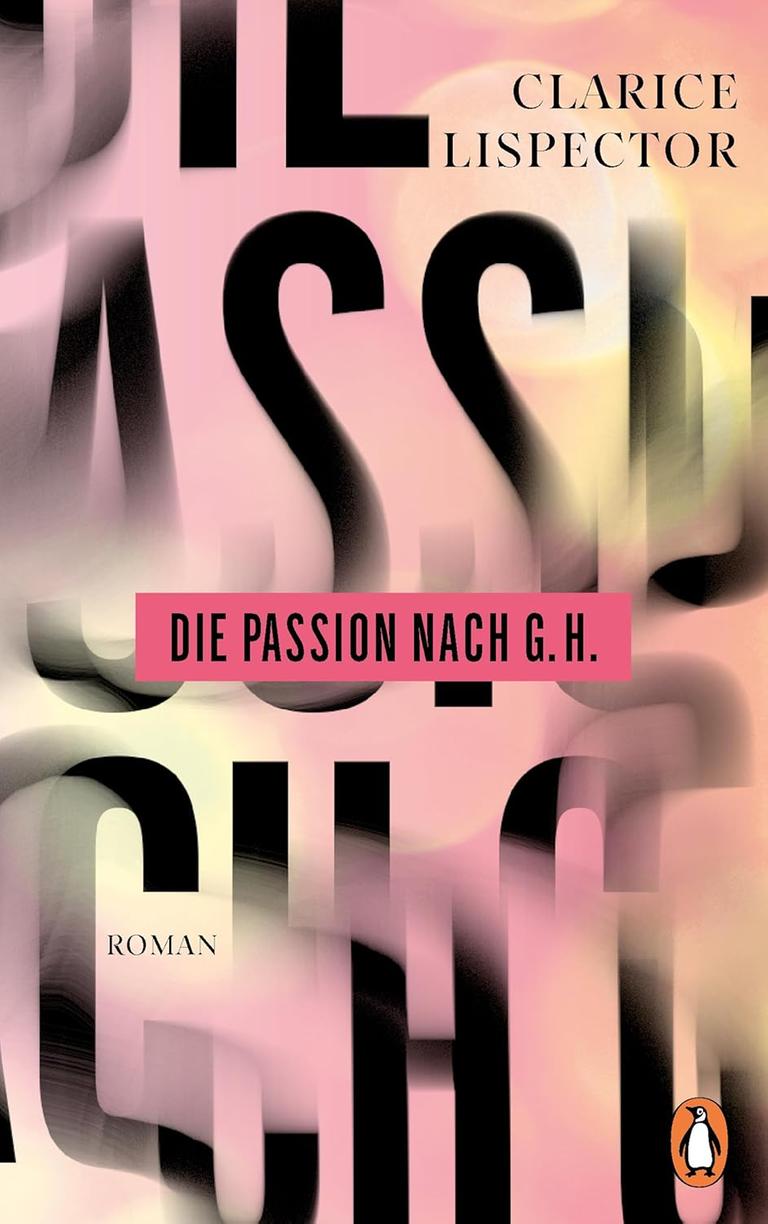
© Penguin Verlag
Kakerlaken-Mystik
06:12 Minuten
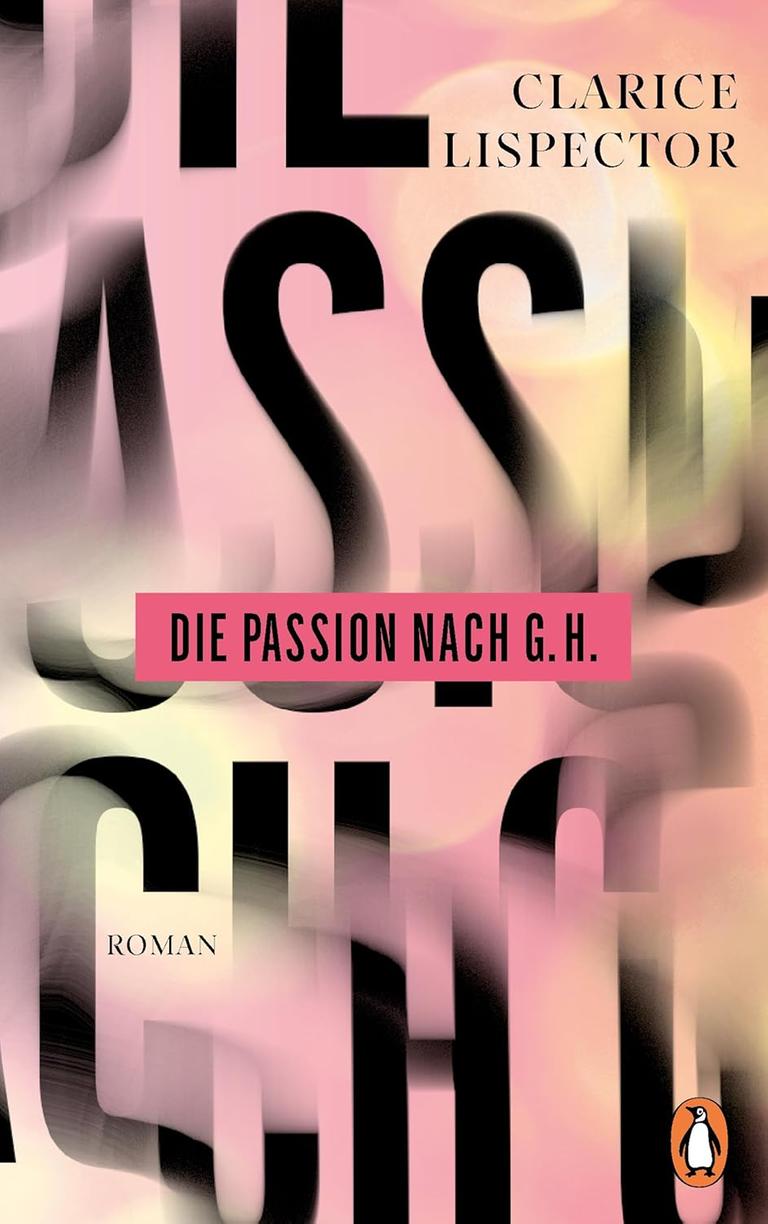
Clarice Lispector
Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Luis Ruby
Die Passion nach G.H.Penguin, Penguin224 Seiten
24,00 Euro
Eine Frau stößt zu Hause auf eine Anderswelt, die ihr bisheriges Leben infrage stellt. Clarice Lispectors Roman „Die Passion nach G.H." verbindet Grauen und Existenzialismus und wird als lateinamerikanisches Pendant zu Kafkas „Verwandlung“ gerühmt.
Oft ist es kokette Inszenierung, wenn Ich-Erzähler zu Beginn eines Romans unter Zaudern und Stocken versichern, dass ihnen die Worte fehlen, um von einem verstörenden Erlebnis zu berichten. Bei Clarice Lispectors Passionsgeschichte ist dergleichen jedoch sehr ernst zu nehmen:
„--- ich bin am Suchen, am Suchen. Ich versuche zu verstehen… Ich weiß nicht, was ich aus dem Erlebten machen soll, ich habe Angst vor dieser tiefen Unorganisiertheit. (…) Ich habe nicht ein Wort zu sagen. Warum halte ich dann nicht den Mund? Aber wenn ich das Wort nicht herbeizwinge, wird mich die Stummheit für immer überspülen.“
G.H. ist eine anerkannte Bildhauerin, eine arrivierte Frau der brasilianischen Gesellschaft. Chic, Kultur, eine gewisse lässige Ironie und der Komfort einer weiträumigen Penthouse-Wohnung – all das machte bis gestern ihr Leben aus.
Unkaputtbares Leben
Dann aber hat sie die Kammer ihres gekündigten Dienstmädchens aufgesucht, um aufzuräumen. Statt der erwarteten muffigen Unordnung findet sie dort – abgesehen von einem irritierenden Wandbild – jedoch nur eine helle, saubere Leere vor, die zur Fläche für ihre plötzlichen panischen Projektionen wird.
Die Kammer wird zum Minarett, zu einem „trockenen Ofen namens zehn Uhr vormittags“, zur „libyschen Wüste“, wo in der Ferne schon „Damaskus zu sehen“ sei, die älteste Stadt der Welt. Noch älter aber ist das Tier, das G.H. beim Blick in den leeren Kleiderschrank ins Auge springt:
„Da, ehe ich verstand, bekam ich ein graues Herz, so wie man graue Haare bekommt. Dem Gesicht gegenüber, das ich in die Öffnung gesteckt hatte, recht nahe an meinen Augen, hatte sich im Halbdunkel diese fette Kakerlake bewegt. (…) Ihrer Langsamkeit und Fettheit nach war das eine sehr alte Kakerlake.“
Kakerlaken gab es schon vor den Dinosauriern, sie sind Zeugen der Erdgeschichte, unkaputtbares Leben, vor dem alles Menschliche als Episode erscheint. Hastig drückt G.H. die Tür des Kleiderschranks zu, quetscht die Kakerlake ein, so dass sich der vordere Teil außen an der Schranktür hochreckt und langsam eine weiße Masse aus dem geplatzten Leib quillt.
Sturz ins Bodenlose
Zeitlupenhaft wird der innere Taumel beschrieben, in den die vom Ekel geschüttelte Erzählerin gerät, angeschaut von der sterbenden Kakerlake. G.H. verliert das „menschliche Gefüge“ und ihre Identität, deren Geringfügigkeit sich schon in der Beschränkung auf die Initialen andeutet.
Die Kakerlake steht für die reine Biologie des Daseins, für das Organische, Kreatürliche; sie symbolisiert, wie es heißt, „das Entsetzen des neutralen Lebens“, vor dem sich die Menschen in „Rollen“ und „Masken“ flüchten. Die Erzählerin macht eine grundstürzende Erfahrung der Desorganisation: Die „vermenschlichte Welt“ ist höchst fragil, mit ihren sozialen Konventionen, den Ritualen gegenseitiger Anerkennung und den Insignien des Erfolgs.
Als Akt der „Anti-Sünde“ entschließt sich die Erzählerin, den Brei, der aus der Kakerlake quillt, zu essen, so wie Christus nicht zurückscheute vor den Aussätzigen. Vergebens, denn ihr fehle die „Demut der Heiligen“.
Diese eigenwillige Passionsgeschichte ist weniger ein Roman als eine Meditation in lyrisch-mystischer Prosa, deren Pathos gelegentlich durch Momente grotesker Komik gebrochen wird. Immer wieder findet die Erzählerin faszinierende Bilder, etwa wenn sie schreibt, dass die „Stille der Verstorbenen“ in sie eindringe „wie Efeu ins Maul steinerner Löwen“.
Gelungene Metaphern und Tiefsinnskrämpfe
Weniger überzeugend ist, vor allem in der zweiten Hälfte, die Liebe der Autorin zu philosophisch-theologischen Chiffren und einem schlecht gealterten Existenzialismus. Identität, Transzendenz, Gesetz, „Plasma des Gottes“, „erneuerte Erbsünde“, das „Unreduzierbare“, die „Verfühligung“, der „Geschmack des Nichts“ als „geheime Freude der Götter“, das Menschsein als „Orgasmus der Natur“, die „Höllenorgie“ als „Apotheose des Neutralen“ usw. usw. – der Schwurbelgenerator arbeitet auf vollen Touren und spuckt dunklen Schwulst aus:
„… in den Zwischenräumen der ursprünglichen Materie liegt die Achse von Rätsel und Feuer, die der Atem der Welt ist, und der ständige Atem der Welt ist, was wir hören und Stille nennen. (...) Die Kakerlake und ich sind höllisch frei, weil unsere lebende Materie größer ist als wir, weil mein eigenes Leben so wenig in meinen Körper passt, dass es mir nicht gelingt, es zu benutzen."
„Die Passion nach G.H.“ wird als lateinamerikanisches Pendant zu Kafkas „Verwandlung“ gerühmt. Kafka ist jedoch alles Raunende fremd. Er erzählt in schlichten Worten von einer rätselhaften Welt; Lispector erzählt in rätselhaften Worten von einer Erfahrung, die womöglich viel schlichter ist als es die Tiefsinnskrämpfe ihrer Sätze vermitteln möchten.
Autorin tappt selbst im Dunkeln
Kein Zweifel, Clarice Lispector hat großartige Erzählungen geschrieben. Dieses Buch aber bezeichnet selbst der Übersetzer Luis Ruby im Nachwort als „Zumutung“ – in jenem auszeichnenden Sinn, nach dem die großen Texte der Moderne Zumutungen für die Leser sein wollen, deren Anstrengung am Ende belohnt wird.
Aber die Belohnung bleibt aus, wenn man im Bemühen um Verständnis zunehmend den Eindruck gewinnt, dass die Autorin selbst im Dunklen tappt. Freimütig gesteht die Erzählerin:
„Wenn die ‚Wahrheit‘ das wäre, was ich verstehen kann – wäre sie am Ende nur eine kleine Wahrheit, eine von meinem Format."
Literatur, möchte man einwenden, lebt gerade von den „kleinen Wahrheiten“. Wer aber das Unbegreifliche bevorzugt, dürfte bei Lispectors Kakerlaken-Mystik auf seine Kosten kommen.