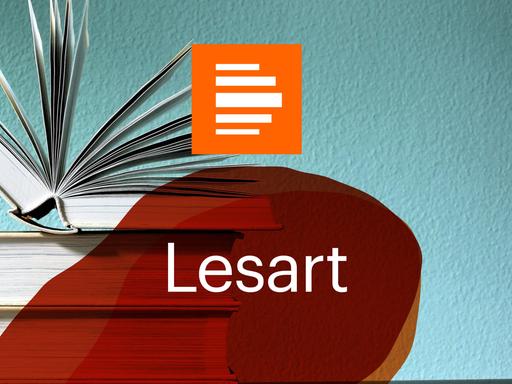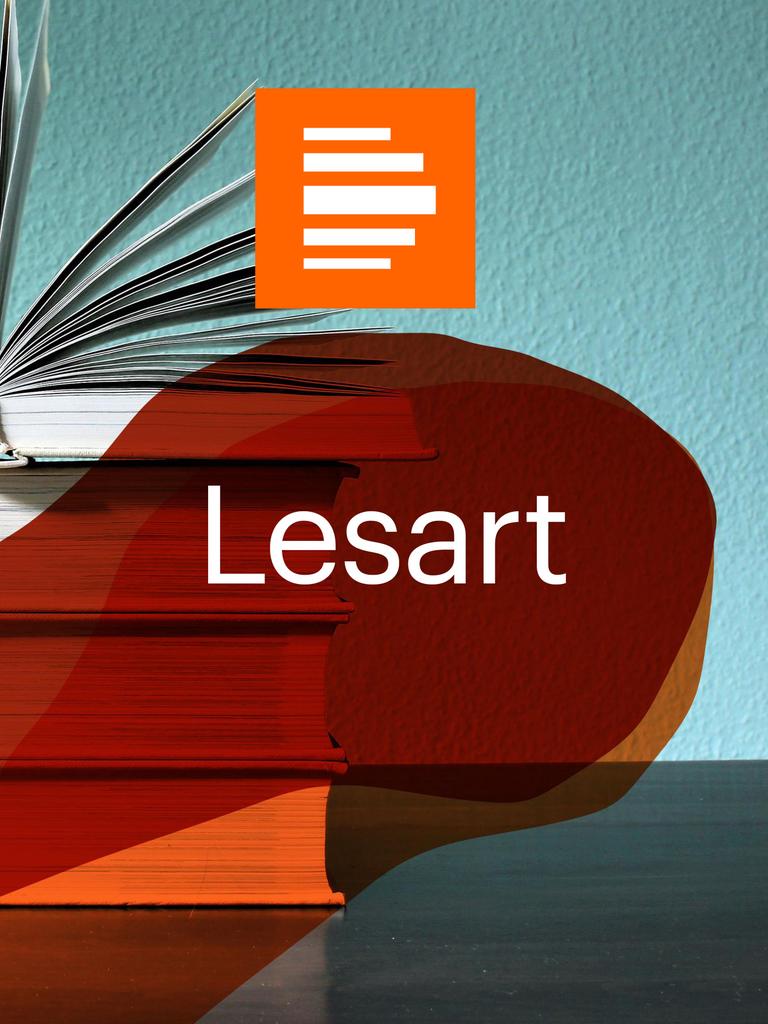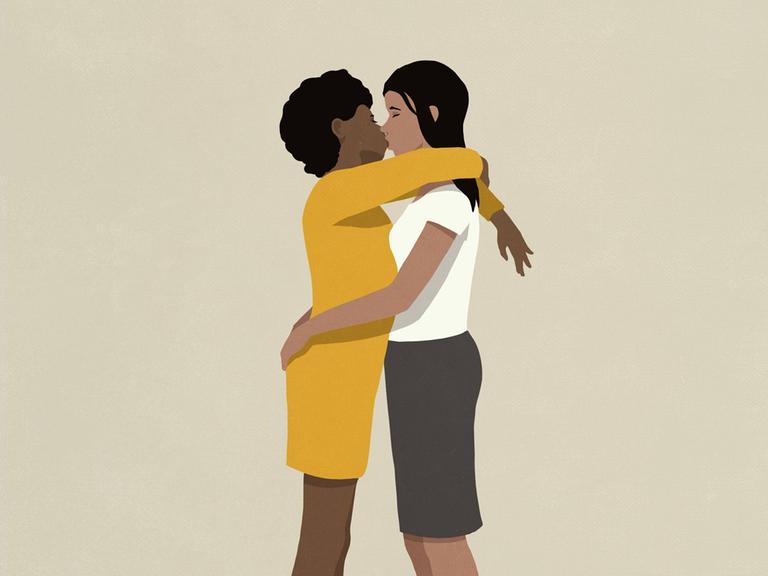Geschichte der Queerness
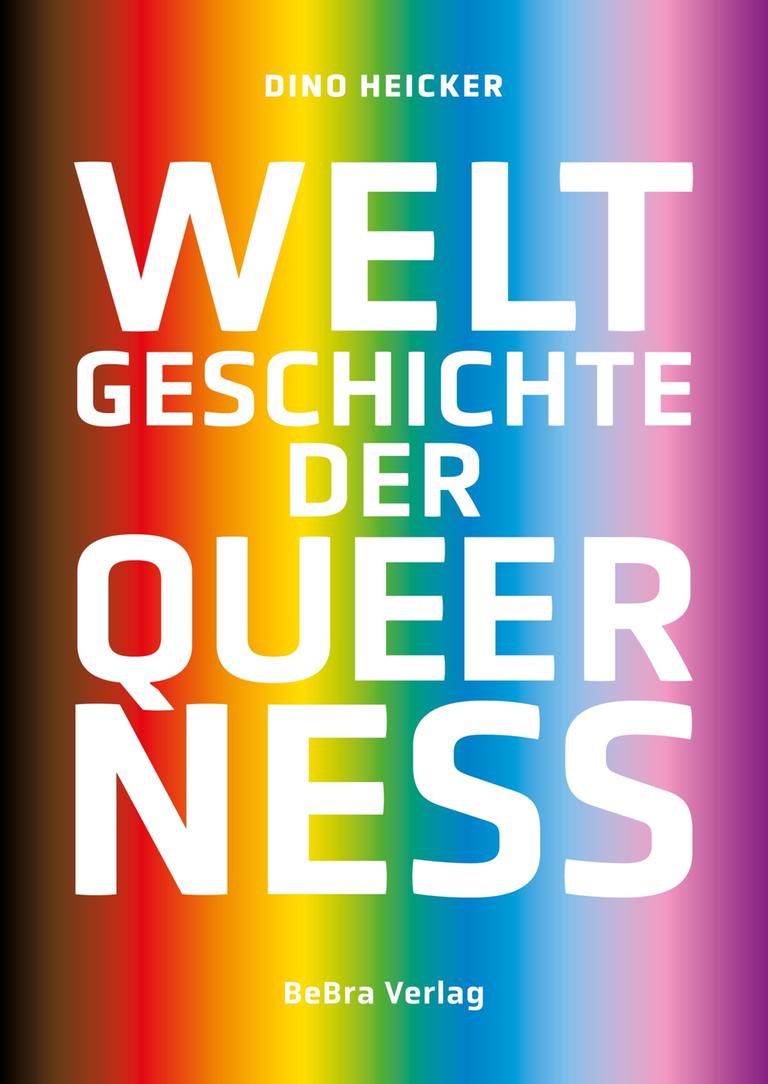
© BeBra Verlag
Von Göttervater Zeus bis Doktor Queer
07:11 Minuten
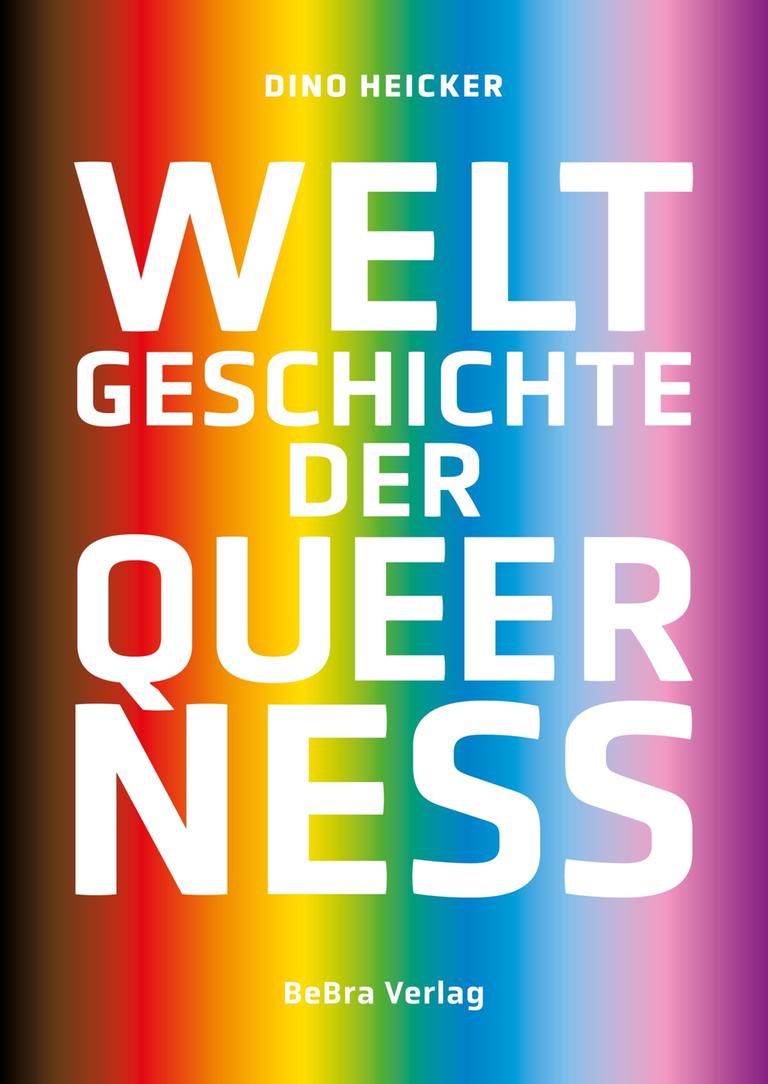
Dino Heicker
Weltgeschichte der QueernessBeBra Verlag, Berlin 2025336 Seiten
30,00 Euro
Homosexualität gibt es, seit die Menschheit existiert. Der Begriff queer ist neueren Datums. Dino Heicker streift durch ein breites Spektrum unterschiedlichen Begehrens in Kunst, Film, Literatur und Gesellschaft – von Platon bis Rosa von Praunheim.
Die Queerness beginnt in dieser Weltgeschichte bei Sodom und Gomorrha und bei den alten Griechen und ihrer Mythologie. Dort war sexuelle Wandlungsfähigkeit bis in die höchsten Kreise angesagt: „In modernem Verständnis könnte man diesen sexuellen Allesfresser“, nämlich Zeus, „als den queeren Gott schlechthin auffassen, da er Hetero- ebenso wie (männliche und weibliche) Homosexualität und Bestialität praktizierte“, schreibt Dino Heicker.
Der Göttervater konnte sein Geschlecht nach Belieben wandeln, sich als Wolke oder goldenen Regen kleiden und auch dann noch Geschlechtsverkehr vollziehen, „als er ganz Natur geworden war, was nun aber wirklich eine unbenennbare Liebe ist, denn für Sex mit Wetterphänomenen fehlt uns Menschen jeglicher Begriff“.
„Polymorph pervers oder pansexuell“ lautet die launige Überschrift zum Zeus-Kapitel. Danach tritt Herakles als „Halbgott in Fummel“ auf - sowie der schöne Jüngling Hermaphroditos, der bis heute als Sinnbild von Mehr- oder Zwischengeschlechtlichkeit gilt.
Eine erfrischende, niemals langatmige Lektüre
Dino Heicker schreibt flott und mit leichter Süffisanz. Das ist höchst erfrischend. Denn oft ist der Ton in den Debatten und Beiträgen rund um den Themenkreis sexuelle Identität und Geschlecht heutzutage tendenziell ja eher ernst-aktivistisch, mitunter polarisierend und anklagend, jedenfalls weit entfernt von (Selbst-)Ironie. Vielleicht liegt es daran, dass Heicker Jahrgang 1965 ist, also einer Generation angehört, für die Homosexualität noch mehr Lebensweise als Weltanschauung ist.
Der erfreulich unakademische Gestus des promovierten Literaturwissenschaftlers macht diese sehr anekdotische, wenig systematisch angelegte „Weltgeschichte“ zu einer höchst interessanten und lehrreichen, aber eben keineswegs langatmigen Lektüre. Man wird geistreich informiert, auf Bekanntes und Unbekanntes hingewiesen.
Der Biss in den Pfirsich
Etwa das Liebesleben im China der Kaiserzeit: Laut einer Überlieferung war über 2000 Jahre hinweg ein angebissener Pfirsich, den ein Jüngling einem anderen Mann reichte, ein Sinnbild für gleichgeschlechtliche Liebe. In Südamerika stießen spanische Eroberer im Gefolge von Kolumbus auf „Indigene in weiblicher Tracht“, die „die schreckliche Sünd der Sodomey begangen“ haben sollen.
Dann führt uns Heicker in die französische Adelsgesellschaft des 18. Jahrhunderts, als die Chevalière d'Éon Furore machte. Erst nach ihrem Tod stellte sich heraus, dass die brillante Fechterin in Wahrheit ein Mann in Frauenkleidern gewesen war. Das Buch springt von Weltgegend zu Weltgegend, von Epoche zu Epoche und quer durch die Kultur- und Literaturgeschichte, von Sappho über Virginia Woolf bis zu James Baldwin.
Heicker lenkt den Blick auf einschlägige Stellen in den Erzählungen aus „Tausendundeiner Nacht“ und auf Künstler wie Michelangelo, den Schöpfer der Homo-Ikone „David“. Oder auf dessen Zeitgenossen Antonio Bazzi, der wegen seiner allseits bekannten Schwäche für hübsche junge Männer den Spitznamen „Il Sodoma“ trug.
Von Oscar Wilde zum Christopher Street Day
Natürlich kommt auch die brutale Verurteilung zu zwei Jahren Zuchthaus und Zwangsarbeit des Schriftstellers Oscar Wilde, Schöpfer des „Dorian Gray“, zur Sprache – ein Fall, an dem sich die repressive Doppelmoral der christlich geprägten bürgerlichen Gesellschaft Europas in erschütternder Deutlichkeit zeigte.
Dabei formten sich gerade ab dem Ende des 19. Jahrhunderts Bewegungen, die Homosexualität wissenschaftlich betrachteten, nicht mehr ausschließlich diffamierend und diskriminierend. Der in Berlin praktizierende Arzt Magnus Hirschfeld, hier lässig als „Dr. Queer“ tituliert, wird als Schwulenaktivist gewürdigt, der 1919 in dem „sozial-hygienischen Filmwerk“ mit dem programmatischen Titel „Anders als die Anderen“ zu sehen war.
Die Darstellung verdichtet sich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Stonewall-Revolte 1969 in der New Yorker Christopher Street – namensgebend für die heutigen CSD-Paraden – eine weltweite Protestbewegung für die Rechte von Lesben und Schwulen einleitete.
Rosa von Praunheim, durch seinen Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ und seine spätere Outing-Kampagne zum bekanntesten Aushängeschild der Schwulenbewegung in Deutschland geworden, kommt ebenso vor wie der an den Folgen von Aids gestorbene französische Philosoph Michel Foucault.
Abweichung als Teil der menschlichen Existenz
Es ist enorm, wie breit diese „Weltgeschichte der Queerness“ angelegt ist, wie viele Namen, Phänomene, Überlieferungen, literarische Belege Dino Heicker hier zusammengetragen hat. Seine Darstellung ist gleichzeitig weit davon entfernt, vollständig zu sein.
Dieses Buch ist so anregend, da nicht ausschließlich die jahrtausendelange Verfolgung und Diskriminierung im Vordergrund steht. Vielmehr zeigt es, dass die Abweichung von einer durch Religion oder Gesellschaft bestimmten sexuellen Norm von Anfang an und überall selbstverständlich Teil menschlicher Existenz war und ist.