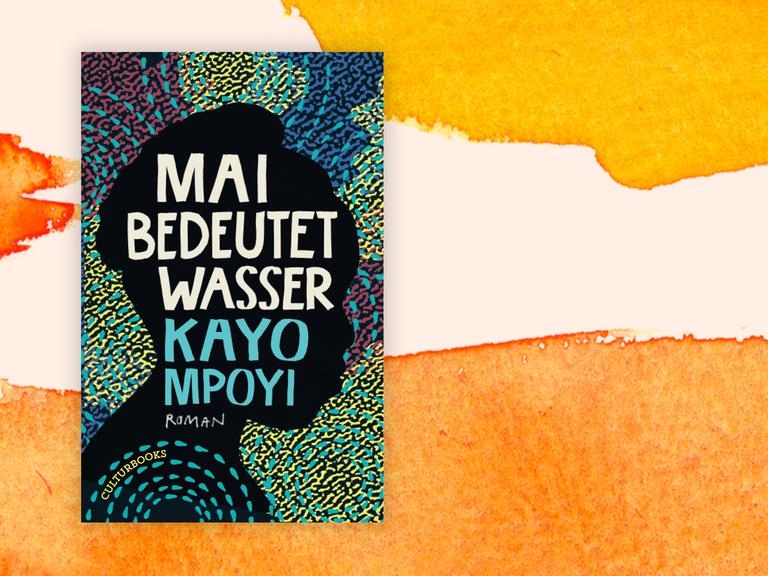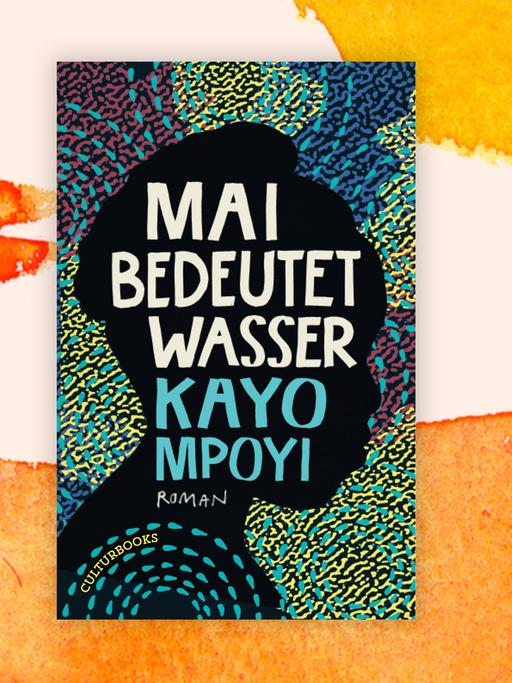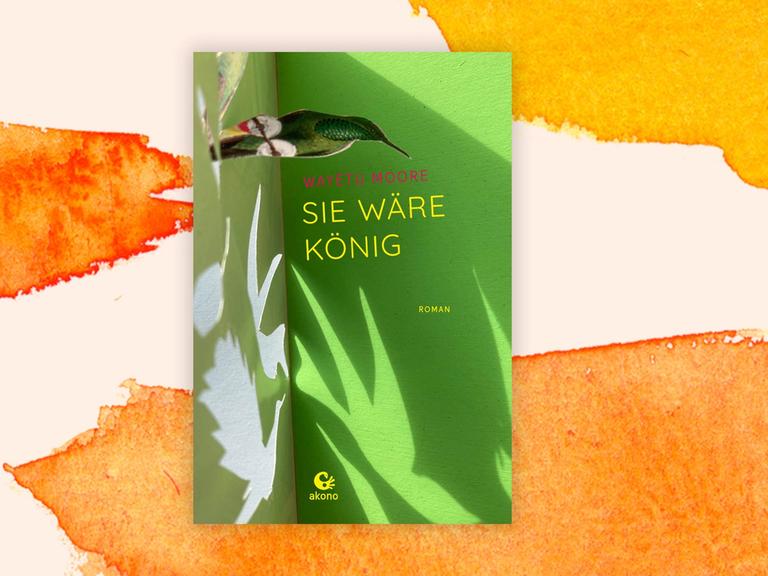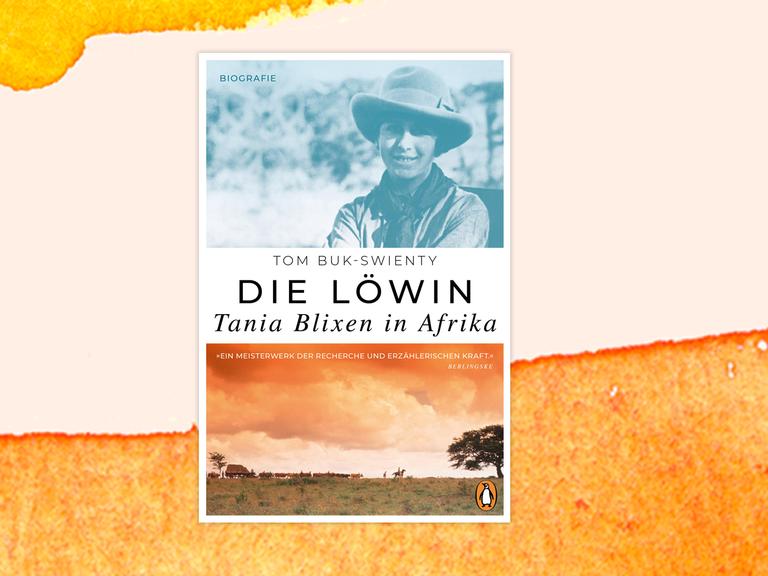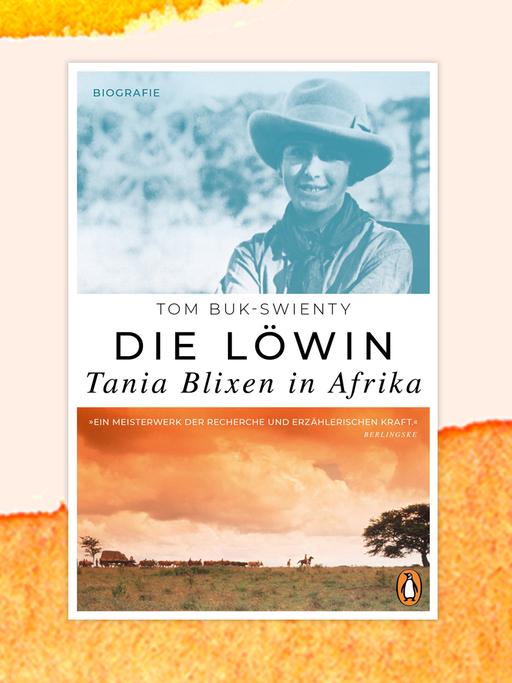Damon Galgut: "Das Versprechen"
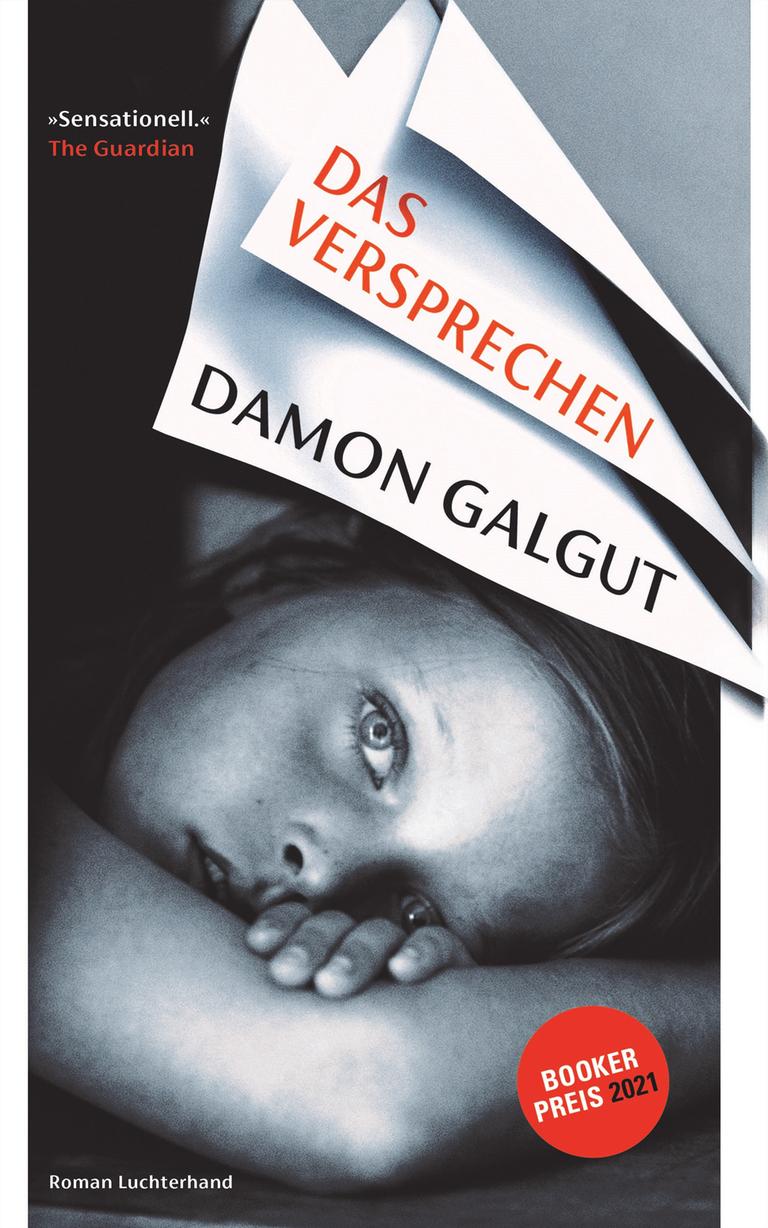
© Penguin Random House Verlagsgruppe
Tod, Verlust und Katharsis
06:16 Minuten
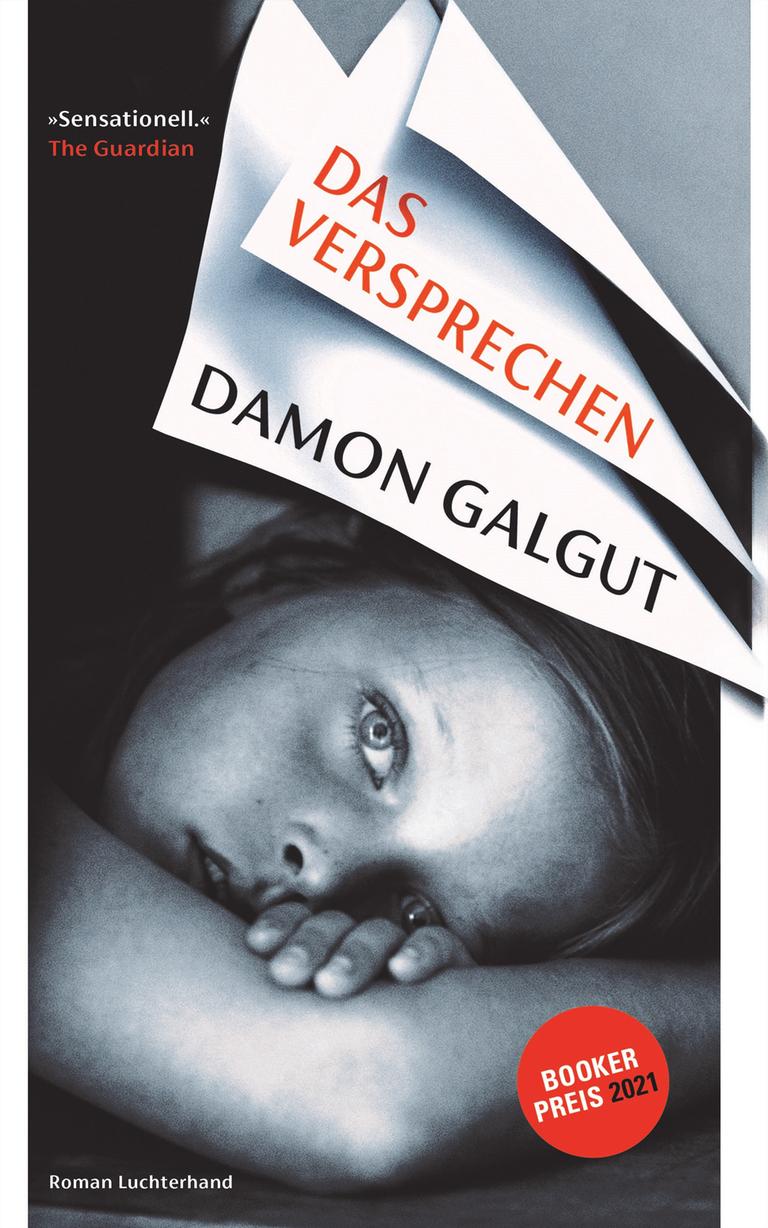
Damon Galgut
Übersetzt von Thomas Mohr
Das VersprechenLuchterhand, München 2021368 Seiten
24,00 Euro
Ein Wort wird gebrochen, ein Versprechen nicht eingelöst: Das wird eine südafrikanische Farmerfamilie über Jahrzehnte verfolgen. Damon Galgut hat mit Sprachwucht ein großes Gesellschaftsporträt verfasst.
Kurz vor ihrem Tod hat die 40-jährige Rachel ihrem Mann ein Versprechen abgenommen: Die schwarze Hausangestellte Salome soll als Anerkennung für ihre Dienste das Haus auf dem Farmgelände übertragen bekommen, in dem sie mit ihrem Sohn lebt. Doch die Familie denkt nicht daran, dieses Versprechen einzulösen.
Nur die jüngste Tochter Amor, zufällig Zeugin des Gesprächs ihrer Eltern, wird ihren Vater und die beiden älteren Geschwister Astrid und Anton immer wieder daran erinnern.
Neues System, alte Gewohnheiten
Als Rachel 1986 stirbt, herrscht in Südafrika noch die Apartheid. Offiziell endet diese zwar 1994 mit der Wahl Nelson Mandelas zum Präsidenten, aber noch weiß niemand, wie man die neue Demokratie leben soll.
„Jeder“, sagt Astrid an einer Stelle, „macht einfach so weiter wie vorher, nur ist es netter jetzt, da es Vergebung gibt und keine Boykotte mehr.“
Damon Galgut erzählt in "Das Versprechen" vom Zerfall einer weißen südafrikanischen Farmersfamilie außerhalb von Pretoria entlang der politischen Umbrüche in Südafrika. Die Geschichte spannt sich über gut drei Jahrzehnte und zeigt, wie schwierig es ist, die Vergangenheit zu überwinden und wie Gewalt und Rassismus ins Private hineinwirken.
Fünf Familenmitglieder, viele Todesfälle
Rachels Tod ist nur der erste in einer Reihe von Todesfällen. Jedes der vier Kapitel trägt den Namen eines der fünf Familienmitglieder – nur Amor ist kein eigenes Kapitel gewidmet.
Da ist neben Rachel, die zum Missfallen der Familie in ihren letzten Lebensjahren zum jüdischen Glauben zurückgekehrt ist, Manie, der Vater. Er war lange Alkoholiker, bis er sich einer Kirche zuwendet, die ihren Mitgliedern das Geld aus der Tasche zieht.
Da ist Anton, der Älteste, der unter einem Verbrechen leidet, das er in der Armee begangen hat. Ein kluger junger Mann, der seine Potenziale niemals nutzen wird. Und da ist die magersüchtige Astrid, die mit ihrer zweiten Ehe sozial aufsteigt.
Gerechtigkeit für die Regenbogennation
Mit atemberaubender Konsequenz überlässt Galgut die Figuren ihrem Schicksal. Einzig Amor, die Schlüsselfigur des Romans, kommt davon. An ihr hängt das gebrochene Versprechen, das sich wie ein roter Faden durch das Buch zieht.
Es ist ein Fluch, der auf der Familie lastet, aber auch auf der südafrikanischen Gesellschaft. Kann es Gerechtigkeit für eine Nation geben, so lautet eine der zentralen Fragen des Romans, die wegen der vielen Volksgruppen und der elf Landessprachen Regenbogennation genannt wird?
Der Erzähler bleibt nah dran an den Figuren, denen man in ihrer Ambivalenz nie wirklich nahekommt. Schon wegen der Kälte und Sprachlosigkeit, die zwischen den Familienmitgliedern herrscht. Amor verschwindet für Jahre und taucht nur zu den Beerdigungen auf.
Wechsel der Perspektive
Die Erzählweise ist realistisch. Aber der Erzähler wechselt die Perspektiven, beendet die Sätze bisweilen nicht oder wendet sich unvermittelt an die Leserinnen und Leser. Durch diese Erzähltechnik des "Stream of Consiousness" überträgt sich eine bedrohliche Unruhe, die der klaren Struktur auf irritierende Weise zuwiderläuft. Galguts Sprache ist atemlos, fast rau, der Ton bei aller Hoffnungslosigkeit bisweilen sarkastisch und humorvoll. Doch er kippt nie ins Satirische, weil Galgut seine Figuren immer ernstnimmt.
Der Roman entfaltet nicht nur sprachlich eine große Wucht und einen unwiderstehlichen Sog. Hier steckt alles drin: Schicksal, Tod, Verlust bis hin zu einer Art Katharsis am Schluss, die einen Funken Hoffnung lässt.