Sumit Paul-Choudhury: “The Bright Side” Buchkritik
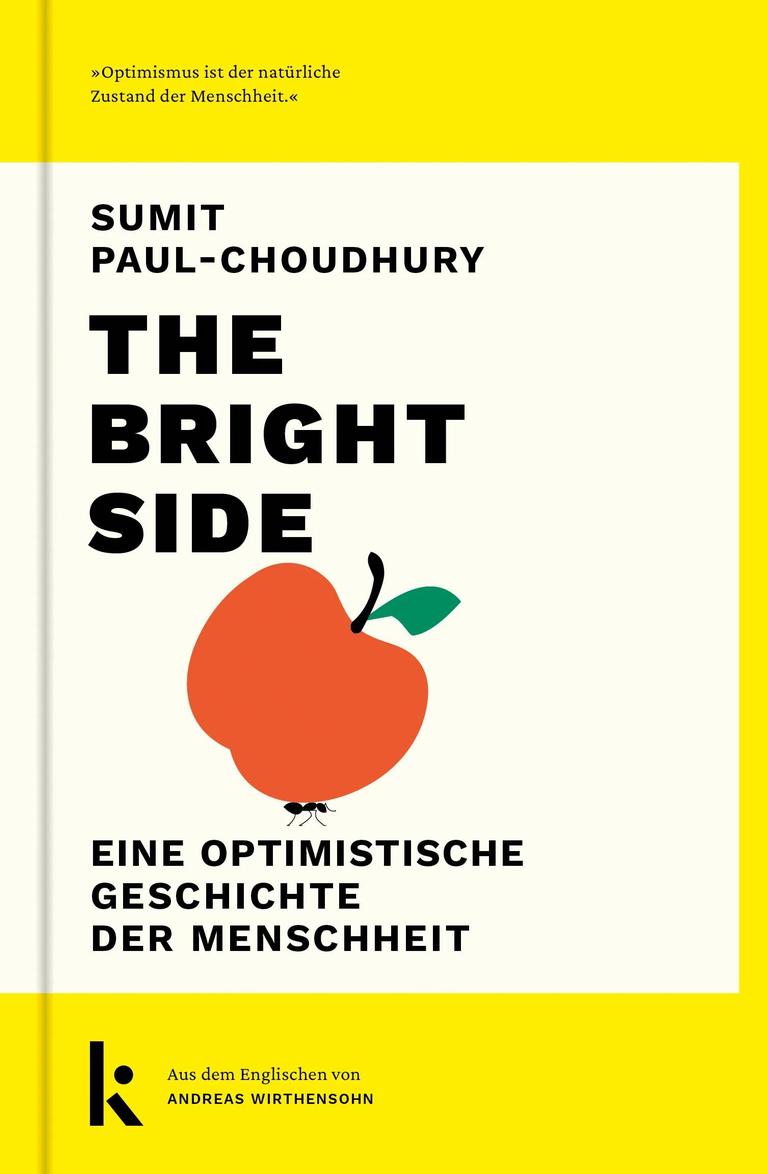
© Kjona Verlag
Optimismus ist nicht Schönfärben
06:57 Minuten
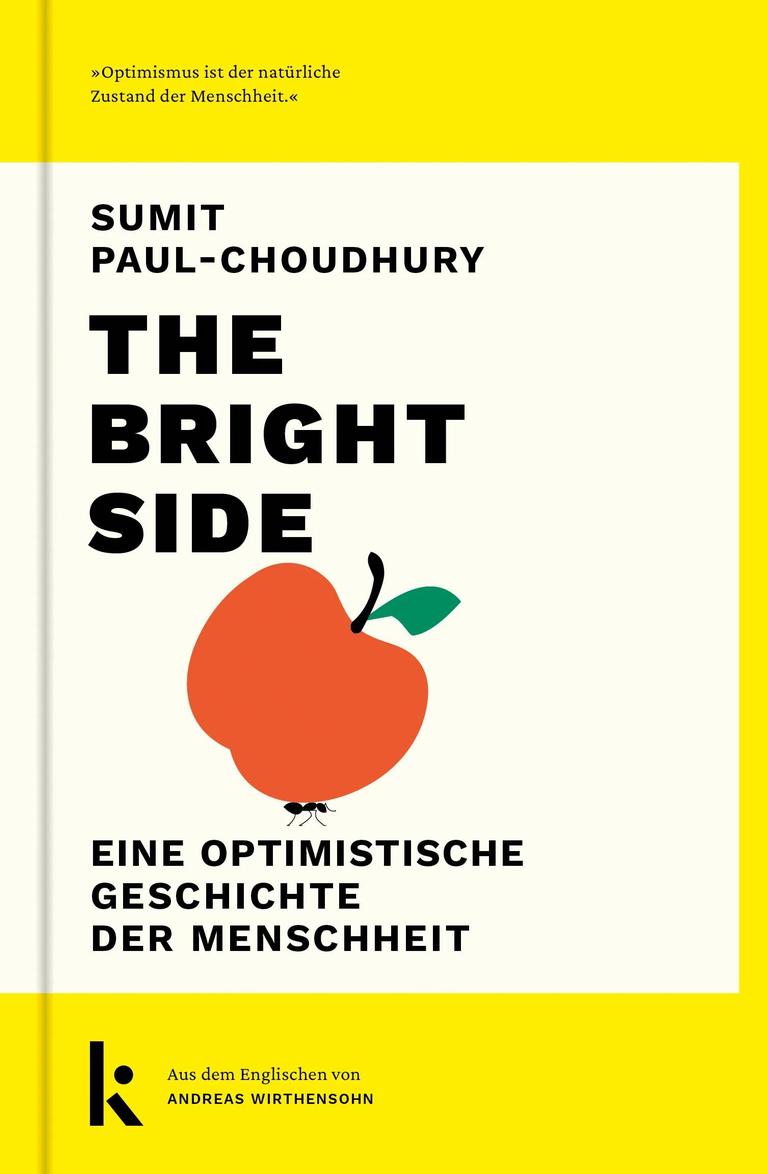
Sumit Paul-Choudhury
The Bright SideKjona Verlag, München 2025384 Seiten
25,00 Euro
Wie man der Falle eines vermeintlich „realistischen“ Pessimismus entgeht, verrät das neue Buch des britischen Wissenschaftspublizisten Sumit Paul-Choudhury. Es kommt gerade zur richtigen Zeit.
Das Buch von Sumit Paul-Choudhury, einem englischen Physiker und langjährigen Chefredakteur der angesehenen Wissenschaftszeitschrift „New Scientist“, trägt einen wahrlich irritierenden Titel: „The Bright Side. Eine optimistische Geschichte der Menschheit.“
Doch hat hier nicht die einst noch am Film-Kreuz „Always look on the bright side of life“ trällernde Monty-Python-Truppe Pate gestanden, sondern die persönliche Lebensgeschichte des Verfassers, dazu wissenschaftliche Neugier und ein profundes Interesse an Philosophie und kognitiven Experimenten.
„Zum Optimisten wurde ich in der Nacht als meine Frau starb.“ Mit diesem schockierend anmutenden Satz beginnt dieses Buch, das sich alsdann weitet zu einer überaus fakten-fundierten Reflexion über jene Chancen, die ein wohlverstandender Optimismus bietet. „Ich wollte eine Möglichkeit finden, Optimist zu sein, die tatsächlich dazu beiträgt, die Welt besser zu machen, anstatt nur davon auszugehen, dass sie es irgendwie sein würde.“
Wer sich nicht bewegt, hat bereits verloren
Im Gegensatz zu Meister Pangloss, dem weltberühmten Schönredner aus Voltaires ironischem Roman „Candide“, gehen nämlich die Optimisten, an denen sich Sumit Paul-Choudhury orientiert, keineswegs davon aus, in „der besten aller möglichen Welten“ zu leben. Im Gegenteil. Sie kommen aus eisigen Regionen, was etwa in der Überlebensgeschichte der 1915 in der Antarktis gestrandeten Mannschaft des Forschers Ernest Shackleton durchaus wörtlich zu nehmen ist.
Ohne das nicht tot zu kriegende und auch gegen einen vermeintlichen „Realismus“ andenkende Bewusstsein, es wider alle Wahrscheinlichkeit vielleicht ja doch schaffen zu können, wäre es bei diesem nämlich bereits frühzeitig zur Kapitulation vor der menschenfeindlichen Natur gekommen.
Ein weiteres Beispiel liefert die Schriftstellerin Helen Keller, der eine Kinderkrankheit Seh- und Hörvermögen geraubt hatte und die einen ihrer Essays gerade deshalb mit „Optimismus“ betitelte – für den britischen Wissenschaftsjournalisten eine Art Geistesschwester über die Zeiten hinweg.
Ein weiteres Beispiel liefert die Schriftstellerin Helen Keller, der eine Kinderkrankheit Seh- und Hörvermögen geraubt hatte und die einen ihrer Essays gerade deshalb mit „Optimismus“ betitelte – für den britischen Wissenschaftsjournalisten eine Art Geistesschwester über die Zeiten hinweg.
Dabei wird in seinem Buch keineswegs lyrisch geschwärmt; viel lieber hält er sich da an Prognosen und Statistiken. Ohne diese zu neuen Gottheiten zu verklären, weist er darauf hin, dass die weltweite Abnahme von Kriegen, Kinderkrankheiten, Seuchen, Analphabetismus und Armut ebenso eine Tatsache ist wie die Zunahme der Temperatur infolge des Klimawandels, die vieles bereits Erreichte zu zerstören droht.
Plädoyer für einen wissensbasierten Optimismus
Tätiger Optimismus stellt sich dem entgegen, so zum Beispiel in der „stillen Revolution bei der Erzeugung von Solar- und Windenergie“. „Ich war deshalb frustriert, wie sehr die Umweltbewegung die Technologie geringschätzte. Auch war es eine Enttäuschung zu hören, dass jemand wie Greta Thunberg, die sich eine Plattform geschaffen hatte, sie lediglich dazu benutzte, leere Parolen zu rufen.“
Zu einem eindimensionalen Manifest eines forschen „Do it yourself“ (oder gar eines libertär-sozialdarwinistischen „Jeder ist seines Glückes Schmied“) wird dieses Buch indessen in keiner Zeile. Beinahe zeitgleich im englischen Original und in deutscher Übersetzung erschienen, konnte der Autor bei Drucklegung selbstverständlich noch nicht wissen, wie konkret destruktiv die Handlangerdienste eines Elon Musk bei der Durchsetzung der autoritären Trump-Agenda sein würden. Bereits zuvor aber zeigt er in diesem Buch ein feines Sensorium für die Hybris des Superreichen, für einen Machbarkeitswahn jenseits universeller Werte und ethischer Selbstbeschränkung.
Wer aber ist dieses menschenfreundlich-optimistische „Wir“?
Gerade hier aber liegt dann auch ein argumentativer Schwachpunkt von „The Bright Side“. Denn so sympathisch die Beschwörung eines gemeinsamen „Wir“ auch ist, das mit Pflichtgefühl, Enthusiasmus und Sachkenntnis zu Werke geht, um Herzen und Hirne zu erreichen: Wer bitte ist dieses „Wir“, wer arbeitet ihm zu und – noch wichtiger – welche Phalanx aus mächtigen Einzel- und Lobby-Interessen stemmt sich ihm entgegen?
Wäre der Autor somit also doch noch in die Falle eines apolitischen Idealismus geraten? Ein Pessimist würde wahrscheinlich in selbstgerechter Resignation antworten: Tja, wie zu erwarten war. Halten wir uns deshalb besser an das, was uns dieses Buch an Entscheidendem mit auf den Weg gibt: Wer nicht an das Gelingen und das Bessere glaubt, hat bereits verloren. In Amerika und in Europa, in der angegriffenen Ukraine, auf der ganzen Welt – und nicht zuletzt in unserer ganz privaten Existenz.






