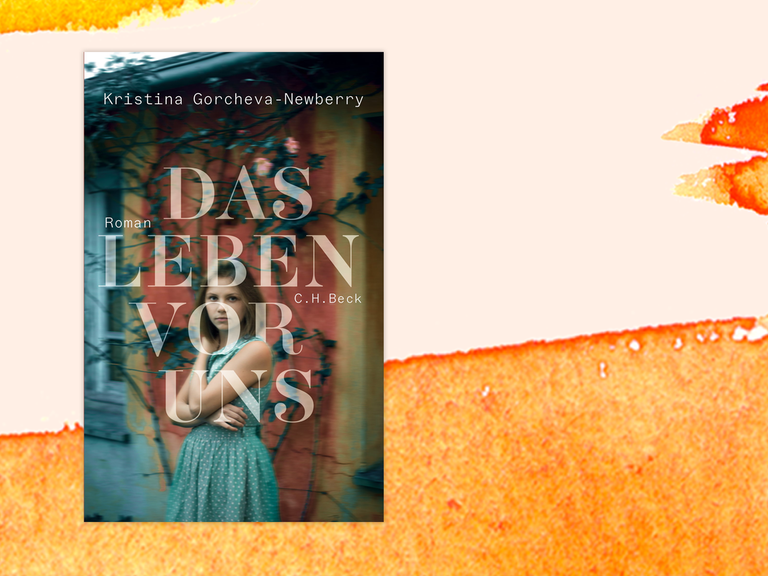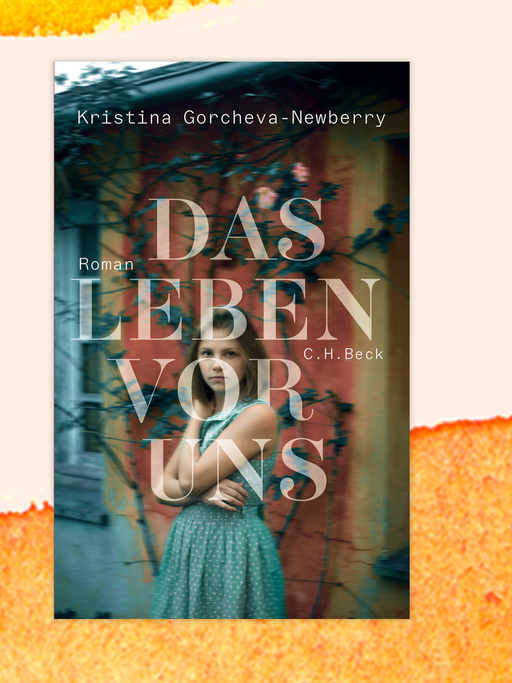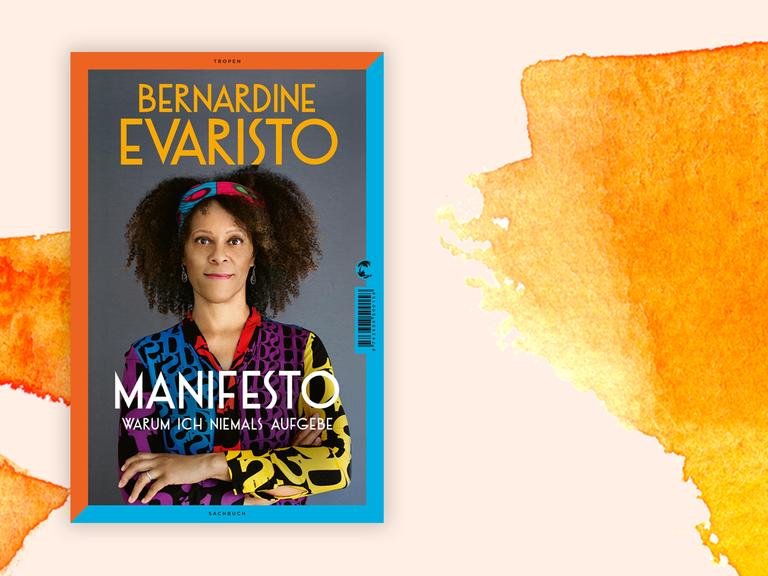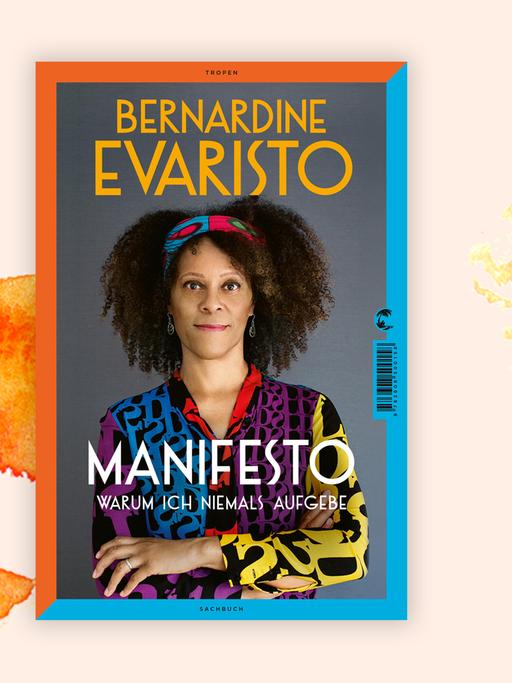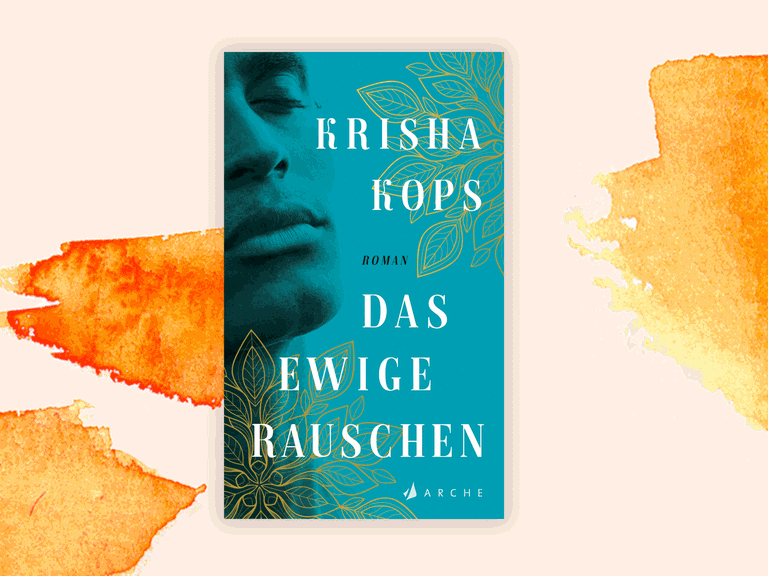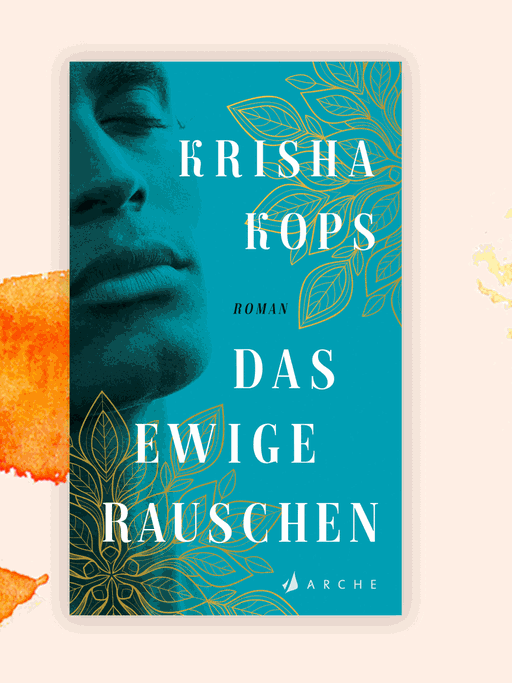Sigrid Nunez: "Eine Feder auf dem Atem Gottes"
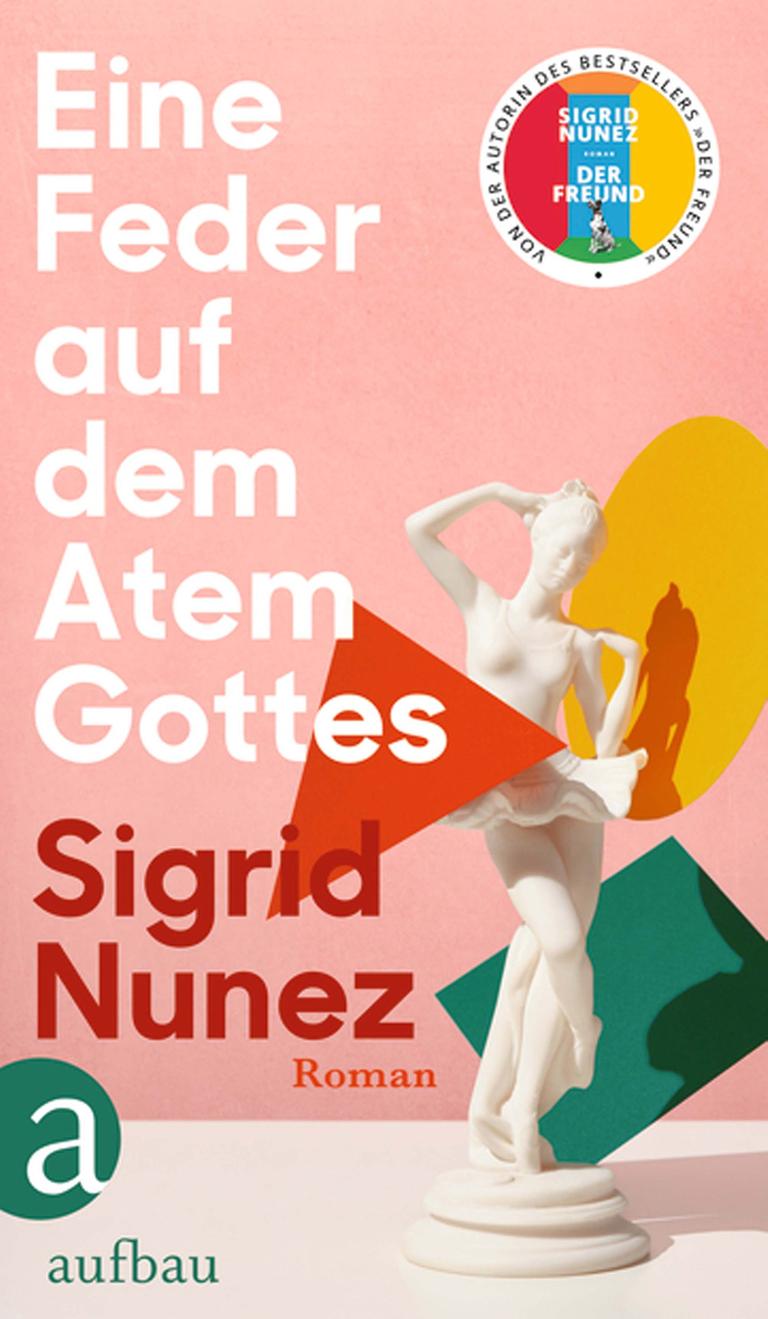
© Aufbauverlag
Aufwachsen in der Fremde der Eltern
07:18 Minuten
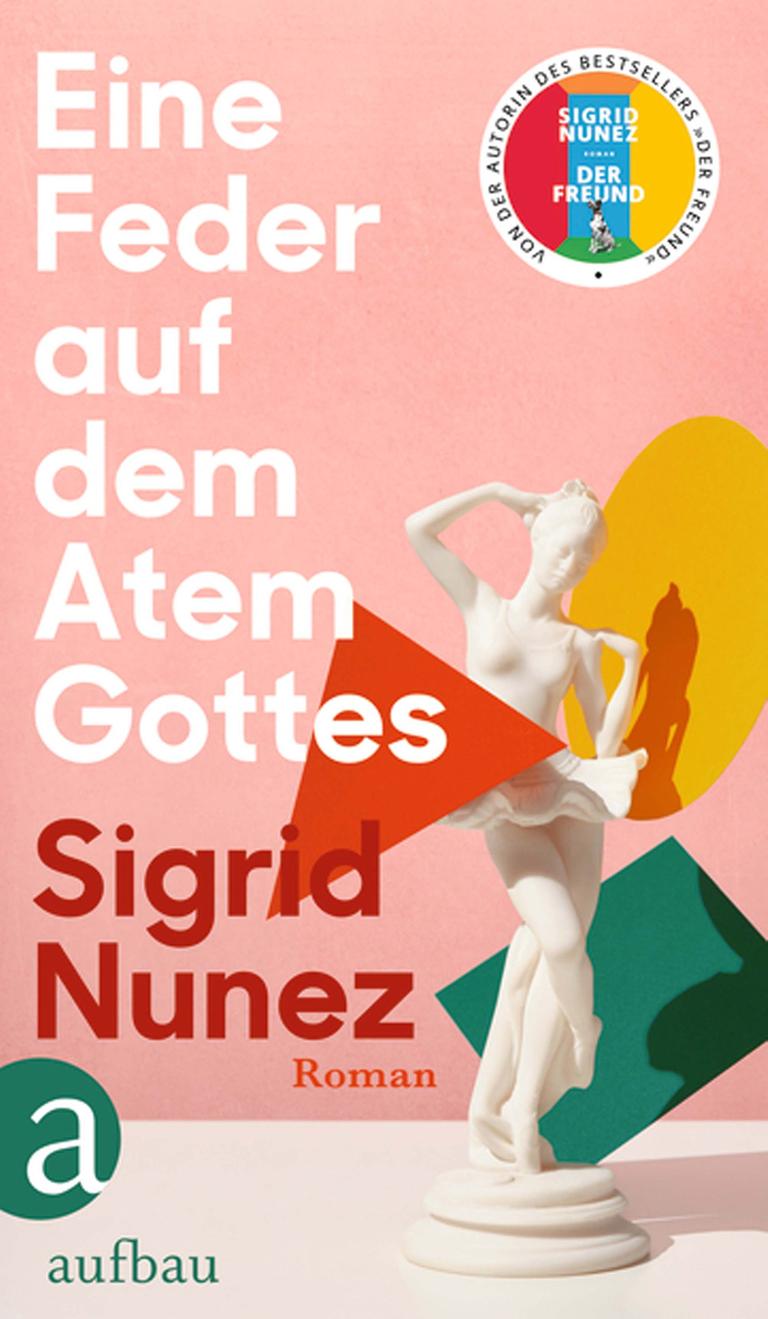
Sigrid Nunez
Übersetzt von Anette Grube
Eine Feder auf dem Atem GottesAufbau, Berlin 2022222 Seiten
22,00 Euro
Wie wird man, wer man ist? Prägt die unglückliche Ehe der Eltern das Leben? Und welche Rolle spielt deren Einwandererherkunft für eine junge aufstrebende Amerikanerin? Bestsellerautorin Sigrid Nunez begibt sich auf literarische Spurensuche.
Sigrid Nunez' Roman beginnt mit einer frühkindlichen Erinnerung. Die fünfköpfige Familie macht einen Strandspaziergang, als der Vater zwei Bekannte trifft. Er spricht mit ihnen chinesisch. Zum ersten Mal hören seine drei Töchter ihn in seiner Muttersprache reden. Unvergesslich ist dem Kind diese Szene, in der es ihm so vorkam, als würde der ewig schweigsame Vater singen.
"Ich hörte ihn erneut chinesisch sprechen, aber nur sehr selten. In chinesischen Restaurants, gelegentlich am Telefon, ein- oder zwei Mal im Schlaf und im Krankenhaus, als er im Sterben lag. – Es stimmte also. Er war tatsächlich Chinese. Bis zu jenem Tag hatte ich es nicht wirklich geglaubt."
Chinesischer Vater, deutsche Mutter
Der stets in sich gekehrte Vater war chinesisch-panamaischer Abstammung, die stets an Heimweh leidende Mutter stammte aus Schwaben: Zwischen den Eltern hatte es keine aufregende Liebesgeschichte gegeben. Es war eine aus der Not geborene Verbindung. Der Vater war als Soldat in Deutschland, die Mutter von ihm unvorsichtigerweise schwanger geworden.
Ein gemeinsames Leben in New York beginnt 1948: Kein Traum erfüllt sich für die lebenslustige deutsche Frau. Der Mann ist und bleibt ihr fremd. Er arbeitet unablässig und schafft es doch nicht, der rasch anwachsenden Familie mehr zu bieten als beengte Wohnungen in Sozialbausiedlungen.
Eltern bleibt die neue Heimat fremd
Sigrid Nunez entwirft Szenen dieses Lebens, das geprägt ist von Fremdheit und Kälte. Sie weiß nicht viel über den Vater: "Obwohl wir achtzehn Jahre lang im selben Haus lebten, hatten wir wenig gemeinsam. Wir hatten keine Kultur gemein. Und es ist nur leicht übertrieben zu behaupten, dass wir auch keine Sprache gemein hatten."
Fast sein ganzes Leben verbringt er in Amerika, aber Englisch lernt er nie richtig, er kann nicht wirklich mit seinen Töchtern sprechen oder sie verstehen. Die Tochter spekuliert: Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn er Söhne bekommen hätte? Die Mutter dagegen hatte zwar keine Mühe mit der fremden Sprache, fühlte sich aber um ein ihr zustehendes gutes Leben betrogen. Sie schaute mit entschiedener Verachtung auf die amerikanische Kultur.
Verbindung von Sprache und Schmerz
Die Autorin verließ früh das Elternhaus und blickt nun Jahrzehnte später zurück auf diese Welt, die sie geprägt hat, die ihren Ehrgeiz, ihre Liebe zum Ballett, ihre Bildungsgeschichte bestimmt hat – und nicht zuletzt ihr gestörtes Verhältnis zu Männern. Erst jetzt begreift sie wirklich, was es für Eltern bedeutet, wenn ihre Kinder eine andere Sprache sprechen und was es mit den Kindern von Immigranten macht, die keine Wurzeln haben in ihrer Heimat und was Sprache und Liebe und Schmerz miteinander zu tun haben.
In einem anderen, ihrem Erinnerungsbuch über Susan Sontag beschreibt Sigrid Nunez, wie beide im Kino „Die Reise nach Tokyo“ des japanischen Regisseurs Yasujiro Ozu sehen, in dem es einen – Susan Sontag tief berührenden – Dialog gibt: . "Ist das Leben nicht enttäuschend? Ja, das ist es.“ Das könnte auch das Motto dieses gefühlsklugen und detailreichen Erinnerungsbuchs sein.