Ian Morris: Krieg. Wozu er gut ist
Campus Verlag, Frankfurt-New York 2013
450 Seiten, 26,99 Euro
"Dann wäre Armageddon nicht mehr weit"
Eine verwegene These stellt der Alt-Historiker Ian Morris auf: der Krieg habe die Welt sicherer und reicher gemacht. Er stützt sich dabei auf statistische Schätzungen und kommt aufgrund von Klimawandel und anderen Herausforderungen zum Schluss: Es wird wohl so weiter gehen.
Für Ian Morris, Jahrgang 1960, war Springsteens Hit "War" die Hymne seiner Studentenzeit. Jetzt, Jahrzehnte später, schickt er sich an, die populäre These vom sinnlosen Krieg zu widerlegen: Doch, das Kämpfen und Töten habe – historisch betrachtet – seine Funktion. Erst der Krieg nämlich, so der britische Archäologe und Alt-Historiker, der an der kalifornischen Stanford University lehrt, erst der Krieg machte es notwendig und damit möglich, dass die in vorzeitlichen Horden lebenden Menschen sich zu Zivilisationen zusammen schlossen:
"Ich habe gelernt, dass die Beweise aus der Geschichte (sowie aus Archäologie und Anthropologie) unzweideutig sind: 10.000 Jahre Krieg haben größere Gemeinschaften höherer Ordnung geschaffen, die das Risiko, eines gewaltsamen Todes zu sterben, gemindert haben. So unbequem diese Tatsache ist, auf lange Sicht hat der Krieg die Welt sicherer und reicher gemacht."
Das ist, zunächst einmal, eine verwegene These. Doch gestützt wird sie durch die Befunde der Forschung, der zufolge sich nur durch die Addition fortlaufender Unterwerfungen und die Koordination von Macht überall auf dem Globus blühende Reiche entwickeln konnten.
"Auf ihrem Höhepunkt umfassten die größten dieser Reiche – das Römische im Westen, der Han-Staat auf dem Gebiet des heutigen China und das Maurya-Reich auf dem indischen Subkontinent – jeweils etwa vier bis fünf Millionen Quadratkilometer mit zwischen 30 und 60 Millionen Bewohnern, und alle machten aus ihren Schwertern Pflugscharen (na, jedenfalls größtenteils). In jedem dieser Reiche ging die durch Gewalttaten bedingte Sterblichkeit jäh zurück, und die Menschen wussten ihre Pflugscharen so gut einzusetzen, dass es zu einem goldenen Zeitalter relativen Friedens und Wohlstands kam."
Das ganze Buch ist abgefasst in diesem Ton einer gut gelaunten Reise durch die Kriegsgeschichte, und die statistischen Schätzungen zur Sterblichkeit sind für Morris dabei ein Zahlenspiel, dessen suggestive Kraft ihn erkennbar beeindruckt. Es geht so: In einem Jahrhundert wie dem vergangenen, dem 20., in dem insgesamt rund zehn Milliarden Menschen geboren oder gestorben sind, gab es zwischen hundert und zweihundert Millionen Opfer von Krieg und organisierter Gewalt. Der Tod durch fremde Hand hatte also eine Wahrscheinlichkeit von, sehr grob geschätzt, einem bis zwei Prozent. In den lose gefügten Gruppen und Verbänden der Steinzeit dagegen, so fasst Morris die Ergebnisse der archäologischen Forschung lapidar zusammen, kam noch jeder Fünfte durch Streitaxt oder Lanze ums Leben. Zwanzig Prozent. Wenn das nicht ein gewaltiger Fortschritt der Zivilisation ist …
Für die moderne Friedensbewegung sind solche Rechenspiele schiere Provokation. Die Übersetzer arbeiteten noch an der deutschen Ausgabe des Buches, da unterstellte etwa die AG Friedensforschung an der Universität Kassel dem Autor eine hinterhältige, nämlich insgeheim kriegstreiberische Absicht, die beängstigend gut in den moralischen Trend der Zeit passe.
"Morris argumentiert sozialdarwinistisch: Der Mensch ist ein Gewalttier. Auch das unvermeidliche Kapitel über Affen fehlt nicht."
Krieg sei der Vater aller Dinge, hatte der griechische Philosoph Heraklit im fünften Jahrhundert vor Christus gesagt – und wird damit bis heute missverstanden. Denn es ging Heraklit gar nicht um kämpfende Heere und Schwerter schwingende Reiter. Es ging um die allgegenwärtige Spannung zwischen Tag und Nacht, Hunger und Sättigung, Angst und Zufriedenheit, eine Spannung, aus der jede Entwicklung ihre Energie bezieht. Sollte Morris nun einer sein, der den vorsokratischen Philosophen immer noch falsch auslegt? Der also nach 15.000 Jahren Zivilisation zu der deprimierenden Erkenntnis gelangt, dass der Mensch seit seinen Tagen als wilder Affe nicht wesentlich dazugelernt hat?
Der Pax Americana werde eine Pax Technologica folgen
Es empfiehlt sich, bei der Lektüre des Buches hin und wieder zu dessen Ende zu blättern. Dahin nämlich, wo auf die ununterbrochene Kette organisierter Fehden zwischen Stämmen, Glaubensgemeinschaften oder Nationen der Ausblick folgt: Wie wird es weiter gehen? Sind wir nach einem Jahrhundert mit zwei Welt- und ungezählten Regionalkriegen, mit vielfach organisiertem Genozid und mutwillig herbeigeführter Not, Hunger und Krankheit, nun endlich klüger geworden?
Nein, sagt Ian Morris: Es wird wohl weiter gehen.
"Der Klimawandel wird Millionen Klimaflüchtlinge in Bewegung setzen und für zunehmende Spannungen sorgen, die Infrastruktur- und Energieanforderungen eines Lebens mit vernetzten Maschinen bieten womöglich völlig neue Angriffsziele. Eine Nation, die meint, in Bezug auf den technologischen Wandel vorübergehend die Nase vorn zu haben, mag vielleicht der Versuchung erliegen, sich diesen Vorsprung zunutze zu machen, um jeder anderen ihren Willen aufzuzwingen oder, wahrscheinlicher noch, ein Staat, der zurückfällt, geht womöglich bankrott und setzt alles, was er hat, auf Angriff, bevor der Vorsprung des Feindes uneinholbar geworden ist. – Dann wäre Armageddon nicht mehr weit."
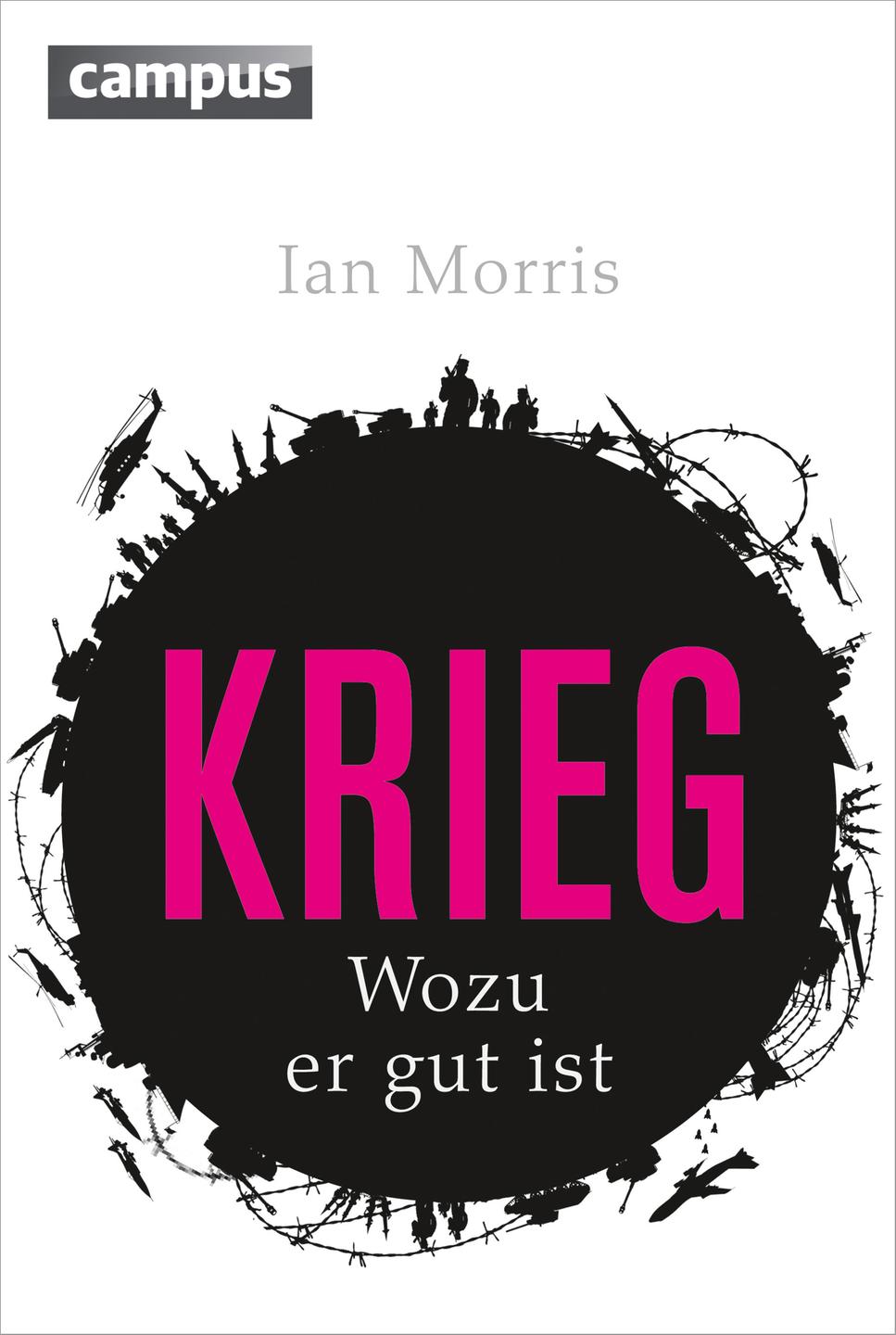
Lesart-Cover: Ian Morris "Krieg. Wozu er gut ist"© Campus Verlag
Doch dieser Autor ist keiner, der seine Leser mit einem so resignativen Schluss aus seinem Entwurf entlässt. So wie früher Stammesfürsten und Könige aufstiegen, die Macht in Kriegen auf sich konzentrierten und sie in neuerlichen Kriegen an andere weitergaben, so beherrschten – laut Morris – in der Neuzeit "Globocops", Weltpolizisten, das Schicksal nicht mehr auf regionalem, sondern globalem Terrain. Im 19. Jahrhundert war das British Empire solch ein Globocop, heute sind es die USA. Auch deren Macht werde vergehen, sagt der Historiker voraus, doch dem von Amerika kontrollierten Frieden, der Pax Americana mit all ihren Widersprüchen und blinden Flecken, werde eine Pax Technologica folgen, ein Frieden der dann wirklich alles kontrollierenden und bewahrenden Netzwerke. Und das soll ein tröstlicherer Ausblick sein?
Kein Problem. Es gibt da eine Passage in dem Buch, in der sich der Wissenschaftler in seiner jovialen Art zur Möglichkeit des fröhlichen Irrtums bekennt. "Ein Forscher äußert eine Hypothese", sagt er da, "ein anderer kommt des Wegs, verwirft sie und setzt eine neue in die Welt. So funktioniert Wissenschaft nun mal." Und bitte sehr, räumt Ian Morris ein, ein bisschen leichtfertig - bitte, dann habe er sich eben geirrt.


