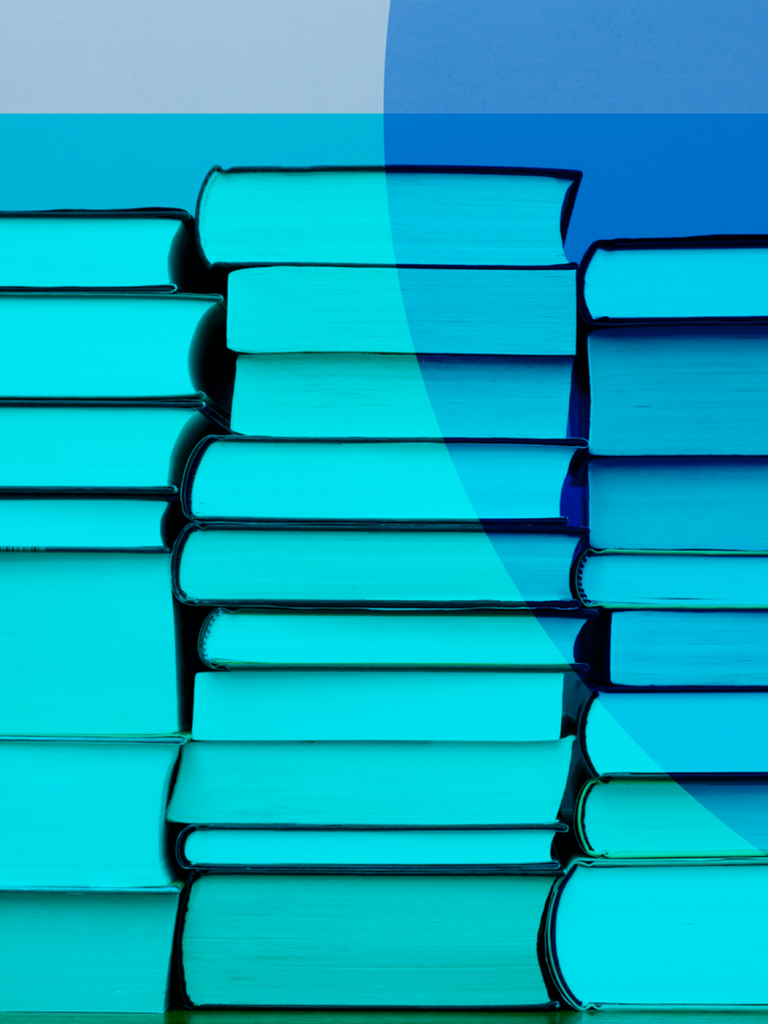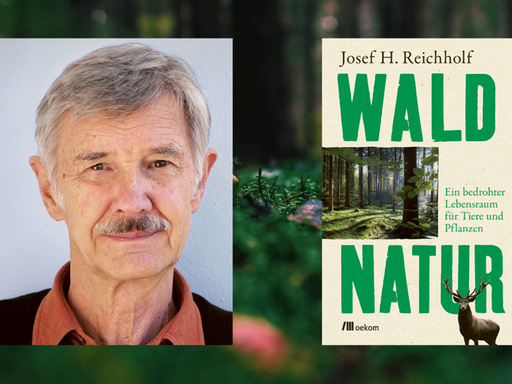Josef Reichholf: "Mensch"

© Hanser Verlag
Vom aufrechten Gang zur Gegenwart
05:27 Minuten

Josef H. Reichholf
Mensch. Evolution einer besonderen SpeziesHanser Verlag, München 2025352 Seiten
27,00 Euro
Wer die Zukunft gestalten will, sollte in die Vergangenheit blicken. Davon ist Josef Reichholf überzeugt. In seinem neuen Buch versucht der Biologe aufzuzeigen, wie die Natur des Menschen noch immer Gesellschaft und Politik beeinflusst.
„Mensch. Evolution einer besonderen Spezies“ ist in drei Abschnitte unterteilt. Im ersten geht es um den aufrechten Gang und den damit einhergehenden Veränderungen. Der Gang eröffnete zwar eine neue ökologische Nische für den Homo sapiens, allerdings wurde durch diese Fortbewegungsart der Geburtskanal bei Frauen enger, was zur Folge hatte, dass Geburten früher und gefährlicher wurden.
Die lange Abhängigkeit von der Mutter und anderen Gruppenmitgliedern ermöglichte wiederum auf lange Sicht eine ganz neue Art von Verstand, schreibt Josef Reichholf. Entscheidende Impulse setzen geographischen Gegebenheiten und Klimaschwankungen, die den Weg hinaus aus Afrika ebneten.
Alles nicht neu, wohl auch deswegen erzählt Josef Reichholf dieses Kapitel überzeugend und gut verständlich. Allerdings verzichtet er fast völlig auf Zitate und Belege. Das zeigt: Hier legt der Biologe eine Art Alterswerk vor, er referiert auf sich selbst und wagt eine Art essayistischen Zwischenruf zur aktuellen Politik.
Im zweiten Abschnitt des 350 Seiten dicken Buches zeigt Reichholf, wie diese biologische Basis die Verhaltensweisen prägte. Es geht um die Rolle von Mann und Frau, um Sprache, um Besitz. Vieles ist plausibel, etwa wenn es um die ständige Migration unterschiedlicher Gruppen geht.
Von Migration bis zu Konflikten mit der Schwiegermutter
„Fremd zu sein war und ist genetisch der Normalfall“, heißt es dazu, „akzeptiert wird das dennoch äußerst ungern“. Der Drang zur Abgrenzung von anderen zeige sich auch in der Vielfalt der Sprachen, die Verständigung nur innerhalb der eigenen Gruppe ermöglichen, schreibt Reichholf.
Anderes kann (und sollte) man hinterfragen: Braucht es wirklich komplexe Überlegungen zur Fruchtbarkeit, um Konflikte zwischen Frau und Schwiegermutter zu erklären? Denn auch dem widmet sich der Biologe.
An einigen Stellen blendet er andere Forschung ganz aus. Angeblich bestimme „Ungleichheit das Leben der Menschen“, seit sie in großen Gruppen zusammenwohnen. Dabei gab vor 5000 Jahren zum Beispiel im Karpatenbecken auch Städte mit mehreren Tausend Einwohnern ohne deutliche soziale Schichtung. Ungleichheit entsteht also nicht zwangsläufig.
Im dritten Teil wird aus dem Sachbuch schließlich ein engagierter Essay über die Zukunftsaussichten unserer Spezies. Angesichts von Klimawandel, Bevölkerungswachstum und Kriegen sind die eher düster, glaubt Reichholf: „Das Uralte, den Menschen Innewohnende ist viel zu stark. Es strebt nach Individualisierung, nach höherem Status und größerem Erfolg.“ Das Gemeinwohl käme immer erst an zweiter Stelle.
Das ist als Diagnose durchaus überzeugend, aber Reichholf kann keine echte Therapie anbieten. So bleibt er bei einem vagen Appell, die Wirtschaft nicht auf den Welthandel auszurichten, sondern auf die Bedürfnisse der jeweiligen Landesbevölkerung.
Das dürften nicht alle Lesenden zufriedenstellen, die von Reichholf anderes gewöhnt sind, seine nachforschende, inspirierenden Art schätzen. Insofern bietet dieses Buch ein paar neue Interpretationslinien und hilft auch zu verstehen, warum es etwa beim Klimagipfel in Brasilien so schwer war, das Notwendige umzusetzen. Ein überraschend neues Werk ist es aber nicht.