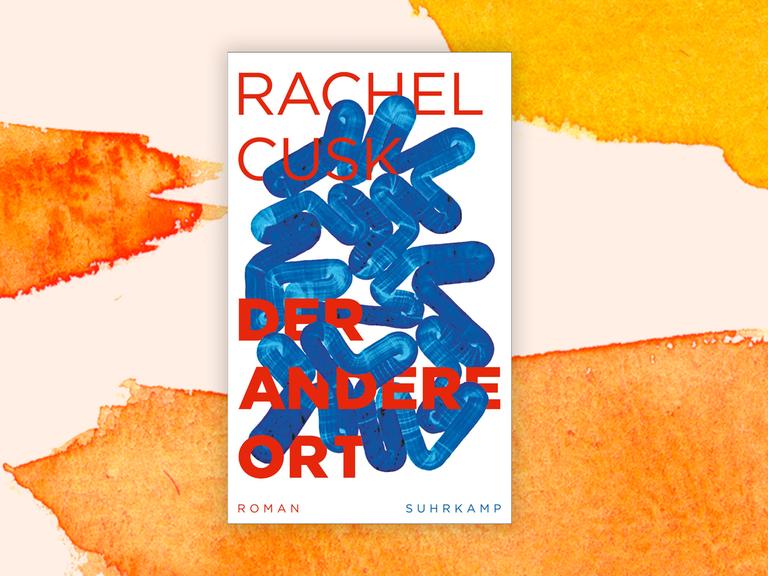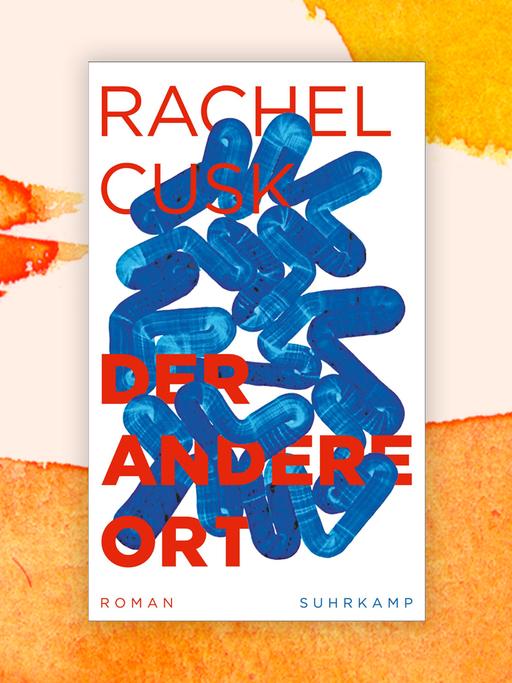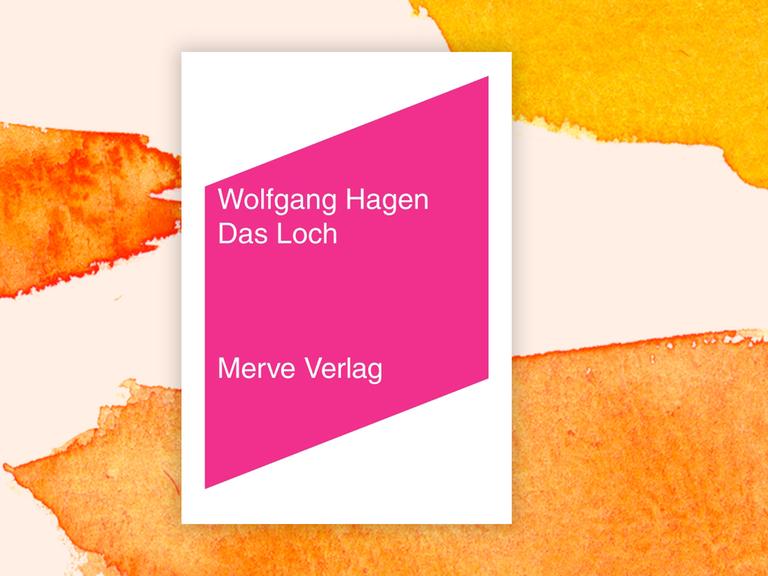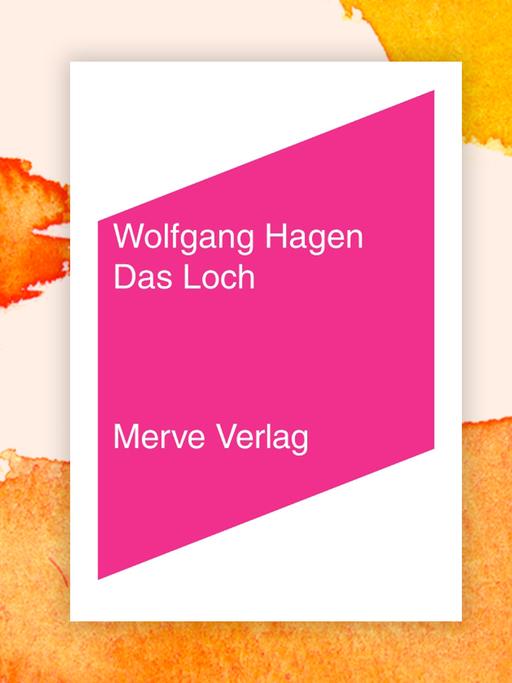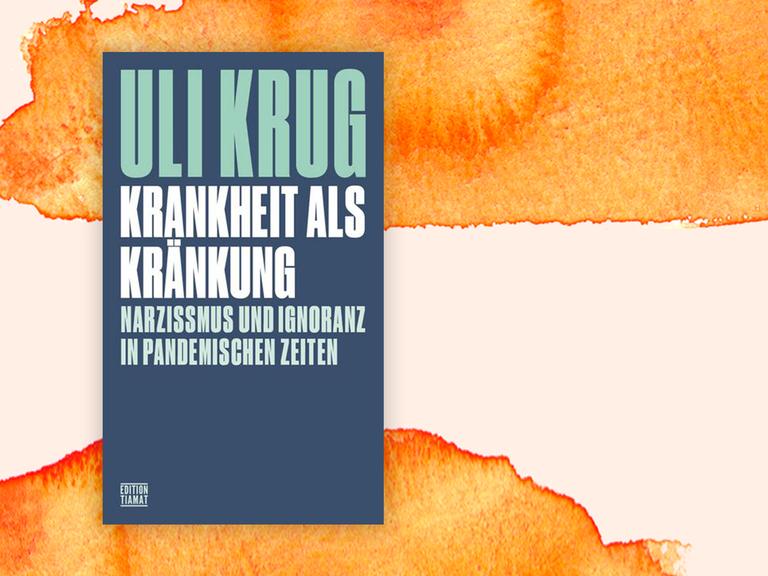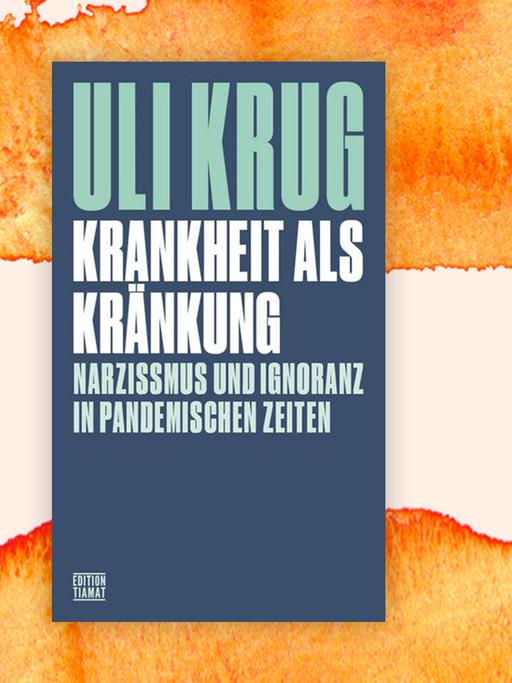Rachel Cusk: "Coventry"
Überall Geschichten vom Krieg
05:26 Minuten
Rachel Cusk
Übersetzt von Eva Bonné
CoventrySuhrkamp, Berlin 2022163 Seiten
21,00 Euro
Sie stellt kleine Fragen zu alltäglichen Verrichtungen und gelangt damit doch zu den großen, verräterischen Erzählungen unserer Gegenwart. Rachel Cusk denkt über Autofahren und Autonomie, über Erziehung und Gewalt nach.
2001 debütierte die in Kanada geborene, heute in Paris ansässige Autorin Rachel Cusk mit einem Essayband über die Mühen des Kinderkriegens und des Mutterwerdens. Der Band machte sie auf einen Schlag berühmt – und brachte ihr zugleich manch feindliche Stimmen ein, auch und vor allem unter Leserinnen. Denn schon damals stellte Cusk unkonventionelle Fragen rund um die Bedingungen weiblicher Existenz. Das tut sie bis heute – mit gleichbleibender Schärfe und Schonungslosigkeit, auch sich selbst gegenüber.
Autofahren als Metapher
Neuester Beweis für die Brillanz ihres essayistischen Schaffens ist der nun von Eva Bonné gewohnt souverän ins Deutsche übertragene Band „Coventry“. Das Original ist 2019 erschienen, die deutsche Fassung allerdings verschlankt: Kleinere versprengte Texte wie etwa Rezensionen von Cusk wurden weggelassen. Übrig geblieben sind sechs Essays – und die haben es in sich, da Cusk darin Themen angeht, die uns alle betreffen.
Schon der Auftaktessay „Autofahren als Metapher“ zeigt ihre Begabung, mühelos zwischen Phänomenen der äußeren und der inneren Welt zu navigieren und dabei Fragen nach dem großen Ganzen zu eröffnen: Mit trockenem Humor studiert sie, wie ihr Wunsch nach Autonomie und dem freien Willen – verkörpert durch das Auto als Erweiterung des Selbst – mit den Regeln des öffentlichen Raums und damit des Kollektivs erst kollidiert, dann regrediert.
Krieg auf der Überholspur
Längst ist, so Cusk, die Überholspur Austragungsort von Machtspielen und Krieg: Krieg zwischen denen, die Regeln übertreten, und denen, die deren Einhaltung betont zur Schau stellen.
Das Narrativ des Kriegs prägt auch den titelgebenden Essay „Coventry“. Jemanden nach Coventry schicken, bedeutet in englischer Sprache, jemanden zum Teufel schicken – allerdings auf kleiner und umso grausamerer Flamme. Cusk hörte diesen Satz ihr Leben lang von ihren Eltern. Und fragt sich: Ist es Zufall, dass eine Kriegsgeneration das eigene Kind mit dem Narrativ von Krieg großzieht?
Verräterische Narrative
In all ihren Texten, auch in diesen Essays, geht Cusk dabei von der grundsätzlichen Überlegung aus: Wie lässt sich das, was geschieht, als Narrativ, sprich als tieferliegende Erzählung von unserem Zusammenleben deuten? Was sagt dieses Narrativ – und sei es die Einrichtung eines Hauses – über uns und die Welt, in der wir leben?
Und was geschieht, wenn dieses Narrativ plötzlich umgeschrieben und neu gedeutet wird: Wenn etwa wie im Essay „Löwen an der Leine“ die eigenen Kinder zu aufsässigen Teenies mutieren und nichts mehr gilt, was deren Mutter, sprich Cusk selbst, selbstverständlich schien? Und was, wenn das Aussprechen der Wahrheit als Akt der Unhöflichkeit gebrandmarkt wird?
Unnachgiebige Fragen statt Antworten
Ebendiese Art, unnachgiebig Fragen zu stellen, statt Antworten zu liefern, ist die große Kunst von Rachel Cusk. Auch die Essays in „Coventry“ tragen – selbst da, wo Cusk auf Politisches wie den Brexit oder Fake News anspielt – nie ihr Thema lautstark vor sich her. Und lenken doch unseren Blick unbarmherzig auf jene unbequemen Gefilde des Ambivalenten, in dem sich stets das Allzumenschliche abspielt.