Diskussion um Schuldenbremse verschieben
06:07 Minuten
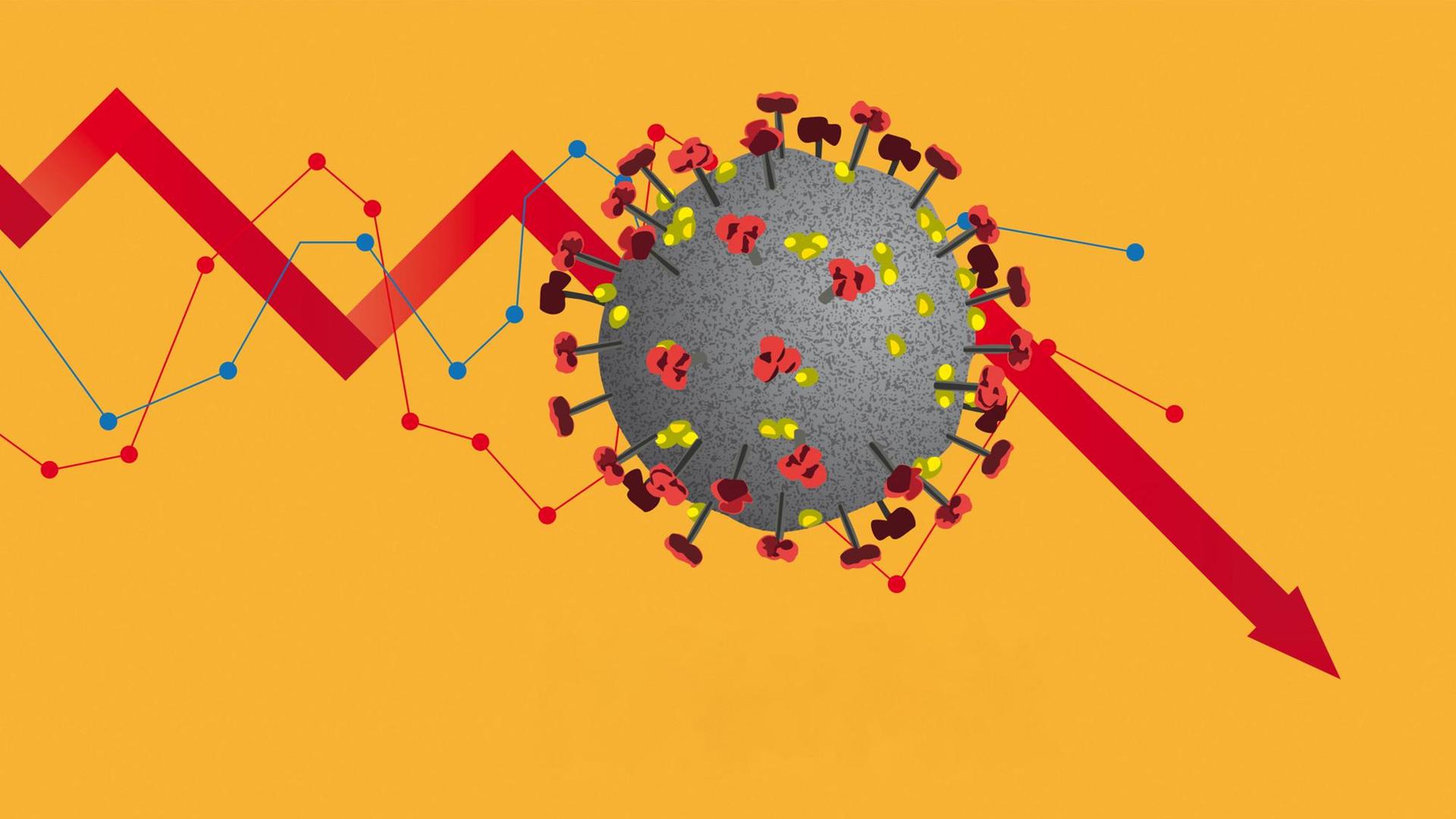
Die Neuverschuldung in 2021 steigt auf 370 Milliarden Euro. Die Alternativen wären noch schlimmer, sagt die Volkswirtschaftlerin Veronika Grimm. Man dürfe jetzt aber nicht nur neue Schulden machen, sondern müsse auch wichtige Reformen angehen.
Ute Welty: Für 2021 ist aufgrund von Corona ein Nachtragshaushalt fällig, den der Finanzminister heute ins Kabinett eingebracht hat. Olaf Scholz erläutert außerdem die Planung bis 2025, wo das Virus ebenfalls Spuren hinterlassen wird. Darüber preche ich jetzt mit Veronika Grimm. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg ist eine der fünf Wirtschaftsweisen.
Welty: Der Nachtragshaushalt bedeutet 370 Milliarden Euro neue Schulden in nur einem Jahr. Ist das in Zeiten von Negativzinsen wirklich schlimm?
Grimm: Ob das schlimm ist, muss man auch daran messen, was die Alternative wäre. Ohne die staatlichen Hilfszahlungen hätten wir mehr Arbeitslose, mehr insolvente Unternehmen, und die Wirtschaft müsste sich nach der Coronakrise komplett neu aufbauen. Vor dem Hintergrund ist natürlich klar, wir müssen erst mal Schulden aufnehmen, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. Allerdings sollte man daraus nicht schließen, dass das in Zeiten von Negativzinsen eine gute Sache ist. Wir müssen schon auch maßvoll mit dem Geld umgehen.
Schuldenquote nicht beliebig ausreizen
Welty: Deutschland steuert auf eine Schuldenquote von 75 Prozent zu, Japan liegt bereits bei mehr als 200 Prozent. Lässt sich daraus ableiten, dass Deutschland noch einen riesigen finanziellen Spielraum hat?
Grimm: Es gibt kein klar definiertes Limit bei der Schuldenstandsquote. Sie ist von knapp 60 Prozent im Jahr 2019 auf über 70 Prozent im Jahr 2020 gestiegen, und es kann sein, dass sie aufgrund der aktuellen Planungen noch leicht anwächst. Nach der Finanzkrise hatten wir eine Schuldenstandsquote von 80 Prozent und sind davon wieder heruntergekommen, weil wir da rausgewachsen und die Schuldenstandsquote sich durch solide Haushaltsführung und gute Steuereinnahmen Stück für Stück reduziert hat. Trotzdem ist es nicht zu empfehlen, das beliebig weit auszureizen. Das ist schon eine gute Sache, wenn die Schuldenstandsquote nicht so hoch ist.
Welty: Müssen heute gemachte Schulden tatsächlich von nachfolgenden Generationen zurückgezahlt werden, oder lässt sich durch mehr Schulden auch als Staat mehr Geld verdienen?
Grimm: Das kommt drauf an. Das hängt einerseits von der Tragfähigkeit der Staatsfinanzen ab und andererseits von der Frage, ob die Gläubiger an die Zahlungsfähigkeit eines Staates glauben. Darauf kommt es an - dass die Gläubiger daran glauben, dass ein Staat seine Schulden zurückzahlen kann, und das hängt natürlich auch an der Schuldenlast. Aktuell ist das Zinsumfeld gut, die Zinsen sind niedrig, aber das muss nicht so bleiben. Insofern ist es auch wirklich wichtig, die Schuldenstandsquote nicht zu hoch zu treiben.
Darüber hinaus muss man berücksichtigen, dass der Umgang mit Schulden in Deutschland auch Rückkopplungseffekte auf andere europäische Staaten haben kann, und im europäischen Umfeld sind nicht alle Staaten so gut aufgestellt wie in Deutschland. Insofern müssen wir auch vorsichtig sein. Wir können nicht später von anderen erwarten, dass man konsolidieren, dass sie Haushaltsdisziplin zeigen, aber Deutschland setzt auf Schulden nach der Corona-Krise. Das würde für die europäische Stabilität wahrscheinlich doch sehr problematisch werden.
Grundsatz-Diskussion um Schuldenbremse besser verschieben
Welty: Die mediale Aufregung ist immer groß in diesem Zusammenhang. Wie blicken Sie darauf?
Grimm: Die Aufregung ist natürlich groß, und das ist ein Thema, das heiß diskutiert wird. Ich glaube aber, wir sollten die prinzipielle Diskussion um die Schuldenbremse auf die Zeit nach der Coronakrise verschieben. Aktuell sind wir ganz gut in der Lage, durch die Ausnahmeregelung, die ja fiskalische Spielräume aktuell eröffnet, zu agieren – die müssen wir in Anspruch nehmen.
Die Schuldenbremse ist aktuell ausgesetzt, das wird für 2021 und vermutlich auch für 2022 noch mal notwendig sein. Aber das zeigt auch, dass das Instrument funktioniert. In Zeiten, in denen es gut läuft, halten wir Haushaltsdisziplin, in Zeiten, in denen es schlecht läuft, in Krisenzeiten, haben wir die Möglichkeit, davon auch abzusehen. Ich glaube, das ist in der jetzigen Zeit gut. Diskussionen, ob das zur Disposition gestellt werden muss, sollte man später führen und nicht in dieser Ausnahmesituation.
Zur Stabilisierung braucht es auch wichtige Reformen
Welty: Nach der Finanzkrise hat die Bundesregierung Neuverschuldung, Defizit und Schuldenquote schnell und konsequent runtergefahren. Kann das noch ein zweites Mal gelingen? Die Voraussetzungen sind doch ungleich schwieriger, oder?
Grimm: Die Hoffnung wäre natürlich, dass genau das gelingt, und das bedeutet auch, dass wir uns für die Zukunft gut aufstellen müssen. Dass wir jetzt nicht nur Schulden machen, sondern auch wichtige Reformen angehen müssen, und da steht eine ganze Menge im Schaufenster: Zum einen ist die Frage, wie stellen wir uns so auf, dass klimaneutrale Geschäftsmodelle, mit denen man auch wachsen kann, in der Wirtschaft, attraktiver werden. Da wäre eine Energiepreisreform angebracht.
Auch eine Verbesserung des Rentensystems ist aufgrund der Demografie dringend geboten. Und es gibt umfangreiche Zukunftsprogramme, mit denen wir in die Infrastruktur der Zukunft investieren können – im Energiesektor, bei der Digitalisierung und im Bildungs- und Gesundheitswesen. Wenn wir uns da gut aufstellen, dann ist es schon möglich, aus der Krise herauszuwachsen. Von Steuererhöhungen sollte man erst mal absehen, um das Wirtschaftswachstum nicht auszubremsen.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.






