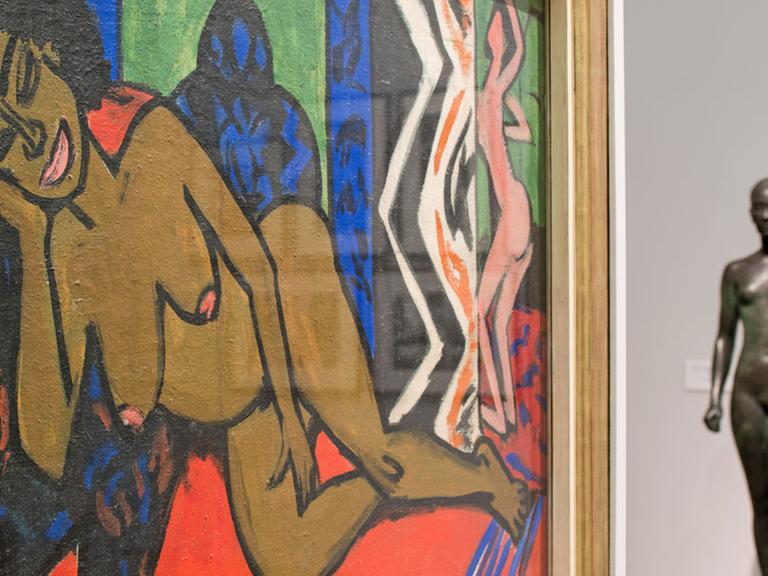Rassismus und Rasse - ein Schwerpunkt im Deutschlandfunk Kultur:
Wie geht das zusammen – wie sehr bedingt oder befördert die Einteilung der Menschen in unterschiedliche "Rassen" den Rassismus? Anlässlich der ab 19. Mai gezeigten Ausstellung "Rassismus – Die Erfindung von Menschenrassen" im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden setzen wir dazu einen thematischen Schwerpunkt im Deutschlandfunk Kultur.
Die "Lesart" war zu Besuch bei Eso Wan Books in Los Angeles, einer Buchhandlung, die auf afroamerikanische Literatur, Poesie und Geschichte spezialisiert ist. Der Journalist Mohamed Amjahid war zu Gast bei "Im Gespräch" und sprach über seine kleinen Tricks gegen Rassismus. Mit der Wissenschaftshistorikerin Veronika Lipphardt haben wir über genetische Vielfalt und das von ihr kritisierte Ordnungssystem "Rasse" gesprochen.
Hören Sie zum Thema auch das Interview mit
Marius Jung
, Autor des Buchs "Singen können sie alle - Handbuch für Negerfreunde" in "Studio 9 am Nachmittag" ab 17.05 Uhr und unser Feature über die Entstehung des Rassegedankens in der Sendung "Zeitfragen" am heutigen Mittwoch ab 19.30 Uhr.
"Eine schwarze Mutter darf nicht Selbstmord begehen"

Es sind die Mütter, die das brüchige Leben in den schwarzen Familien und Communitys zusammenhalten: Diese prägende Erfahrung komme in vielen Essays oder Romanen jüngerer US-Autorinnen zur Sprache, sagt die Literaturkritikerin Bernadette Conrad. So etwa in Brit Bennetts Roman "The Mothers".
Frank Meyer: In dieser Woche geht es hier im Deutschlandfunk Kultur immer wieder um Rassismus und den Kampf gegen Rassismus. Wir wollen uns hier in der "Lesart" jetzt Bücher anschauen, die auch mit diesem Thema zu tun haben. In diesem Frühjahr sind bei uns auffallend viele Bücher von schwarzen Autorinnen aus den USA erschienen. Welche Fragen in diesen Büchern gestellt werden und wie sich der literarische Blick auf die eigene schwarze Wirklichkeit verändert hat in den letzten Jahren, das hat sich meine Kollegin Bernadette Conrad angesehen. Sie ist jetzt hier bei uns im Studio. Guten Tag, Frau Conrad!
Bernadette Conrad: Guten Tag!
Meyer: Die Polizeigewalt gegen Schwarze, die Proteste dagegen, die Black-Lives-Matter-Bewegung, all das hat ja das Thema Rassismus in den USA wieder sehr bewusst gemacht. Kann man sagen, dass das jetzt auf dem Buchmarkt durchschlägt, dass solche Themen, solche Bewegungen auch in den Büchern auftauchen?
Conrad: Ja, das ist auf jeden Fall so. Erinnern wir uns, Februar 2012, das könnte man vielleicht als Anfangspunkt markieren. Der 17-jährige Trayvon Martin in Florida, der von einem Kiosk zurücklief, von einem Weißen, der sich in Nachbarschaftswehr engagiert hatte, erschossen wurde. Als im Sommer 2013 dann klar war, dieser Weiße wird nicht angeklagt, da war das so eine Art Startschuss. Da begann auch diese Black-Lives-Matter-Bewegung. Und eine dieser Gründerinnen, Patrisse Khan-Cullors, die hat das in einem Buch, das mich jetzt sehr beeindruckt hat, ganz bewegend erzählt. Sie selbst kommt aus einem eher armen Viertel in L.A., alleinerziehend, eines von vielen Kindern. Und sie war neun, als sie das erste Mal gesehen hat, wie ihre Brüder, elf- und dreizehnjährig, an die Wand gestellt wurden, abgetastet, grob, Taschen durchsucht, Handschellen angelegt. Auch sie hat das als Zwölfjährige erlebt, dass ihr Handschellen angelegt wurden in der Schule, weil sie wie die weißen Mitschülerinnen Gras geraucht hatte. Dieser Automatismus der Kriminalisierung, der auch vor Kindern nicht Halt macht, das ist etwas, was ich auch ein Stück weit neu gelernt habe aus diesem Buch. Und ich meine, wir haben es mit einer Autorin zu tun, die 1984 geboren ist. Das heißt, wir sind wirklich im Hier und Jetzt. Sie hat einen Bruder auch, diese Patrisse Khan-Cullors, der war psychisch labil. Als der aus dem Gefängnis zurückkam, hat er Wasser aus dem Klo getrunken – bis irgendwann klar war, er wird wohl Foltererfahrungen gemacht haben. Das ist der Hintergrund. Sie sagt, diese Polizei in diesem Land, die fühlt sich im Krieg gegen Schwarze. Und das ist etwas, was wir tagtäglich erleben.
Meyer: Das klingt sehr schockierend, was Sie da erzählen, und auch, als ob man nicht in der Gegenwart wäre, sondern in einer ganz anderen Zeit, wenn da von Folter die Rede ist gegenüber schwarzen Häftlingen. Als wäre man in den 60er-Jahren in den USA.
"... wenn wir am Ende doch erschossen werden"
Conrad: Ja, tatsächlich schreibt Kahn-Cullors das auch genau so. Ist das jetzt 2012 oder ist das 1955? Und ihr Schluss ist auch klar: Es sind immer noch Hautfarbe und Klasse, die entscheiden, wie menschenwürdig, aber vor allem auch, wie sicher mal als Amerikaner, Amerikanerin leben kann. Spannend in diesem Zusammenhang ist auch ein Essay von einer noch jüngeren Autorin, Brit Bennett. Sie ist zwar auch im Süden Kaliforniens groß geworden, aber gehört eher zur schwarzen Mittelschicht und hat 2014 einen Essay geschrieben unter dem Titel "I Don't Know What to Do With Good White People". Dieser Essay wurde in ein paar Tagen drei Millionen Mal gelesen. Und darin schreibt sie, sie hätte eigentlich ihr ganzes Leben eher Erfahrungen mit guten weißen Menschen gemacht, guten Weißen, die sich auch sehr im Vollbesitz ihres Gutseins fühlen. Aber dennoch gibt es so Beispiele wie, sie steht in der Schlange zum Check-in am Flughafen, eine Frau marschiert an ihr vorbei, sitzt nachher neben ihr im Flugzeug und sagt: 'Oh, ich habe sie gar nicht gesehen.' Und Brit Bennett erzählt dann, wie sie den ganzen Flug damit beschäftigt war, bin ich jetzt paranoid? Warum bin ich immer wieder mit der Frage beschäftigt: Was ist Rassismus? Erlebe ich Rassismus oder erlebe ich keinen? Sie erzählt, wie sie dann Mut fassen musste, um das Video anzusehen, wo man sieht, wie Eric Garner im Würgegriff der Polizei gestorben ist. Der zwölfjährige Tamir Rice, der mit einer Spielzeugpistole spielte, erschossen wurde. Und die Täter dazu, die jeweils sagten, das haben wir nicht gewollt.
Brit Bennett erzählt, wie ihr Vater als junger Bezirksstaatsanwalt mal von Polizisten angehalten wurde im Verkehr. Die standen dann um ihn rum und zielten alle auf seinen Kopf. Er ist dann ruhig geblieben, sie haben entdeckt, sie haben sich vertan, und dann hieß es 'Oh, sorry, buddy, du bist der Falsche gewesen.' Und Brit Bennett folgert in ihrem Essay aus dem Ganzen: Was nützt uns dieses 'Ich habe es nicht bös' gemeint', wenn wir am Schluss doch erschossen werden. Und damit ist man natürlich bei dem, was man nur beschreiben kann als strukturellen oder tief sitzenden unbewussten Rassismus.
Meyer: Jetzt haben Sie über zwei neue Essays gesprochen, eben zum Thema Rassismus in den USA. Sie haben sich auch Romane angesehen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Vielleicht stellen Sie uns einen vor, den Sie besonders beeindruckend fanden?
Junge Schwarze können sich Übermut nicht leisten
Conrad: Ja. Ich würde mal gleich weitermachen bei Brit Bennett. Ihr Roman "Die Mütter" ist gerade erschienen. Das ist definitiv kein Roman, der jetzt ganz explizit unbewussten Rassismus verhandelt, sondern wo man eher sagen muss, beeindruckend ist oder auffallend, dass hier mit großer Selbstverständlichkeit aus der schwarzen Community erzählt wird. Es wird also nirgends erwähnt, handelt es sich um Weiße oder Schwarze. Im Grunde derselbe Gestus, den wir haben, wenn wir Romane lesen und uns zu Anfang auch nicht fragen, welche Hautfarbe wird hier erwähnt. Mit dieser Selbstverständlichkeit behandelt Brit Bennett ihr Thema.
Ein junges Mädchen, 15-jährig, traumatisiert vom Selbstmord ihrer Mutter stürzt sich in die Liebe zu einem Jungen, wird schwanger, steht ihre Abtreibung im wahrsten Sinne des Wortes mutterseelenallein durch, verschweigt das auch, ist einer Freundin verbunden, die aus anderen Gründen mutterlos ist. Deren Mutter hat den Missbrauch gedeckt. Kurz, in diesen ganzen gewichtigen Themen – das ganze Familienverschweigen, Familiengeheimnisthema – ist jetzt erst mal Rassismus kein Thema. Nur in so kleinen Nebensätzen heißt es dann plötzlich zum Beispiel über diesen Jungen, von dem sie schwanger geworden ist: Übermut ist nicht etwas, was schwarze Jungs sich leisten können. Übermut können sich weiße Jungs leisten. Die werden dann Politiker und Banker. Schwarze Jungs sind dann eher tot, wenn sie sich das leisten. Das sind so feine, kleine Hinweise, die in Brit Bennetts sehr souverän erzählten Roman deutlich machen, woher sie kommt, gleichsam.
Meyer: Sie haben sich verschiedene Romane angeschaut von schwarzen Autorinnen aus der Gegenwart. Kann man sagen, da gibt es Themen, die wieder auftauchen, da gibt es Verwandtschaften zwischen den Büchern?
Conrad: Ja, auch hier würde ich gleich wieder bei dem Titel bleiben von Brit Bennett "The Mothers". "Mutter" scheint mir ein total zentrales Stichwort zu sein. Bei Brit Bennett sind die Mütter so eine Art Chor der älteren Frauen, der deutlich macht, Mütter sind die Hüterinnen von Gemeinschaft, das sind die, die die Black Community generell zusammenhalten. Das gibt es bei anderen Autorinnen auch. Eine, leider noch nicht übersetzt, Angela Flournoy zum Beispiel: "Turner House" handelt von einem Clan, wo eine Mutter 13 Kinder zusammenhält der in der nächsten Generation auseinanderbricht. Dann gibt es, ganz zentral, die ja bei uns auch inzwischen sehr bekannte Jesmyn Ward, deren beide Romane den National Book Award bekommen haben und wo das dramatische Fehlen von Müttern zentral ist. Im ersten Roman ist die Mutter gestorben, im zweiten ist die junge Mutter, die von Drogen und Beziehungssucht mehr oder weniger ruiniert ist, unfähig, für ihre Kinder zu sorgen. Und immer ist es so, dass eigentlich so der Subtext sagt, schwarze Mütter müssen eigentlich Übermütter sein. Weil wenn sie nicht da sind, die Männer sitzen sowieso im Gefängnis, haben gerade mal wieder ihren Job verloren oder sind von diesen ganzen politischen Verhältnissen psychisch zerstört. Wenn sie versagen oder nicht da sind, dann bricht eben alles zusammen. Und abschließend vielleicht, Brit Bennett hat das auch mal gesagt. Sie hat gesagt, sie hat, als sie selbst eine schwarze Mutter hat Selbstmord begehen lassen, war ihr klar, hier rührt sie an ein riesiges Tabu. Eine schwarze Mutter darf nicht Selbstmord begehen. Die darf einfach nicht fehlen.
Meyer: Diese Romane, von denen Sie jetzt gesprochen haben, wenn ich das richtig verstanden habe, die spielen in ganz schwarzen Welten, also Weiße kommen so gut wie nicht vor oder spielen keine Rolle für diese Romane. Ist das etwas Neues in der schwarzen Literatur, dass man sich so ganz auf die sozusagen eigene Welt besinnt?
Die Leser zum Ignorieren der Hautfarbe zwingen
Conrad: Neu ist das natürlich nicht. Ich würde sagen, es wird anders heute verhandelt. Nehmen wir Toni Morrison. Seit 1970 beschreibt sie ja schwarze Lebenswelten. Sie geht, wie in "Menschenkind" zurück in Sklaverei-Kontexte oder mit "Jazz" in das 1920er Harlem. Das sind alles auch immer schwarze Lebenswelten, aber ganz extrem definiert von den Grenzen und Bedingungen, die die weiße Welt setzt.
Interessant ist, dass Toni Morrison, der gerade von ihr erschienen ist unter dem Titel "Die Herkunft der anderen" beschreibt, dass das für sie auch immer ein ganz wichtiges Ziel war, nicht die Hautfarbe zu verraten, sondern uns Leser, Leserinnen zu zwingen zum Ignorieren der Hautfarbe. Aber der Verlag wollte das nicht. Das ist schon mal das eine, was interessant ist. Und dann muss man sagen, in ihren Büchern konnte man das qua Kontext erschließen, wer weiß ist und wer schwarz ist. Das hat sich natürlich definitiv verändert. Und jetzt mal zurück vielleicht noch zu einer jungen Autorin wie Brit Bennett. Sie war 18, als Obama an die Macht kam. Ich denke, dass da mit einem ganz anderen Elan und einer ganz anderen positiven Zuversicht erzählt worden ist. Und dann natürlich diese Rückschläge mit Ferguson und so weiter. Die haben das Selbstbewusstsein dennoch nicht völlig zunichte machen können. Und da, denke ich, zeigt sich eine andere Souveränität im Erzählen.
Meyer: Ist das auch eine Frage eines neuen, veränderten Selbstbewusstseins, dass Sie jetzt uns nur Bücher von Frauen vorgestellt haben und dass es vor allem schwarze Autorinnen sind, die im Moment mit bemerkenswerten Büchern hervortreten?
Conrad: Es sind nicht nur Autorinnen. In diesem ganzen Kontext ist führend, würde man vermutlich sagen, Ta-Nehisi Coates, der 1975 geborene Intellektuelle, der ja auch gerade wieder ein aktuelles Buch geschrieben hat. Ich denke, dass es auffallend ist, dass es sehr junge Frauen sind, und dass diese sehr jungen Frauen zwischen 25 und 40, dass die gerade deutlich machen, wir Frauen haben innerhalb dieser ganzen großen Selbstvergewisserungsthematik noch eine Rolle, weil wir ziehen auch noch die Kinder groß. Wir sind die Mütter, die Schwestern, die traditionell Haltenden, und dieses ganze Erbe von Frauen, die das immer gewährleisten mussten, das ist das, was diese Frauen gerade verhandeln und wo sie sich Gedanken darüber machen: Was ist, wenn diese Strukturen einbrechen, wenn die brüchig werden? Das ist so eine große Thematik gerade.
Meyer: Neue Bücher von schwarzen Autorinnen aus den USA, was sie beschäftigt, davon hat uns Bernadette Conrad erzählt. Herzlichen Dank!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Literatur im Überblick Romane:
Brit Bennett: Die Mütter; Rowohlt 2018 Jesmyn Ward: Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt; Kunstmann 2018 Angela Flournoy: The Turner House; Mariner Books, noch nicht auf Deutsch erschienen
Essays:
Toni Morrison: Die Herkunft der anderen. Über Rasse, Rassismus und Literatur; Rowohlt 2018 Patrisse Khan-Cullors: #Black Lives Matter. Eine Geschichte vom Überleben; KiWi 2018 Ta-Nehisi Coates: We Were Eight Years in Power. Eine amerikanische Tragödie; Hanser Berlin 2018
Brit Bennett: Die Mütter; Rowohlt 2018 Jesmyn Ward: Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt; Kunstmann 2018 Angela Flournoy: The Turner House; Mariner Books, noch nicht auf Deutsch erschienen
Essays:
Toni Morrison: Die Herkunft der anderen. Über Rasse, Rassismus und Literatur; Rowohlt 2018 Patrisse Khan-Cullors: #Black Lives Matter. Eine Geschichte vom Überleben; KiWi 2018 Ta-Nehisi Coates: We Were Eight Years in Power. Eine amerikanische Tragödie; Hanser Berlin 2018