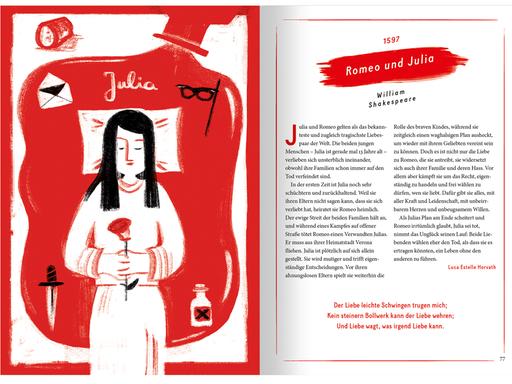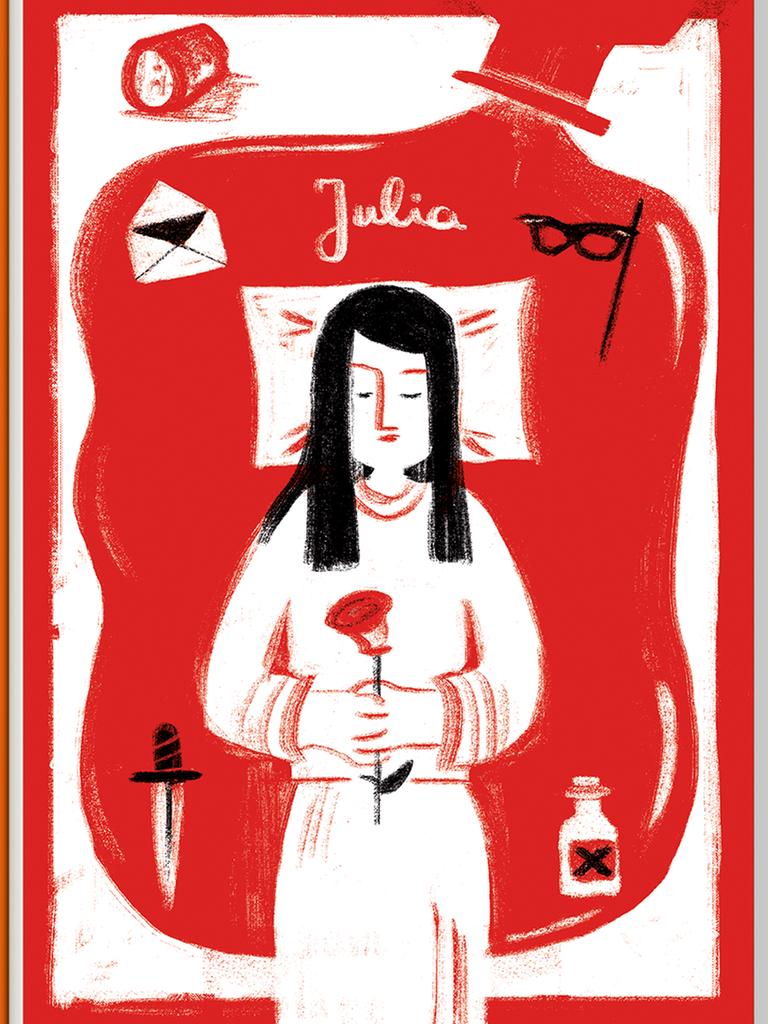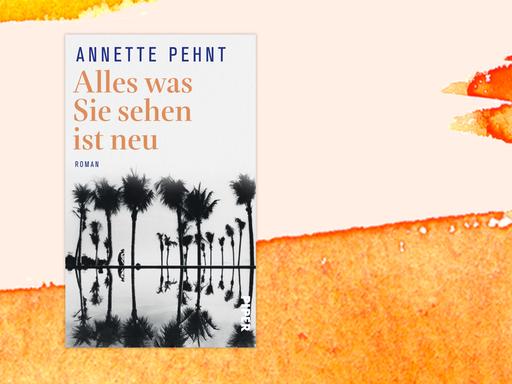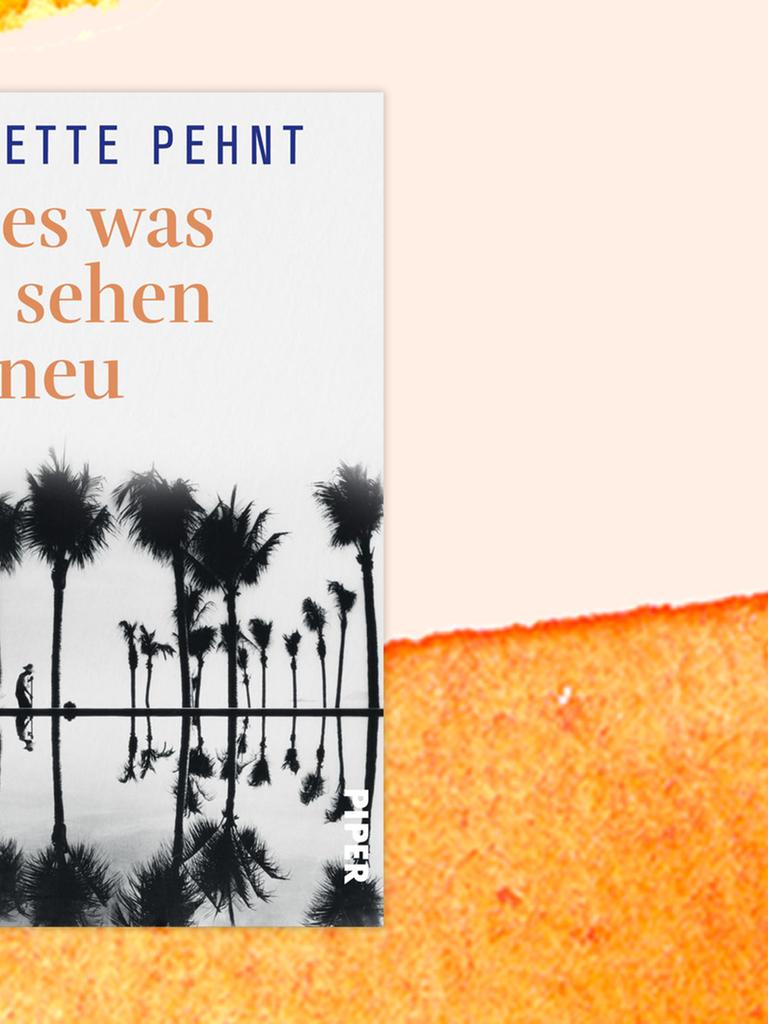Annette Pehnt: "Einen Vulkan besteigen"
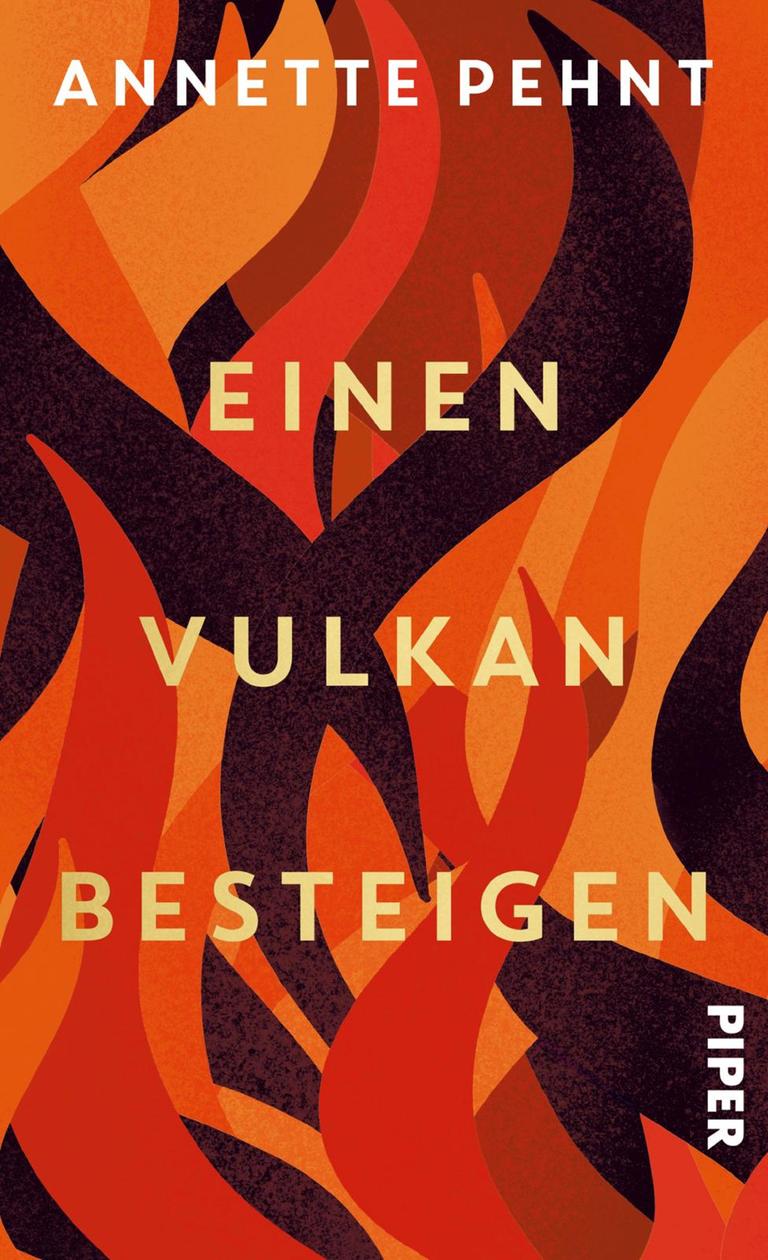
© Piper Verlag
Beschränkung auf das Wesentliche
06:59 Minuten
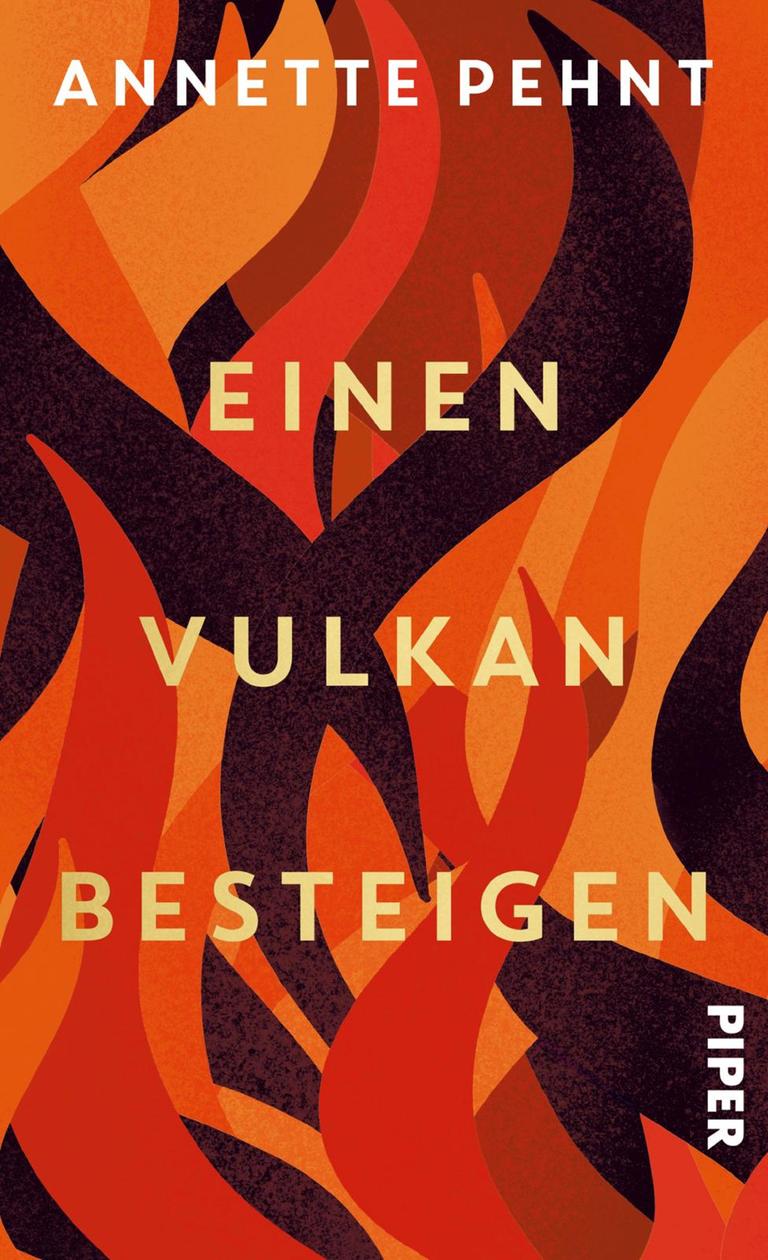
Annette Pehnt
Einen Vulkan besteigen. Minimale GeschichtenPiper, München 2025288 Seiten
24,00 Euro
In einer radikalen literarischen Versuchsanordnung erkundet Annette Pehnt die Abgründe der Komplexität, indem sie versucht, in ihrer Sprache ganz auf sie zu verzichten – eine Gratwanderung.
Die sogenannte „einfache Sprache“, die bewusste Reduktion des kreativen Potenzials von gesprochener oder geschriebener Kommunikation auf definierte Grundformen, ist ein Instrument zur Beförderung von Barrierefreiheit. Können dessen Regeln und Restriktionen auch die Basis für anspruchsvolle Literatur sein?
Produktion von Leerstellen
Diese Frage stellt sich und uns Annette Pehnt. Sie tut das nicht explizit, sie geht ihr praktisch, in Form einer erzählerischen Versuchsanordnung nach, in einer Sammlung von Kurzgeschichten, verfasst in ebendieser einfachen Sprache.
Damit reduziert die Autorin ihr erzählerisches Potenzial bewusst und freiwillig gleich auf zweifache Weise: Die Miniatur, die Ankündigung „minimaler Geschichten“, bedeutet eine Beschränkung in der Form, die einfache Sprache begrenzt die Variationsmöglichkeit im literarischen Ausdruck.
So schafft das Projekt unausgesprochen durch seine formalen Prämissen zunächst vor allem Leerstellen, um die herum die versierte Erzählerin – für ihr literarisches Werk vielfach ausgezeichnet und Professorin für Kreatives Schreiben – erzählt. Kann das gut gehen?
Geheimnis des Unausgesprochenen
Es kann, muss aber nicht. Es gelingt, wenn die forcierte Schlichtheit des Sprechens eine erzählerische Symbiose mit der abgründigen Komplexität des jeweils erzählten, im Grunde eher angedeuteten Stoffs eingeht. Das ist eine beständige Gratwanderung, ja es ist, ist, als würde man „einen Vulkan besteigen“ – so der Titel der Sammlung und eines ihrer gelungensten Texte.
Annette Pehnt baut darauf, dass die Leerstellen, in die sie die einfache Sprache setzt, das eigentliche literarische Geheimnis ihrer Geschichten enthalten, dass das Unausgesprochene die Botschaft entfaltet.
Gegensätzliche Vorgänge der Reduktion
Gelingt dies, ergibt sich tatsächlich ein überraschender Effekt, auch weil die Reduktion eines erzählenden Textes auf die phänotypische Erscheinungsform von Lyrik (jeder der kurzen, fast immer mit einem Punkt beendeten Sätze beansprucht eine Zeile oder maximal zwei für sich) die Erwartungshaltung gegenüber dem zu Erzählenden verändert.
Lyrik als hochkomplexe, verdichtende literarische Form und einfache Sprache als kommunikatives Ausdrucksmittel haben zwar den Anspruch gemeinsam, etwas auf ein Wesentliches zu reduzieren – aber es sind zwei sehr unterschiedliche, wenn nicht widersprüchliche, um nicht zu sagen gegensätzliche Vorgänge der Reduktion.
Ganz einfach – oder gerade komplex?
Und da stellt sich die Frage, ob das Projekt Ziel und Prinzip der einfachen Sprache nicht am Ende konterkariert. Während diese den Blick auf die Welt ostentativ vereinfachen möchte, erheben die Texte den aus jeder ihrer kurzen Zeilen sprechenden Anspruch, Grundsätzliches, wenn nicht sogar Wahres, Wesentliches über den in einer komplexen, schwer zu lesenden Welt verlorenen, einsamen Menschen, seine Verfasstheit, seine Bestimmung, seine Möglichkeiten zum Ausdruck zu bringen.
Das markiert auch die Fallhöhe des Projekts, für jeden Text erneut. „Niemand ist da, um mich zu finden. Dem Vulkan ist es egal.“, heißt es in „Einen Vulkan besteigen“. Der letzte Satz lautet dann: „Ich stolpere.“