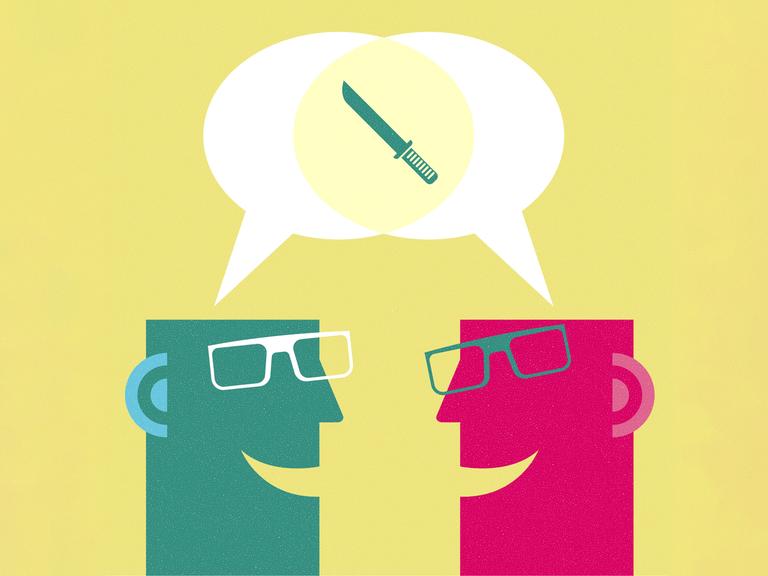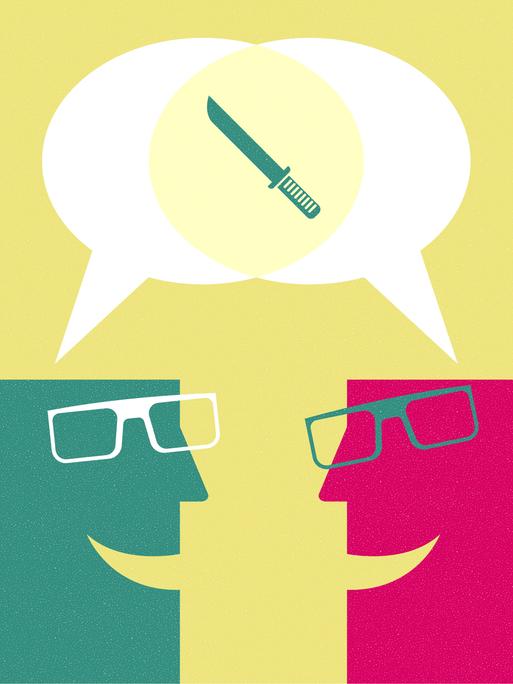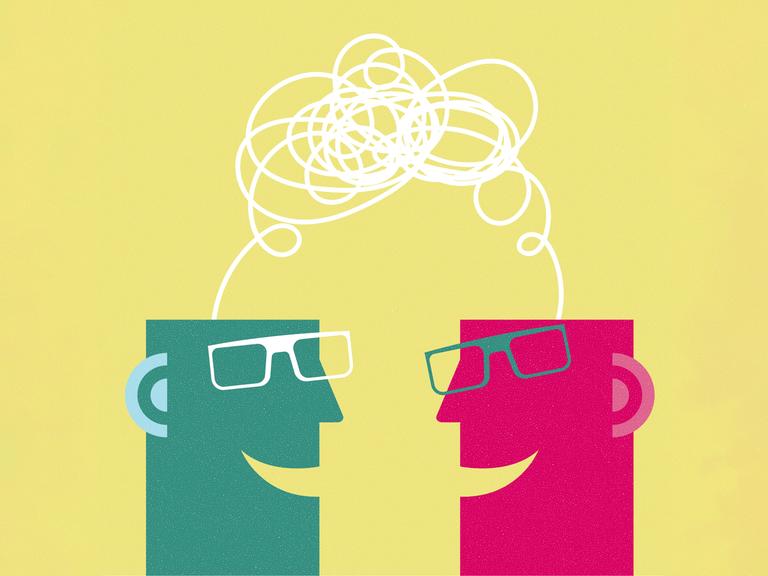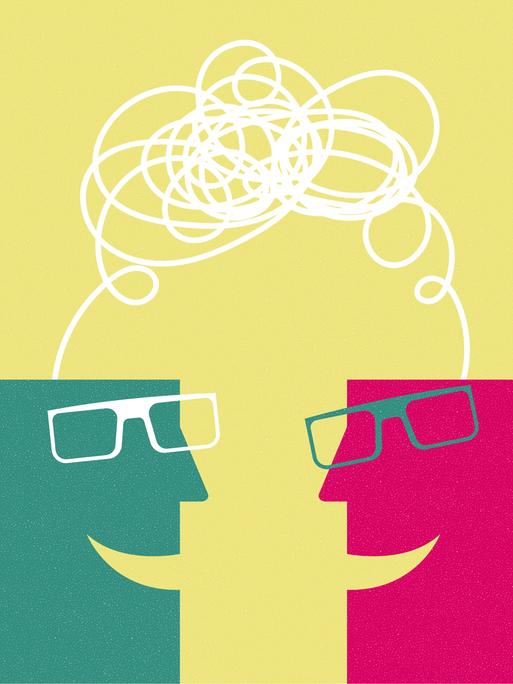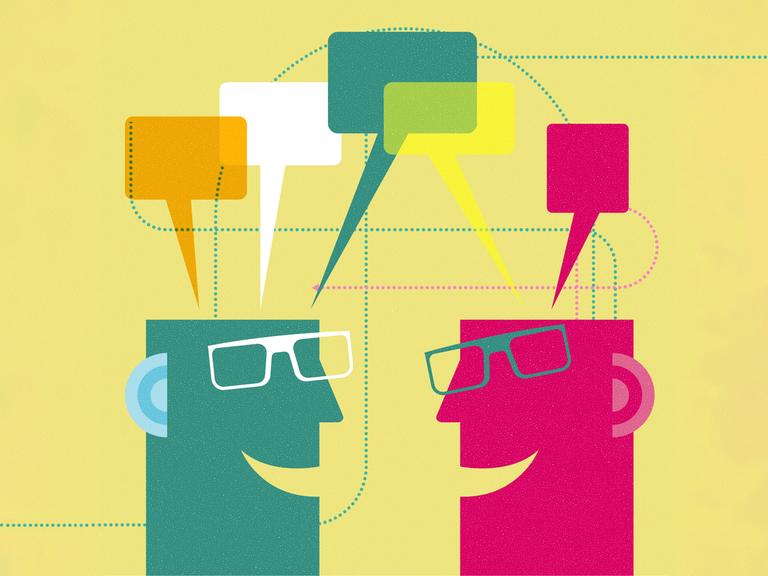„Ein Blick in die Geschichte lehrt uns, dass Sprache nicht immer unschuldig ist, einfach weil Sprecher:innen es nicht sind.“
Henning/Kompa/Nimtz: "Die dunkle Seite der Sprache"
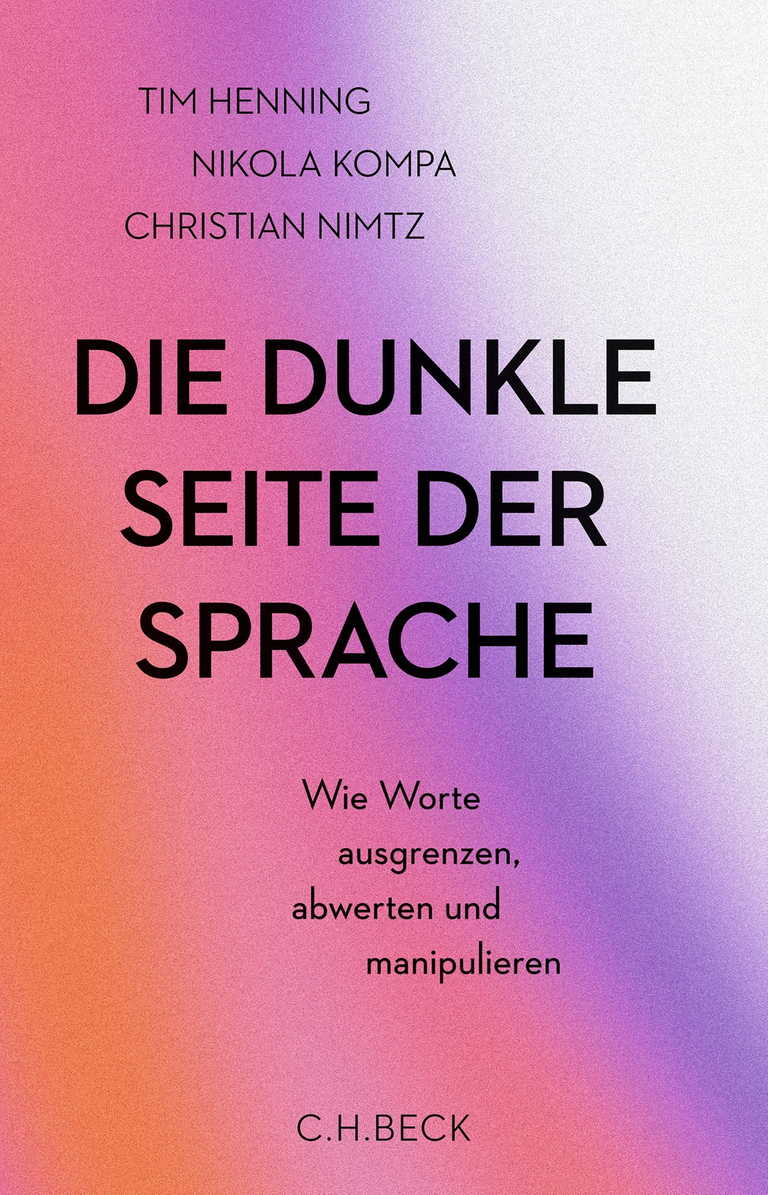
© C.H. Beck Verlag
So funktioniert sprachliche Herabsetzung
06:31 Minuten
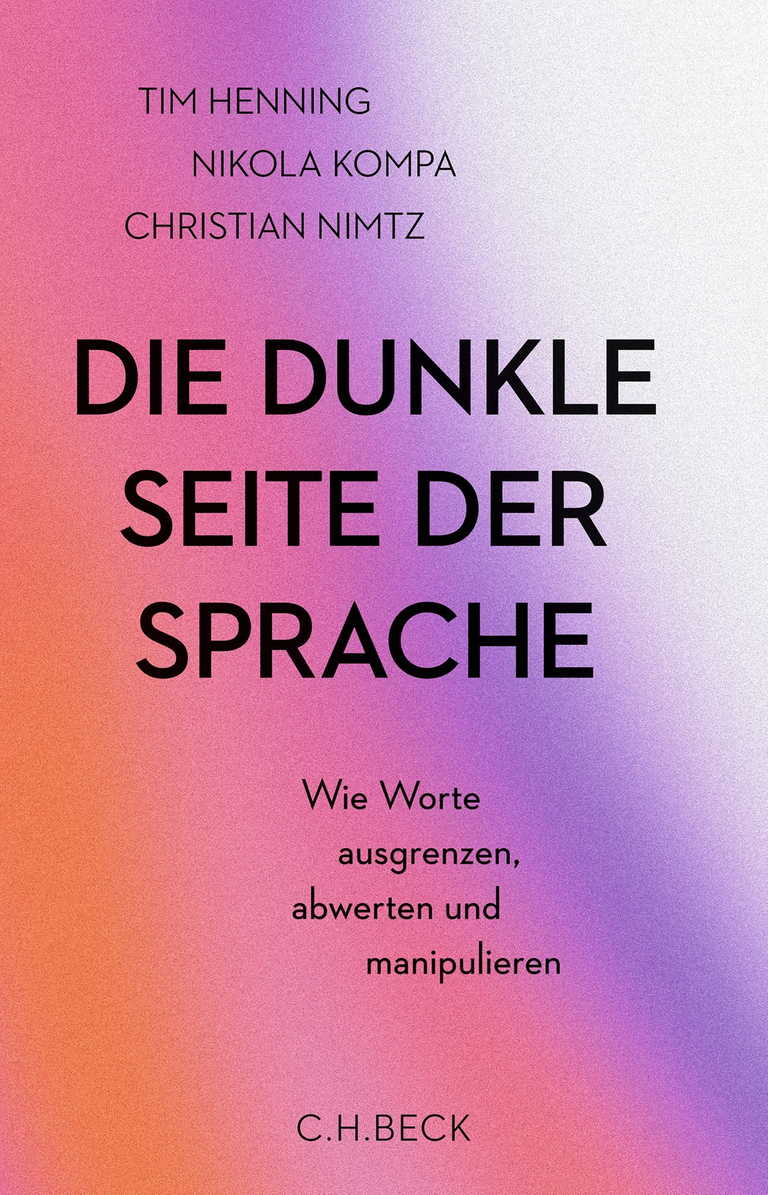
Tim Henning, Nikola Kompa, Christian Nimtz
Die dunkle Seite der SpracheC.H. Beck , München 2025224 Seiten
28,00 Euro
Sprache will Wahrhaftigkeit, braucht Vertrauen und ermöglicht Handeln. Und Sprache kann abwerten, herabsetzen, kränken und diskriminieren. Sprache ist Macht und Sprache hat Macht, und das subtiler und komplexer, als man es sich als Sprechender bewusst ist.
So weit, so nicht unbekannt; der Mensch hat ja oft üble Absichten. Aber wie genau funktionieren die Mechanismen der „kommunikativen Entmündigung“ und „hermeneutischen Hilflosigkeit“, die dieses Buch diagnostiziert?
Auf 224 Seiten setzen sich die Philosophin Nikola Kompa und ihre Kollegen Tim Henning und Christian Nimtz mit den kontextuellen, semantischen, pragmatischen, psychologischen und soziale Strukturen der Herabsetzung durch Sprache auseinander. Unter Vielem mit Lüge, ‚Mansplaining‘, ‚Bullshitting‘ und Verschwörungserzählungen.
Sie arbeiten aus der Quelle etablierter, meist US-amerikanischer Theorien und bilden von John L. Austin über Sara-Jane Leslie bis zu Christopher Hom und Mary Kate McGowan den akademischen Forschungsstand der philosophischen Sprechakttheorie ab.
Das Buch, so notieren die Autoren eingangs, wolle den „Status der Wahrhaftigkeit in sprachlicher Kommunikation“ ergründen. Wahrhaftigkeit, ist das überhaupt noch möglich in sprachverrohten Zeiten ohne Verbindlichkeiten?
Vom Ich zum Wir
Jedes der sechs Kapitel ist mit einer Anekdote oder einer Szene eingeleitet, meist ein kurzer, reportagiger Einstieg im Ich-Modus, um dann in der Wir-Analyse mittels konkreter lebensweltlicher Beispiele einen jeweils moralisch heiklen Sachverhalt zu deklinieren. Zum Beispiel: Die manipulative Macht der Metapher.
„Das Erstaunlichste an Metaphern ist vielleicht, dass sie zwar ungemein nützlich, aber auch ungemein schädlich sein können. Bei ihnen zeigt sich der Dual-Use-Charakter der Sprache.“
Metaphern lösen affektive Reaktionen aus und konstruieren emotionale Nischen. Sie sprechen nicht direkt an, sondern legen nahe - das macht sie so attraktiv und gefährlich.
Die "Flüchtlingswelle" beispielsweise ist ja keine Welle, das Wort soll aber eine Katastrophe unterstellen. Metaphern, schreiben die Autoren, können dazu beitragen, Menschen zu entmenschlichen, indem sie sie zu Dingen oder Tieren machen. Und sie können gezielt beleidigen, weil sich betroffene Personen nicht zur Wehr setzen können.
„Wie wir über Dinge reden hat Einfluss darauf, wie wir über die Dinge denken, welche Empfindungen sie in uns hervorrufen und wie wir sie bewerten.“
Problematische Übergeneralisierung
Die drei Philosophen gönnen sich reichlich Zeit, Raum und Seiten, um mit ausführlich reflektierten Fallbeispielen die kognitiven Quellen möglicher Diskriminierung durch sogenannte Quantorenausdrücke wie „alle Kinder“ oder „einige Studierende“ zu untersuchen.
Es macht ja einen erheblichen Unterschied, ob man sagt: „Alle Studierenden kommen zu spät“, „einige Studierende kommen zu spät“ oder „Studierende kommen zu spät.“
Solcherart generische Aussagen setzen auf Generalisierung, auf Verallgemeinerung. Das oft politische Problem beginnt mit der „Übergeneralisierung“ bei anschließender „Essentialisierung“. Wie häufig muss ein Merkmal auftreten, damit eine generische Aussage wahrhaftig ist? Wie viele Enten müssten Eier legen, um dem Satz ‚Enten legen Eier‘ einen Wahrheitsanspruch zuzuerkennen? Und ist Eierlegen dann die Essenz des Entenseins?
Wer Menschen herabsetzen will, benutzt sogenannte „Slurs“. Kanake, Schwuchtel, Boomer sind klassische „Herabsetzungswörter“, Tabuausdrücke, die die semantische Seite – das also, was gesagt wird – mit der pragmatischen Seite – wie das Gesagte verstanden werden soll – kurzschließen. Beispiel: Viktor ist ein Polacke, alle Polacken sind verabscheuungswürdig, also ist Viktor verabscheuungswürdig.
„Die kollektiv herabsetzende Kraft von «Polacke» ergibt sich rein pragmatisch durch die Entscheidung der Sprecher:in, ein Wort zu verwenden, das wir mit Ausgrenzungsideologien oder -praktiken verbinden.“
Was Folgendes bedeutet: Das Wort «Polacke» an sich muss gar keinen abwertenden Inhalt tragen; es muss nur der bekanntermaßen im polenfeindlichen Milieu verwendete Ausdruck für Pole sein. Ein Subjekt – „Viktor“ – in ein Objekt – „Alle Polen“ – zu verwandeln, ist das Einmaleins des Rassismus.
Subtil und komplex
Manche der sechs Kapitel sind detailfreudig, andere verdichtet und sperrig, dritte kommen nur langsam voran. Mal geht es in die phänomenologische Breite, mal in die analytische Tiefe; hier und da muss der Leser diskursive Kosten zahlen und sich in die Terminologie sprechakttheoretischer Forschung mitziehen lassen. Aber es lohnt sich.
Henning, Kompa und Nimtz zeigen – ohne das theoretische Niveau preiszugeben – auf gut gegliederte, nachvollziehbar argumentierte und lebensweltlich plausibel verortete Weise, wie subtil und komplex die Herabsetzung durch Sprache im Alltag funktioniert. Leider endet ihr Plädoyer für die Wahrhaftigkeit etwas unvermittelt, das Buch wirkt unvollendet.
Gegenstrategien zur „kommunikativen Entmächtigung“ und der demonstrativen Verletzung einer normativen Sprachgemeinschaft bieten die drei Philosophen kaum an, aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass man nach der Lektüre selbst um einiges sensibler sprechen wird.