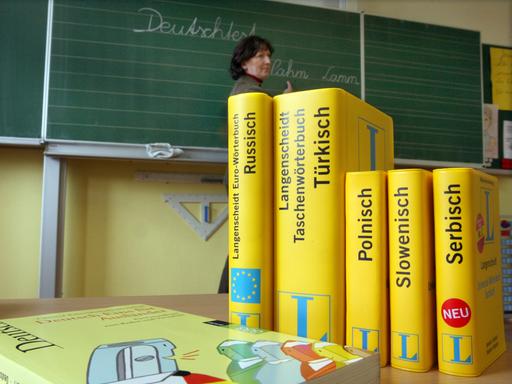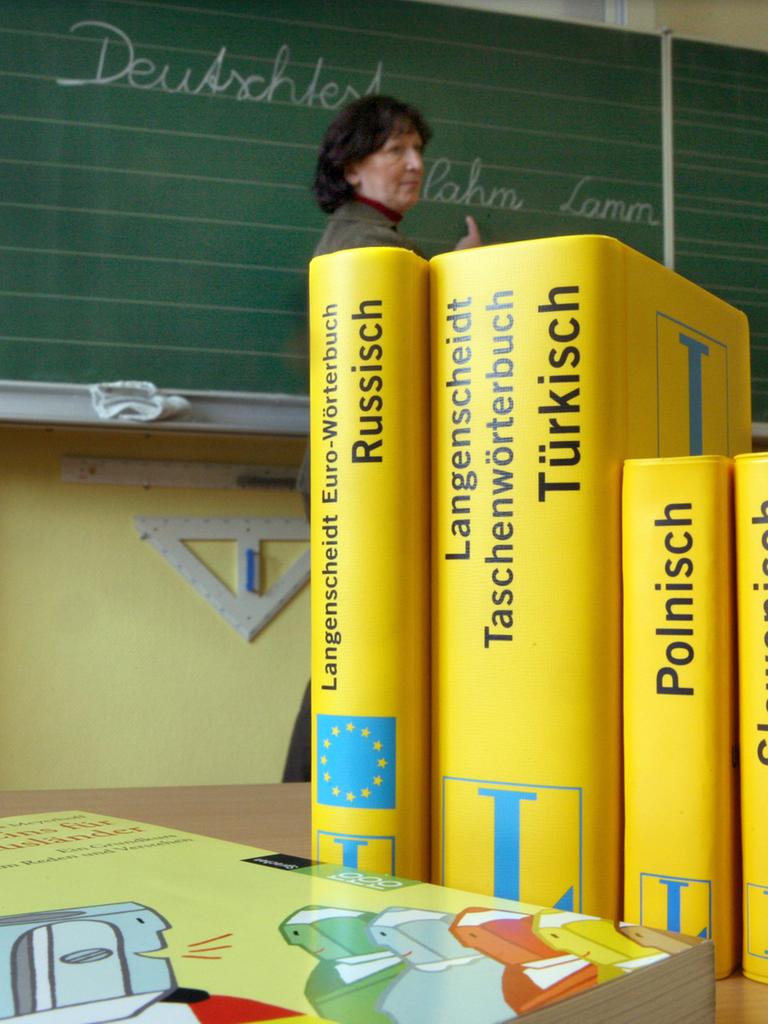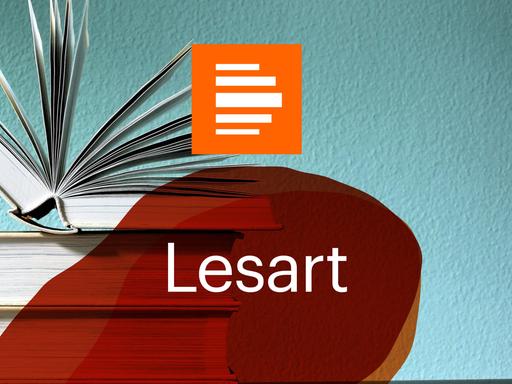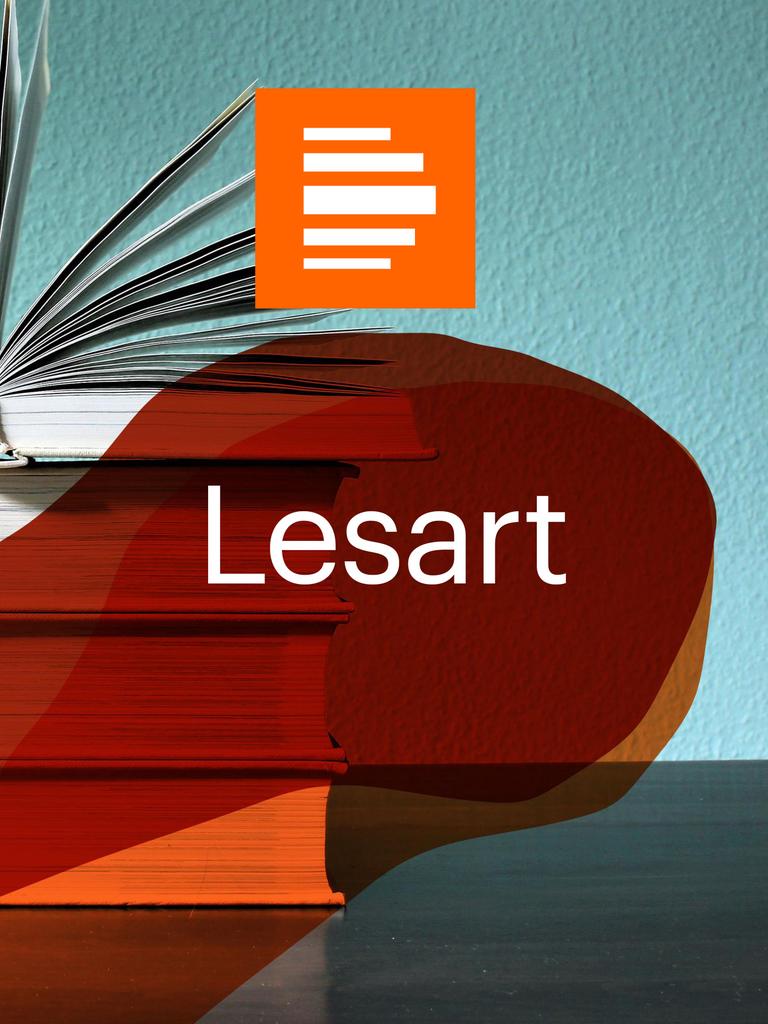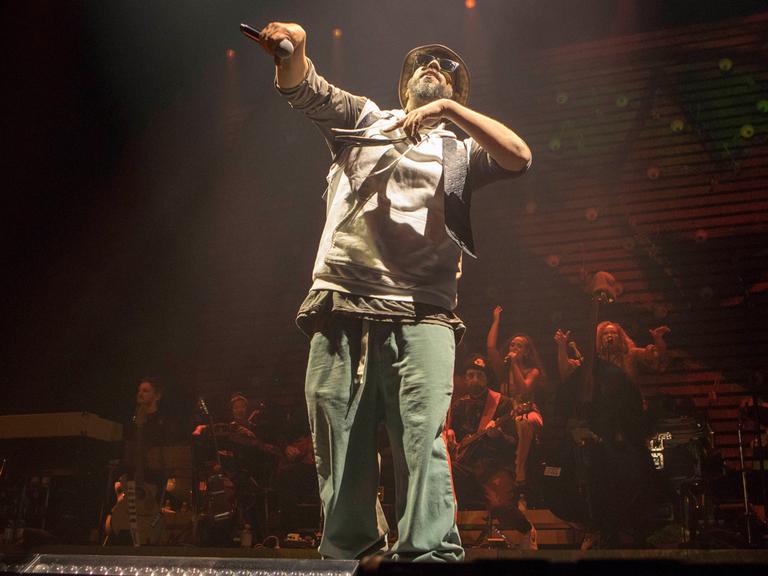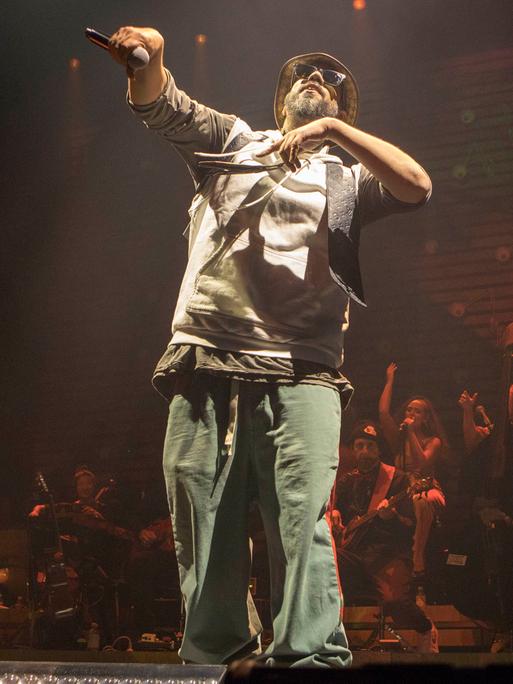Meinung

Englische Begriffe sind heute fester Bestandteil unseres Alltags. © picture alliance / Shotshop / Lutz Wallroth
Englisch sollte zweite Amtssprache in Deutschland sein
04:07 Minuten

Berliner Bars, in denen das Personal kein Deutsch spricht, deutsche Politiker, die an einfachem Englisch scheitern: Machen wir doch einfach Englisch zur zweiten Landessprache. Das würde uns allen guttun.
Englisch als zweite Landessprache. Really? In Gesetzestexten, in Schulen, im öffentlichen Nahverkehr, in den Nachrichten? Der Vorschlag liegt viel näher als der Ruf nach einer neuen Nationalhymne und das Begehren nach einer geschlechtergerechten Sprache – oder ihre Ablehnung. Weil es ein Vorschlag zum Umgang mit unserer Realität ist. Ein Reality-Check.
Denn je nachdem, welche Gesetze man liest, welche Schulen die Kinder besuchen, in welcher Stadt man Bus und Bahn fährt oder welche Nachrichten man konsumiert – Englisch ist Standard. Beruflich und privat. Eine Art „zweite Muttersprache“ – für die meisten allerdings ohne die prägende Mutter. Das ist ein Problem!
In der Alltagssprache, in Marketing und Entertainment haben wir längst einen deutsch-englischen Mix. Ein Sprachhybrid, weil Englisch Aufgaben unserer Muttersprache übernommen hat – mit unzähligen Begriffen, die sich nicht eins zu eins übersetzen lassen: Gender, Moonshots, Workspace, Level Playing Field, Smart Meter, Compliance, Derisking. Nicht nur Unternehmensberater sprechen so, sondern auch Politiker, die sich an die gesamte Bevölkerung richten. Whatever it takes, um Friedrich Merz zu zitieren.
Englisch ist längst Verkehrssprache
Dort, wo viele Menschen kein Deutsch beherrschen, aber unbedingt angesprochen werden sollen, ist Englisch auch längst Verkehrssprache. Denken Sie an die Expats in den Städten, die Hausmeister mit Englischkenntnissen verlangen. Eine gleichberechtigte Amtssprache ist Englisch schon auf der europäischen Ebene – diese Parallelität ist also möglich und kann bindend sein. Eine Elitensprache ist Englisch allemal. Und eine Umgangssprache in den Familien – die lässt sich niemals vorgeben, aber sie ist durch mehrsprachige Beziehungen aller Art eine verbreitete Realität.
Worum es geht, was wirklich die Neuigkeit darstellen würde, wäre Englisch als eine verlässliche zweite Landessprache neben dem Deutschen. Das sollte das verbindlich und nachvollziehbar machen, was für Teile der Bevölkerung normal ist – und für andere bloß erratisch, gelegentlich, aber dennoch vorhanden und dann besonders ärgerlich.
Die englische Sprache gehört uns allen
Wer sich jetzt gleich reflexhaft um die kulturelle Hoheit und deutsche Identität sorgt, möge bedenken: Englisch gehört niemandem, keiner Ideologie und keinem Gesellschaftsentwurf. Nicht Donald Trump, nicht King Charles. Es ist die Sprache der Welt, sie gehört uns allen. Auch wir sind Stakeholder – und sollten diese Rolle aktiv annehmen. Man nennt es Agency – wieder so ein Begriff. Im Duden steht „Agentur“. Gemeint ist: the ability to act independently or exert power. Irgendwas zwischen Handlungsfähigkeit und Handlungsmacht.
In Deutschland verfügt allerdings nur ein Teil der Bevölkerung über diese Agency, wenn es um Englisch geht. Denn wenn man die Englischkompetenz in Deutschland untersucht – im Arbeitsalltag, in Debatten oder ganz einfach auf der Straße –, stößt man auf das, was ich einen Sprachgraben nenne.
Ungleichheit und verpasste Bildungschancen
Dieser Sprachgraben zieht sich quer durchs Land und macht Ungleichheit und verpasste Bildungschancen sichtbar: Auf der einen Seite diejenigen, die Englisch beherrschen. Sie haben Zugang zu vielen Menschen, Wissen und Karrieren. Auf der anderen Seite diejenigen, die an der sprachlichen Barriere scheitern – und damit an Lebenschancen. Beide Gruppen sind laut Allensbach gleich groß. Fifty-fifty.
Ich denke, für die, die Englisch nicht oder kaum beherrschen, sollte dringend etwas getan werden – auch dafür könnte die Anerkennung von Englisch als zweiter Landessprache einen Anreiz schaffen.
Englischkenntnisse würden das Deutsche stärken
Bessere Englischkenntnisse für alle würden auch das Deutsche stärken. Nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung. Nicht als Prestigeprojekt für eine kosmopolitische Elite, sondern als notwendiges Versprechen, um die Chancen für jeden zu verbessern. Denn egal, wie die Konflikte der Gegenwart ausgehen, eine international vernetzte und von der Globalisierung abhängige Gesellschaft werden wir bleiben.