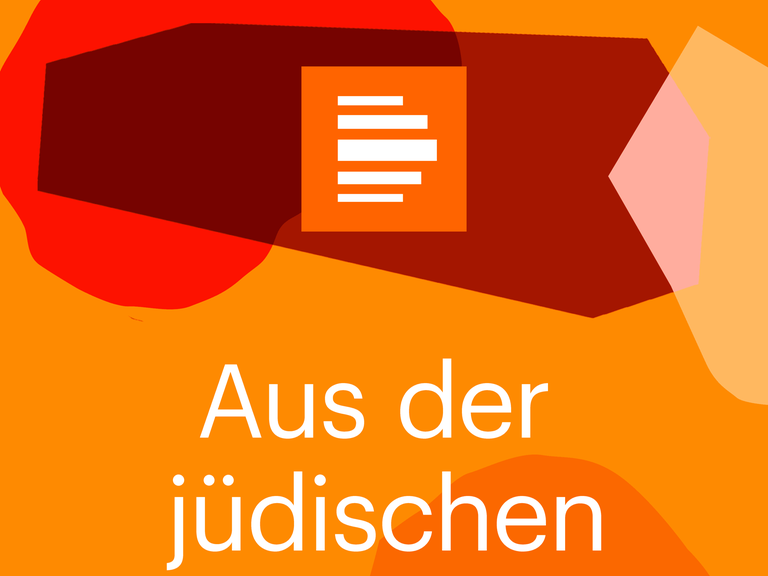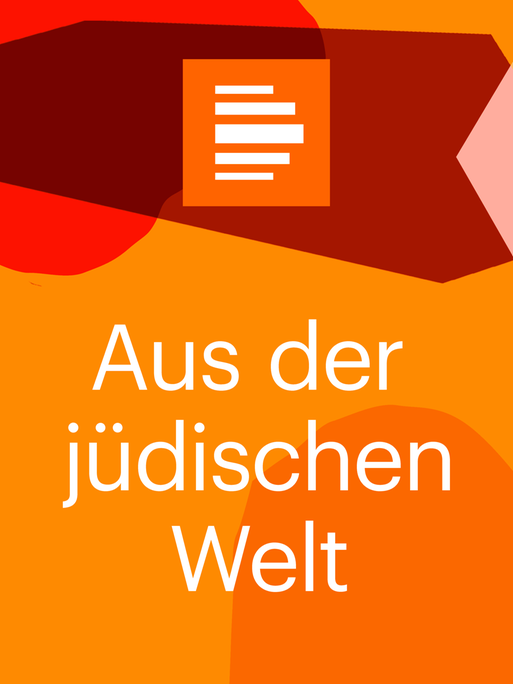Eine eigenständige "schmélzsprach"
Seit dem 11. Jahrhundert haben Millionen Menschen in Europa Jiddisch gesprochen. Hitler wollte, dass die Sprache ausstirbt. Aber die "schmélzsprach" ist zu einer kulturellen Weltsprache geworden, obwohl die zionistischen Juden auf Hebräisch als neue Sprache gesetzt hatten. Die Kulturwissenschaftler Marion Aptroot und Roland Gruschka machen die bewegte Geschichte des Jiddischen transparent: komplex aber nicht kompliziert.
"Redt jídisch!" forderten Plakate in manchen Lagern für die jüdischen "displaced persons"(DP), die Shoah-Überlebenden, die aus Osteuropa kamen. Sprecht keine eurer slawischen Sprachen, kein Rumänisch, kein Ungarisch, Deutsch schon gar nicht, sondern Jiddisch oder Hebräisch. Letzteres allerdings konnten die meisten (noch) nicht. Gleich 1945 erschienen wieder jiddische Zeitungen in DP-Lagern und bald überregional, wenn auch in lateinischen Lettern, hebräische standen noch nicht zur Verfügung.
Und vielleicht wurden DPs so zu Hebammen bei der Wiedergeburt einer Sprache, die nach dem Willen Hitlers und auch Stalins hätte aussterben sollen und von der man auch heute noch nicht weiß, ob ihr je wieder ein blühendes Leben beschieden sein wird. Leiser Optimismus ist erlaubt - auch weil gerade in Deutschland das Interesse an Jiddisch-Studien wächst.
"Jídisch g'red" hatten Millionen Menschen in Europa mindestens seit dem 11. Jahrhundert. Denn Jiddisch ist - im Gegensatz zum immer noch gängigen Vorurteil - keine untergegangene "shtetl"-Folklore, kein linguistischer "klesmer", keine "Gaunersprache" (Rotwelsch) und auch kein vermasseltes Deutsch.
Jiddisch ist eine eigenständige "schmélzsprach", eine Komponentensprache, geschöpft aus alten aramäisch-hebräischen, slawischen, romanischen und deutschen, später auch neuen hebräischen und englischen Quellen, mit eigener Semantik und Grammatik, in sich differenziert. Es ist die über die Zeiten und Wanderungen entwickelte Sprache der aschkenasischen Juden und mit ihnen "af ale kontinentn" weitergewandert. Kurz: eine Weltsprache, die eine ganze Kultur hervorgebracht hat, samt Buchmarkt, Zeitungen und Theatern, Weltliteratur - von Scholem Alejchem, "Mendele Mojcher-Ssforim", I.L. Peretz - und Sprachforschung und -normierung.
Vielleicht ist Jiddisch so faszinierend, weil es, anders als andere Weltsprachen, immer sowohl äußerlich wie innerlich mehrsprachig war. Aschkenasim nutzten im Umgang mit der Außenwelt zusätzlich die jeweilige Landessprache, aber untereinander sowohl Jiddisch wie Hebräisch: als "Umgangssprache" und als "Hochsprache". Diese innere Hierarchisierung führte dazu, dass Jiddisch auch unter Juden einen Ruch des Niederen hatte - Stoff für "zóreß" aller Art. Zionisten in Palästina, später Israel galt Jiddisch als Symbol für Vergangenes, sie setzten mit allen Mitteln Hebräisch durch. Die jüdischen Aufklärer wie Moses Mendelssohn hatten, kurz gesagt: "Redet Deutsch!" gefordert. Das Jiddische lebt also in ständiger innerer und äußerer Reibung, und die zwingt zu kämpferischem Einfallsreichtum und Gewitztheit.
Ohne die jeweiligen äußeren und inneren historischen Zusammenhänge ist seine Geschichte nicht verstehbar. Marion Aptroot und Roland Gruschka erzählen sie - von den nachweisbaren Anfängen bis heute - tatsächlich so komplex, aber überhaupt nicht kompliziert, sondern wunderbar transparent und verlockend. Ihre "GESCHICHTE UND KULTUR EINER WELTSPRACHE" wird das Interesse am Jiddischen mit Sicherheit weiter vergrößern.
Besprochen von Pieke Biermann
Marion Aptroot/Roland Gruschka: Jiddisch - Geschichte und Kultur einer Weltsprache
Verlag C. H. Beck, München 2010
192 Seiten, 11,95 EUR
Und vielleicht wurden DPs so zu Hebammen bei der Wiedergeburt einer Sprache, die nach dem Willen Hitlers und auch Stalins hätte aussterben sollen und von der man auch heute noch nicht weiß, ob ihr je wieder ein blühendes Leben beschieden sein wird. Leiser Optimismus ist erlaubt - auch weil gerade in Deutschland das Interesse an Jiddisch-Studien wächst.
"Jídisch g'red" hatten Millionen Menschen in Europa mindestens seit dem 11. Jahrhundert. Denn Jiddisch ist - im Gegensatz zum immer noch gängigen Vorurteil - keine untergegangene "shtetl"-Folklore, kein linguistischer "klesmer", keine "Gaunersprache" (Rotwelsch) und auch kein vermasseltes Deutsch.
Jiddisch ist eine eigenständige "schmélzsprach", eine Komponentensprache, geschöpft aus alten aramäisch-hebräischen, slawischen, romanischen und deutschen, später auch neuen hebräischen und englischen Quellen, mit eigener Semantik und Grammatik, in sich differenziert. Es ist die über die Zeiten und Wanderungen entwickelte Sprache der aschkenasischen Juden und mit ihnen "af ale kontinentn" weitergewandert. Kurz: eine Weltsprache, die eine ganze Kultur hervorgebracht hat, samt Buchmarkt, Zeitungen und Theatern, Weltliteratur - von Scholem Alejchem, "Mendele Mojcher-Ssforim", I.L. Peretz - und Sprachforschung und -normierung.
Vielleicht ist Jiddisch so faszinierend, weil es, anders als andere Weltsprachen, immer sowohl äußerlich wie innerlich mehrsprachig war. Aschkenasim nutzten im Umgang mit der Außenwelt zusätzlich die jeweilige Landessprache, aber untereinander sowohl Jiddisch wie Hebräisch: als "Umgangssprache" und als "Hochsprache". Diese innere Hierarchisierung führte dazu, dass Jiddisch auch unter Juden einen Ruch des Niederen hatte - Stoff für "zóreß" aller Art. Zionisten in Palästina, später Israel galt Jiddisch als Symbol für Vergangenes, sie setzten mit allen Mitteln Hebräisch durch. Die jüdischen Aufklärer wie Moses Mendelssohn hatten, kurz gesagt: "Redet Deutsch!" gefordert. Das Jiddische lebt also in ständiger innerer und äußerer Reibung, und die zwingt zu kämpferischem Einfallsreichtum und Gewitztheit.
Ohne die jeweiligen äußeren und inneren historischen Zusammenhänge ist seine Geschichte nicht verstehbar. Marion Aptroot und Roland Gruschka erzählen sie - von den nachweisbaren Anfängen bis heute - tatsächlich so komplex, aber überhaupt nicht kompliziert, sondern wunderbar transparent und verlockend. Ihre "GESCHICHTE UND KULTUR EINER WELTSPRACHE" wird das Interesse am Jiddischen mit Sicherheit weiter vergrößern.
Besprochen von Pieke Biermann
Marion Aptroot/Roland Gruschka: Jiddisch - Geschichte und Kultur einer Weltsprache
Verlag C. H. Beck, München 2010
192 Seiten, 11,95 EUR