Ein rührender Träumer
In der ausführlichen und einfühlsamen Biografie von Ingar Sletten Kolloen wird deutlich, wie aus dem lebensgierigen Jüngling Knut Hamsun, aus kleinen Verhältnissen und voller Vorurteile, eine abendländische Ikone werden konnte
Es ähnelt einer Ausgrabung. Ein Schatz wird wieder ans Licht gehoben, und obwohl der alt und fast vergessen ist, sehen wir ihn mit neuen, erstaunten Augen. Knut Hamsuns gewaltiges und geniales literarisches Oeuvre wird wieder bewusst und lesbar gemacht. Mehr als 20 Romane, darunter die großen Romane, wie "Hunger", "Pan", "Mysterien", bis hin zu seinem letzten mit über 90 verfassten letzten Roman, "Nach Jahr und Tag".
In der ausführlichen und einfühlsamen Biografie von Ingar Sletten Kolloen wird deutlich, wie aus einem lebensgierigen Jüngling, aus kleinen Verhältnissen und voller Vorurteile, eine abendländische Ikone werden konnte. Eines seiner Vorurteile allerdings wollte Hamsun nie ablegen - vielleicht auch weil es gar kein Vor-, sondern ein Nachurteil war: Seine Abneigung gegen die Engländer. Sie und vielleicht auch die Amerikaner waren für ihn die Propheten des Geldes und des Kapitalismus.
"Sein Misstrauen hatten ihm schon Vater und Großvater eingeflößt. Auch später noch sollten die Briten ihm sehr oft Anlass geben, sich beleidigt zu fühlen. In einem Brief ... beklagt er, 'daß Gladstone, - die bigotte, alte Kuh – auch in diesem Jahr leider nicht an der Grippe gestorben ist. Es gibt also nur wenig Hoffnung.'"
Mit Hamsuns Werk wird die gesamte nordische Welt wieder lebendig: Grieg, Munch, Strindberg, Lagerlöf, Ibsen, Sibelius. Die musste sich ohnehin zu oft und zu lang im Schatten der englischen Literatur ducken. Zu lange überdeckte auch der vermeintliche Nationalsozialist den genialen Autor. Auch das korrigiert Kolloen in seiner Biografie. Jedenfalls macht man sich jetzt nicht mehr politisch verdächtig, wenn man Hamsuns Namen in den Mund nimmt. Dass Hamsun nicht die Juden, sondern die Engländer für alles Unheil dieser Welt verantwortlich machte, sollte zu denken geben. Wichtig ist außerdem der kulturelle Kontext, das Klima, der - manchmal nur latente - Diskurs, in dem Hamsun sich bewegte und dachte. Europa war im Umbruch, es fieberte einem - irgendeinem - Aufbruch entgegen.
"Hamsuns Verachtung der Volksvertreter wuchs in diesen Jahren, als alle das Wahlrecht erhielten und es auch wahrnahmen. Das Parteiwesen war zur Arena der Belanglosigkeiten geworden, dort tummelten sich politische Rosstäuscher und Karrieristen, tobte er. Er war verbittert, weil das Wahlrecht nicht die Elite nach vorn bringe. Die ging ihre eigenen Wege – im Vereinsleben, in Kunst und Wissenschaft. Das hatte er in den USA gesehen. Und das sehe er jetzt in Norwegen, behauptete er. Seine Angriffe richteten sich auch gegen die Kleinbauern. Denn der Zeitgeist mache viele von ihnen zu genussüchtigen Konsumenten und unerträglichen Parvenüs. Das Leben müsse wieder in erträgliche Bahnen gelenkt werden. Er wartete auf jemanden, der mit unerbittlicher Härte die aus den Angeln gehobene Welt wieder einhängte."
Schon um 1900 gab es jene Kulturrevolution, in deren Nachfolge wir uns noch heute bewegen. Eine Melange aus Expressionismus, Dadaismus, Kubismus und Jugendbewegung; es gab George und Spengler und Joyce und Tzsara. Daneben noch andere einflussreiche Intellektuelle, die ihr Denken politisch begründeten, vor allem die Kommunisten. Dann aber eben auch jene, die dem Nationalsozialismus nahe standen: Ferdinand Céline, dekorierter Kriegsheld wie Ernst Jünger, und der Autor von "Voyage au bout de la nuit"; natürlich auch Marinetti, der Autor des "Manifests des Futurismus", erschienen im Figaro, in Paris, im Februar 1909 - dem Gottfried Benn, am 29. März 1934 anlässlich eines Empfangs der "Union Nationaler Schriftsteller" in Berlin eine inzwischen vergessene Rede hielt. Oder Ezra Pound, einer der Erfinder der modernen Lyrik. Ihm, ihrem Landsmann, haben die Amerikaner seine 'Cantos' verübelt, in denen er das Finanzkapital für das Unheil dieser Welt verantwortlich macht. Sie steckten ihn in einen Stahlkäfig, dessen Gitter in der Nacht vor seiner Einlieferung noch eigens verstärkt worden waren. Dabei argumentierte Pound genau so wie die Kritiker des Finanzkapitals es heute auch tun und die keiner in einen Stahl-Käfig steckt.
Vor einigen Jahren haben wir uns mit der Biografie von Grass und Walser und Höllerer, von Jens und Habermas befassen müssen. Sollten die alle in den Stahlkäfig? Entscheidend ist hier doch die Frage nach deren Gesellschaftsbild, dessen gemeinsamem Nenner. Wenn es tatsächlich einen gibt, dann diesen: Sie alle waren – und sind – sozialistisch. Damit sind sie nicht unbedingt Marxisten, aber vielleicht darf man eine sozialistische Grundidee in jener ganzen Generation vermuten. Die in der Tagespolitik blutigen Antipoden bleiben in ihrem Hass auf die Moderne offenbar ideologisch innig verbrüdert. Die Kopplung von national und sozialistisch ist zwar nicht ganz falsch, muss aber offenbar jeweils unterschiedlich gewichtet werden.
Hamsun jedenfalls war weder national noch sozialistisch. Er war eigentlich nur, wenn man diesen Begriff so prägen will, genial-erratisch, ein rührender Träumer. Er liebte die Natur, die Deutschen und seine Kinder, er hasste die Engländer und Henrik Ibsen. Das war’s. Kolloen macht dieses archaische Weltbild deutlich, indem er Hamsun zitiert:
"Und da ich auf dem Land und bei den Herden groß wurde, weiß ich auch noch, was Heimat ist. Großstadt, Industrialismus, Intellektualismus, alle Schatten, die das Zeitalter über meine Gedanken warf, alle Mächte des Jahrhunderts, denen ich mich in meiner Produktion stellte, es gibt Augenblicke, wo dieses ganze gequälte Leben versinkt, und nichts ist da als die Ebene, die Weite, Jahreszeiten, Erde, einfache Worte ...Volk."
Dieses Weltbild war es, das ihn in die Nähe des Nationalsozialismus führte, die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen, dem Einfachen, das er dort zu erkennen glaubte, nach Heimat. Aber ist es nicht auch diese selbe Sehnsucht, die im Marxismus verborgen liegt, vielleicht nur lauert, auch wenn der seine Magie immer mehr verliert? Schon Alfred Döblin, Fritz Lang und John dos Passos zeichneten die Großstadt als Moloch. Und die Grünen dachten wohl auch einst so, als sie noch dachten und nicht nur taktierten. Und die Wutbürger von Stuttgart, träumen nicht auch sie, wie Hamsun, von der unberührten Natur?
"Von meiner Hütte konnte ich einen Wirrwarr von Inseln und Holmen und Schären sehen, ein wenig von der See, einige blauende Berggipfel; und hinter der Hütte lag der Wald, ein ungeheurer Wald. Ich ward voll Freude und Dank bei dem Duft von Wurzeln und von dem fetten Dunst der Kiefer, der an den Geruch von Mark erinnert; erst im Wald kam alles zur Ruhe in mir, meine Seele wurde ausgeglichen und voller Macht."
In diesen Diskurs, in diese Utopie gehört Hamsun, obwohl er es so wohl nicht verstand. Wutbürger war er allemal. Der wuchernde Zement der Großstadt, die versteinerten menschlichen Verhältnisse, die haben auch ihn verschreckt. Vielleicht wollte auch er sie einreißen, wenn er nur gewusst hätte, wie.
Ingar Sletten Kolloen: Knut Hamsun. Schwärmer und Eroberer
Übersetzt von Gabriele Haefs
Landt Verlag, Berlin 2011
In der ausführlichen und einfühlsamen Biografie von Ingar Sletten Kolloen wird deutlich, wie aus einem lebensgierigen Jüngling, aus kleinen Verhältnissen und voller Vorurteile, eine abendländische Ikone werden konnte. Eines seiner Vorurteile allerdings wollte Hamsun nie ablegen - vielleicht auch weil es gar kein Vor-, sondern ein Nachurteil war: Seine Abneigung gegen die Engländer. Sie und vielleicht auch die Amerikaner waren für ihn die Propheten des Geldes und des Kapitalismus.
"Sein Misstrauen hatten ihm schon Vater und Großvater eingeflößt. Auch später noch sollten die Briten ihm sehr oft Anlass geben, sich beleidigt zu fühlen. In einem Brief ... beklagt er, 'daß Gladstone, - die bigotte, alte Kuh – auch in diesem Jahr leider nicht an der Grippe gestorben ist. Es gibt also nur wenig Hoffnung.'"
Mit Hamsuns Werk wird die gesamte nordische Welt wieder lebendig: Grieg, Munch, Strindberg, Lagerlöf, Ibsen, Sibelius. Die musste sich ohnehin zu oft und zu lang im Schatten der englischen Literatur ducken. Zu lange überdeckte auch der vermeintliche Nationalsozialist den genialen Autor. Auch das korrigiert Kolloen in seiner Biografie. Jedenfalls macht man sich jetzt nicht mehr politisch verdächtig, wenn man Hamsuns Namen in den Mund nimmt. Dass Hamsun nicht die Juden, sondern die Engländer für alles Unheil dieser Welt verantwortlich machte, sollte zu denken geben. Wichtig ist außerdem der kulturelle Kontext, das Klima, der - manchmal nur latente - Diskurs, in dem Hamsun sich bewegte und dachte. Europa war im Umbruch, es fieberte einem - irgendeinem - Aufbruch entgegen.
"Hamsuns Verachtung der Volksvertreter wuchs in diesen Jahren, als alle das Wahlrecht erhielten und es auch wahrnahmen. Das Parteiwesen war zur Arena der Belanglosigkeiten geworden, dort tummelten sich politische Rosstäuscher und Karrieristen, tobte er. Er war verbittert, weil das Wahlrecht nicht die Elite nach vorn bringe. Die ging ihre eigenen Wege – im Vereinsleben, in Kunst und Wissenschaft. Das hatte er in den USA gesehen. Und das sehe er jetzt in Norwegen, behauptete er. Seine Angriffe richteten sich auch gegen die Kleinbauern. Denn der Zeitgeist mache viele von ihnen zu genussüchtigen Konsumenten und unerträglichen Parvenüs. Das Leben müsse wieder in erträgliche Bahnen gelenkt werden. Er wartete auf jemanden, der mit unerbittlicher Härte die aus den Angeln gehobene Welt wieder einhängte."
Schon um 1900 gab es jene Kulturrevolution, in deren Nachfolge wir uns noch heute bewegen. Eine Melange aus Expressionismus, Dadaismus, Kubismus und Jugendbewegung; es gab George und Spengler und Joyce und Tzsara. Daneben noch andere einflussreiche Intellektuelle, die ihr Denken politisch begründeten, vor allem die Kommunisten. Dann aber eben auch jene, die dem Nationalsozialismus nahe standen: Ferdinand Céline, dekorierter Kriegsheld wie Ernst Jünger, und der Autor von "Voyage au bout de la nuit"; natürlich auch Marinetti, der Autor des "Manifests des Futurismus", erschienen im Figaro, in Paris, im Februar 1909 - dem Gottfried Benn, am 29. März 1934 anlässlich eines Empfangs der "Union Nationaler Schriftsteller" in Berlin eine inzwischen vergessene Rede hielt. Oder Ezra Pound, einer der Erfinder der modernen Lyrik. Ihm, ihrem Landsmann, haben die Amerikaner seine 'Cantos' verübelt, in denen er das Finanzkapital für das Unheil dieser Welt verantwortlich macht. Sie steckten ihn in einen Stahlkäfig, dessen Gitter in der Nacht vor seiner Einlieferung noch eigens verstärkt worden waren. Dabei argumentierte Pound genau so wie die Kritiker des Finanzkapitals es heute auch tun und die keiner in einen Stahl-Käfig steckt.
Vor einigen Jahren haben wir uns mit der Biografie von Grass und Walser und Höllerer, von Jens und Habermas befassen müssen. Sollten die alle in den Stahlkäfig? Entscheidend ist hier doch die Frage nach deren Gesellschaftsbild, dessen gemeinsamem Nenner. Wenn es tatsächlich einen gibt, dann diesen: Sie alle waren – und sind – sozialistisch. Damit sind sie nicht unbedingt Marxisten, aber vielleicht darf man eine sozialistische Grundidee in jener ganzen Generation vermuten. Die in der Tagespolitik blutigen Antipoden bleiben in ihrem Hass auf die Moderne offenbar ideologisch innig verbrüdert. Die Kopplung von national und sozialistisch ist zwar nicht ganz falsch, muss aber offenbar jeweils unterschiedlich gewichtet werden.
Hamsun jedenfalls war weder national noch sozialistisch. Er war eigentlich nur, wenn man diesen Begriff so prägen will, genial-erratisch, ein rührender Träumer. Er liebte die Natur, die Deutschen und seine Kinder, er hasste die Engländer und Henrik Ibsen. Das war’s. Kolloen macht dieses archaische Weltbild deutlich, indem er Hamsun zitiert:
"Und da ich auf dem Land und bei den Herden groß wurde, weiß ich auch noch, was Heimat ist. Großstadt, Industrialismus, Intellektualismus, alle Schatten, die das Zeitalter über meine Gedanken warf, alle Mächte des Jahrhunderts, denen ich mich in meiner Produktion stellte, es gibt Augenblicke, wo dieses ganze gequälte Leben versinkt, und nichts ist da als die Ebene, die Weite, Jahreszeiten, Erde, einfache Worte ...Volk."
Dieses Weltbild war es, das ihn in die Nähe des Nationalsozialismus führte, die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen, dem Einfachen, das er dort zu erkennen glaubte, nach Heimat. Aber ist es nicht auch diese selbe Sehnsucht, die im Marxismus verborgen liegt, vielleicht nur lauert, auch wenn der seine Magie immer mehr verliert? Schon Alfred Döblin, Fritz Lang und John dos Passos zeichneten die Großstadt als Moloch. Und die Grünen dachten wohl auch einst so, als sie noch dachten und nicht nur taktierten. Und die Wutbürger von Stuttgart, träumen nicht auch sie, wie Hamsun, von der unberührten Natur?
"Von meiner Hütte konnte ich einen Wirrwarr von Inseln und Holmen und Schären sehen, ein wenig von der See, einige blauende Berggipfel; und hinter der Hütte lag der Wald, ein ungeheurer Wald. Ich ward voll Freude und Dank bei dem Duft von Wurzeln und von dem fetten Dunst der Kiefer, der an den Geruch von Mark erinnert; erst im Wald kam alles zur Ruhe in mir, meine Seele wurde ausgeglichen und voller Macht."
In diesen Diskurs, in diese Utopie gehört Hamsun, obwohl er es so wohl nicht verstand. Wutbürger war er allemal. Der wuchernde Zement der Großstadt, die versteinerten menschlichen Verhältnisse, die haben auch ihn verschreckt. Vielleicht wollte auch er sie einreißen, wenn er nur gewusst hätte, wie.
Ingar Sletten Kolloen: Knut Hamsun. Schwärmer und Eroberer
Übersetzt von Gabriele Haefs
Landt Verlag, Berlin 2011
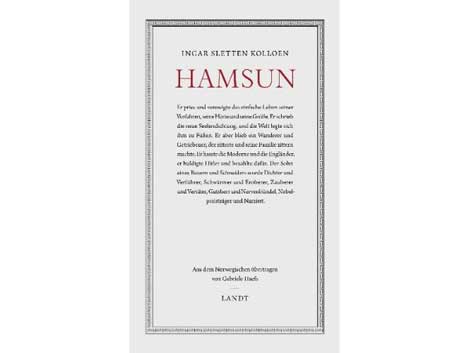
Cover: "Knut Hamsun. Schwärmer und Eroberer" von Ingar Sletten Kolloen© Landt Verlag
