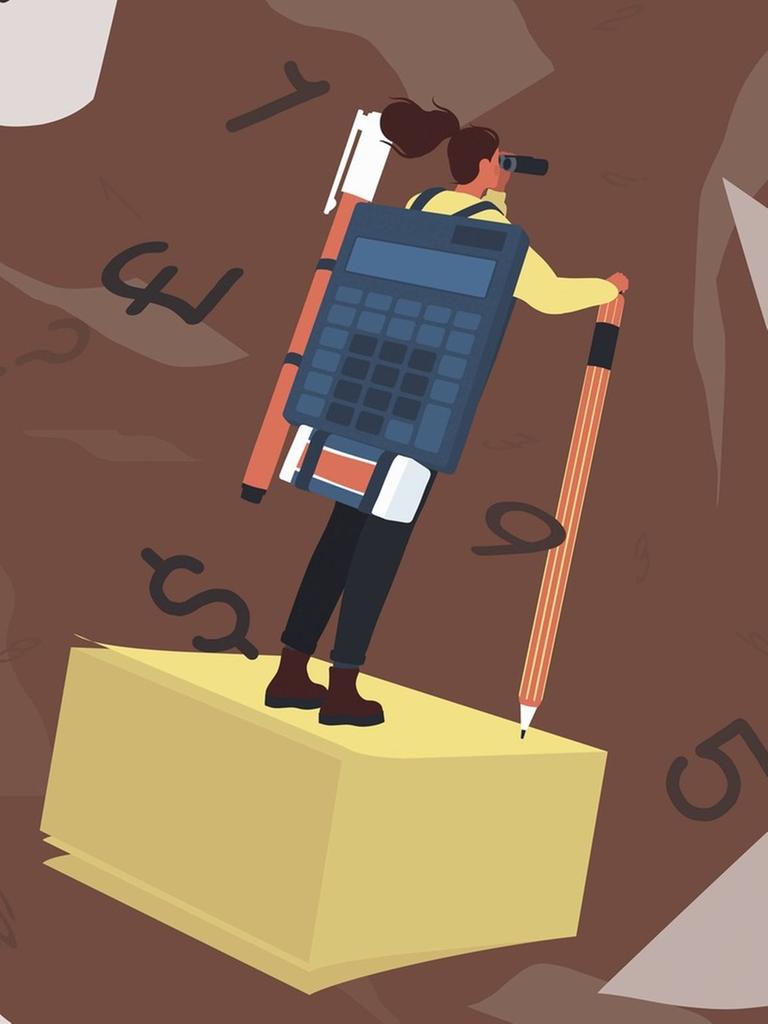Ungleichheit und Fake News

Was bedeutet "wehrhafte Demokratie"? © Getty Images / iStockphoto / teddyandmia
Demokratie wehrhaft machen
37:02 Minuten

Die Demokratie ist weltweit in Bedrängnis – auch hierzulande: Politikverdrossenheit, autoritäre Tendenzen und gesellschaftliche Polarisierung. Könnte eine Vertiefung der Demokratie sie stabilisieren? Und welche Möglichkeiten dafür gibt es?
Nicht nur global gesehen steht die Demokratie unter Druck, etwa durch den Aufstieg autoritärer Systeme oder den Krieg in der Ukraine. Auch in Deutschland selbst gibt es Grund zur Sorge: Antidemokratische Bewegungen und Parteien haben Zulauf, viele Menschen fühlen sich von der Politik enttäuscht und große Transformationen wie Klimawende oder Digitalisierung fordern unsere Regierungsform heraus. Die „wehrhafte Demokratie“ ist deshalb Jahresthema der Deutschlandradio-Denkfabrik.
Aber wie kann sich die Demokratie gegen ihre innere Krise zur Wehr setzen? Klar ist: Sie darf sich selbst nur mit demokratischen Mitteln verteidigen. Hilft also ein Mehr an Demokratie, um sie stabiler zu machen? Und wie könnte eine Vertiefung aussehen? Die Antworten auf diese Frage hängen davon ab, wo man die größten Schwächen unserer Gegenwartsdemokratie verortet. Vier Perspektiven auf mögliche Ansätze.
1. Entfremdung von der Demokratie: Frühere Einübung
Demokratie ist nicht nur ein Abstimmungssystem, sondern auch eine Lebensweise: Damit sie dauerhaft stabil bleibt, müssen die Bürgerinnen und Bürger nicht nur alle vier Jahre ihr Kreuz machen, sondern demokratische Prinzipien verinnerlichen. Dafür sollten sie in ihrem Alltag die Erfahrung machen, dass sie mit anderen zusammen die eigene Lebenswelt gestalten können.
Eine Möglichkeit, unser demokratisches Selbstverständnis zu stärken, wäre eine stärkere Demokratisierung der Schulen: Schülerinnen und Schüler könnten schon frühzeitig dazu ermuntert werden, ihre Ausbildungsorte mitzugestalten – etwa durch Schulparlamente, wie es sie stellenweise bereits gibt. Wird das flächendeckend umgesetzt und erhält das Parlament tatsächliche Befugnisse, machen junge Menschen die Erfahrung, dass sie sich in Entscheidungen einbringen können und dass das einen Unterschied macht. Sie entwickeln ein Bewusstsein von demokratischen Rechten und Pflichten, lernen, andere Perspektiven zu respektieren und Kompromisse zu finden. So die Idee.
Allerdings ist fraglich, ob solche Parlamente auf Schulebene tatsächlich alle Jugendlichen gleichermaßen erreichen – auch die aus ärmeren, weniger gebildeten Familien. Denn von Mitsprache-Angeboten fühlen sich oft vor allem Menschen aus bildungsnahen Schichten angesprochen.
2. Zu große Ungleichheit: Bessere Sozialpolitik
Mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung sind also schön und gut. Aber erreichen sie auch alle? Der Politikwissenschaftler und Demokratieforscher Wolfgang Merkel bezweifelt das. Er spricht von einer Tendenz hin zu einer „Zweidrittel-Demokratie“ in Deutschland: Das sozial und ökonomisch „untere“ Drittel der Gesellschaft ist demnach politisch deutlich schlechter repräsentiert als die zwei oberen Drittel. Und das gleich doppelt: Die Wahlbeteiligung ist hier signifikant niedriger und die Interessen dieser Gruppe sind in den Parteiprogrammen weniger vertreten.
Soziale Ungleichheit übersetzt sich demnach in politische Ungleichheit. Daran können Partizipationsmöglichkeiten allein nichts ändern. Merkel empfiehlt daher eine Vertiefung der Sozialpolitik. Wirkt man sozialem und kulturellem Ausschluss entgegen, könnte das gleichzeitig zu mehr politischer Gleichheit führen. Denn die Verbesserung der sozialen und ökonomischen Lage jenes „unteren Drittels“ könnte dafür sorgen, dass die betroffenen Menschen sich politisch besser vertreten fühlen, den Glauben in die Politik und in demokratische Prozesse zurückgewinnen.
Zuletzt hat in Deutschland allerdings vor allem die demokratiefeindliche Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) ehemalige Nichtwählerinnen und Nichtwähler mobilisieren können. Das kann man als Indiz dafür sehen, dass ein Mehr an Beteiligung die Demokratie nicht unbedingt stabilisieren muss. Man kann es aber auch als Bestätigung der Thesen von Wolfgang Merkel und des Wirtschaftswissenschaftlers Thomas Piketty lesen: Die anderen Parteien haben zu wenig für diese Gruppe getan und deshalb ist sie nun in besonderem Maße anfällig für rechtspopulistische Versprechen.
3. Zu starke Lobbyinteressen: Die Wirtschaft demokratisieren
Ein weiteres Problem der gegenwärtigen Demokratie kann man darin sehen, dass der tatsächliche Einfluss auf die Gestaltung unserer Gesellschaft stark vom Vermögen der Menschen abhängt – die Kluft zwischen Arm und Reich ist groß, gerade die Vermögensungleichheit hat zuletzt noch zugenommen.
Das betrifft Parteien- und Wahlkampfspenden oder das Sponsoring von Parteitagen, aber auch finanzstarke Lobbyorganisationen, die die Interessen bestimmter Wirtschaftszweige oder gesellschaftlicher Gruppen durchsetzen. Während Umfragen etwa zeigen, dass sich eine Mehrheit in Deutschland wirksameren Klimaschutz wünscht, wirken Lobbyinteressen auf Unternehmensseite dem oft entgegen.
Dagegen helfen könnte eine ganze Reihe von Maßnahmen: Das neue Lobbyregister, das Treffen von Abgeordneten und Wirtschaftsvertretern transparent macht; die Begrenzung von Parteispenden; oder Maßnahmen gegen die Vermögensungleichheit, wie etwa eine Reform der Erbschaftssteuer.
Ein weitreichender Vorschlag ist die Demokratisierung der Unternehmen selbst. Die fordert das „Manifest zur Zukunft der Arbeit“, das die Philosophin Lisa Herzog mitverfasst hat. Demnach sollen die Beschäftigten direkt an der Unternehmensführung beteiligt werden. Wenn die Belegschaft die Unternehmen mitgestalten, so die Überlegung, können sie unmittelbar auf Unternehmensziele Einfluss nehmen – und neben der Maximierung des Profits andere Ziele einbringen. Dazu gehören zum Beispiel Arbeitsbedingungen, aber auch Nachhaltigkeitskriterien.
Unklar ist allerdings, ob Angestellte etwa eines Energiekonzerns ihrem Arbeitgeber tatsächlich strengere Klimakriterien oder einen weniger aggressiven Wachstumskurs abringen würden – stehen doch ihre Arbeitsplätze auf dem Spiel.
Geht es um Fragen, die das Allgemeinwohl betreffen – wie zum Beispiel die Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen – sollten diese maßgeblich Gegenstand gesellschaftlicher Entscheidungsfindung sein, meint daher etwa die Sozialphilosophin Rahel Jaeggi. Sie kritisiert, dass in unserer Gegenwartsdemokratie wichtige Gemeinwohlfragen dem demokratischen Raum entzogen bleiben.
4. Zersplitterte Öffentlichkeit: Fake News bekämpfen
Während diese Perspektive die sozialen und materiellen Bedingungen der Demokratie hervorhebt, geht es liberaler Theorie eher um die Frage, wie unsere demokratische Öffentlichkeit verfasst sein sollte. Eine Demokratie braucht ihr zufolge vor allem mündige Bürgerinnen und Bürger, die auf Grundlage einer breiten Informationsbasis zu vernünftigen Entscheidungen kommen – und dabei nicht nur die eigenen Interessen berücksichtigen, sondern auch die Perspektiven anderer Menschen respektieren. Das betonte etwa der US-amerikanische Philosoph John Dewey Anfang des 20. Jahrhunderts.
Auch Jürgen Habermas zufolge kommt den Medien dabei eine entscheidende Bedeutung zu: Sie müssen umfassende Informationen bereitstellen, der Wahrheit verpflichtet sein, eine Vielfalt an Perspektiven abdecken und eine ausgewogene Debatte ermöglichen; uns Bürgerinnen und Bürgern also in die Lage versetzen, vernünftige Entscheidungen zu treffen.
Die Verbreitung von Fake News im Netz und die Verrohung des Diskurses in den sozialen Medien ist aus dieser Perspektive ein Beispiel dafür, dass mehr Partizipation allein nicht unbedingt zu mehr Demokratie führt – sondern sie auch destabilisieren kann, wenn sie die Grundlagen demokratischer Kultur selbst untergräbt. Um die Demokratie zu verteidigen, braucht es demnach vor allem verlässliche Informationsquellen und eine an Vernunftkriterien orientierte Diskussionskultur.
Quellen: ch, mit Einschätzungen von Simone Miller, Catherine Newmark und Wolfram Eilenberger