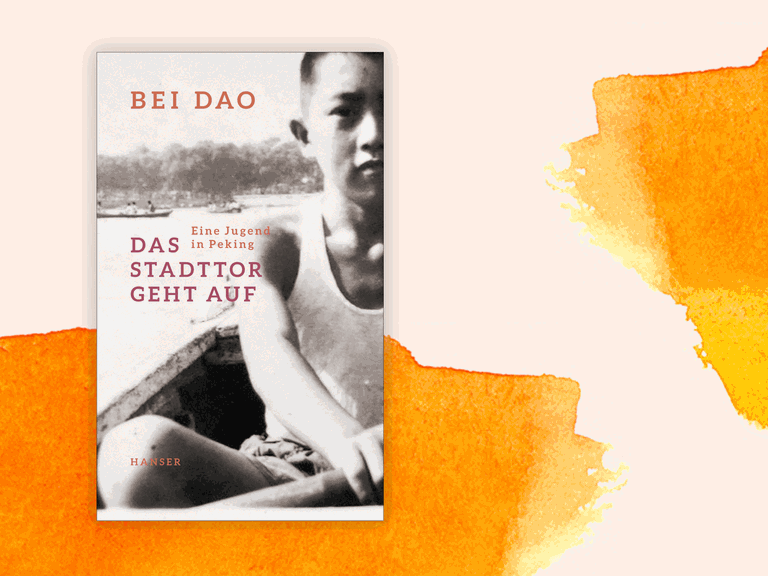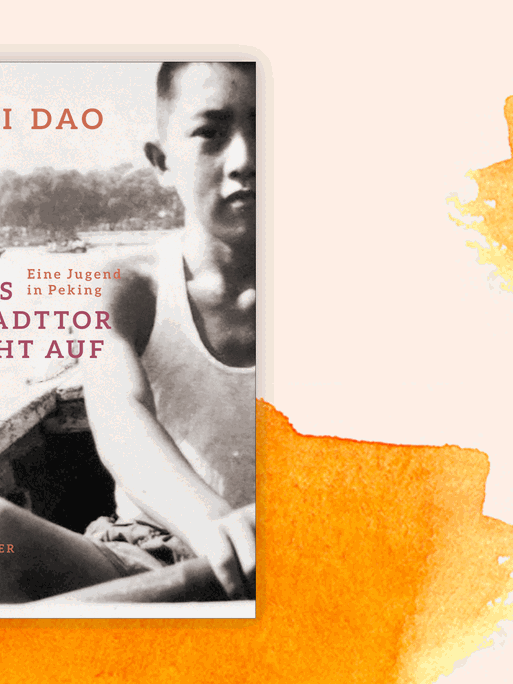Dai Sijie: "Die lange Reise des Yong Sheng"
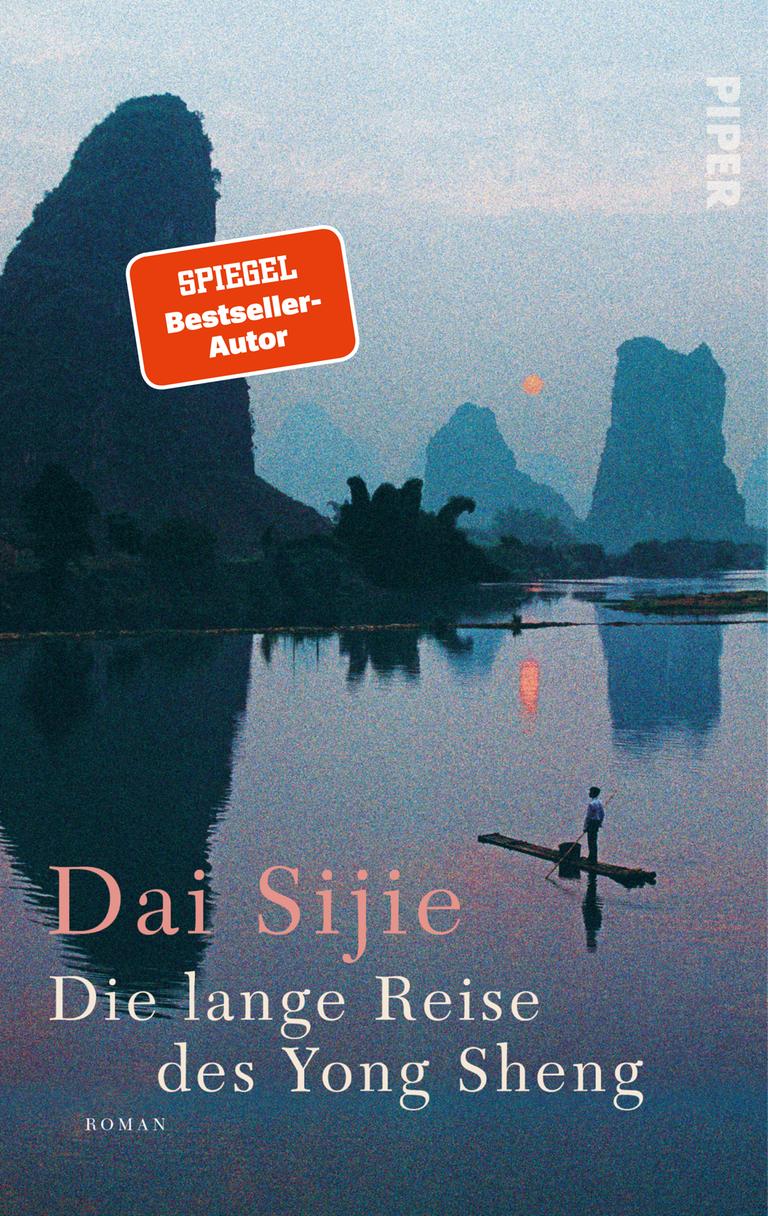
© Piper Verlag
Chinesischer Pastor zwischen Ost und West
05:58 Minuten
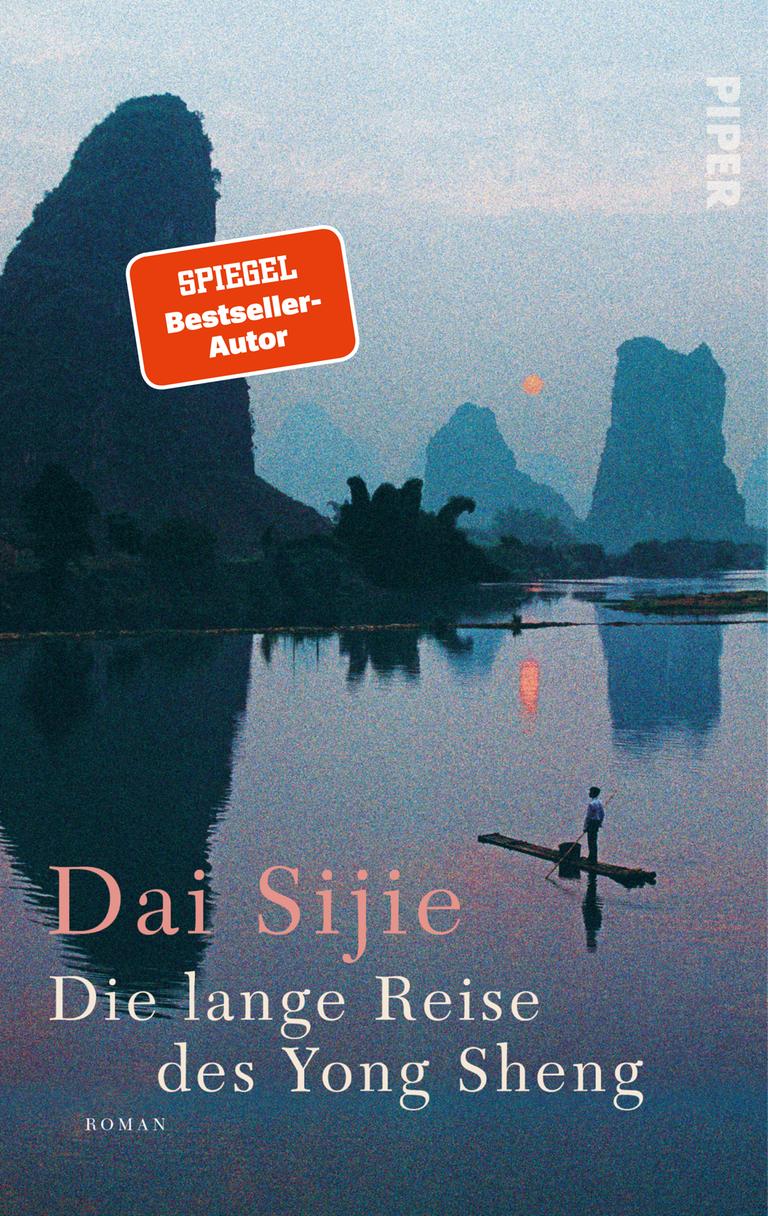
Dai Sijie
Übersetzt von Claudia Marquardt
Die lange Reise des Yong ShengPiper, München 2022432 Seiten
24,00 Euro
Der chinesische Autor Dai Sije erzählt die Lebensgeschichte seines Großvaters. Der streift immer wieder die bedeutenden Ereignissen des 20. Jahrhunderts und findet seinen Weg zwischen westlicher und östlicher Spiritualität.
Ganz am Ende, da hat der Held von Dai Sijies neuem Roman nur noch wenige Minuten zu leben, wird seine wirklich lange Reise aufs Knappste zusammengefasst: Yong Sheng, heißt es da, „einer der besten Hersteller von Taubenflöten, ehemaliger Student an der theologischen Fakultät in Nanjing, erster chinesischer Pastor Putians, Leiter eines Waisenhauses und Arbeiter in einer Ölmühle“.
Westliche Theologie und östliche Weisheiten
Nun wäre der chinesische Autor Dai Sije, der lang in Frankreich lebte und auf Französisch schreibt, nicht der Erzähler, als den wir ihn kennen, wenn nicht jede dieser Lebensphasen mit sinnlichen Bildern, poetischen Dimensionen und historischen Assoziationen verknüpft wäre. Die uralte Kultur der Taubenflötenschnitzerei beherrscht kaum noch einer in diesem 20. Jahrhundert, dem der Roman chronologisch folgt.
Die westliche Theologie gebiert inmitten östlicher Weisheiten ihre eigenen Evangelien – so lautet der Originaltitel denn auch "L´Èvangeile selon Yong Sheng", auf Deutsch wäre das: Das Evangelium nach Yong Sheng. Die Begegnung, Vermengung und gegenseitige Befruchtung westlicher und östlicher Spiritualität wird zu einem der zentralen Topoi seiner Geschichte.
Eine Lebensdramaturgie wie ausgedacht
Schließlich sind es die Volten des Schicksals, die Yong Sheng tatsächlich zum Pastor werden und die ihn sein Haus zum Waisenhaus machen lassen, in dem er den Kindern zeigt, dass er zaubern kann. Hinter der vermeintlich harmlosen Arbeit in der Ölmühle verbirgt sich jahrelange Demütigung und grausamste Folter während der Kulturrevolution.
Ja, Yong Sheng kommt, wie er es einmal formuliert, „mit der großen Geschichte“ in Berührung, aber: „Die große Geschichte, das war für ihn das Gegenteil von Realität. Ihre Dramaturgie ähnelte in seinen Augen eher einer Fiktion.“
Nach der wahren Biografie des Großvaters
Damit ist Dai Sijies Poetik umrissen. Schon in seinem Welterfolg "Balzac und die kleine chinesische Schneiderin" (2001) hat er autobiografische Erlebnisse (damals die Verbannung während der Kulturrevolution) vor welthistorischer Kulisse zu einer poetisch-sinnlichen Fabel zwischen den Welten verdichtet. Diesmal sind es nicht eigene Erlebnisse, die er zu einem Mosaik Chinas im 20. Jahrhundert zusammensetzt, es ist die Geschichte seines Großvaters.
Das bedeutet eine Öffnung des erzählerischen Gestus von einer kreiselnden Konzentration um eine poetische Idee zu einer perspektivischen Linie, die auch eine historische ist, in der Ereignisgeschichte und Biografie zusammenfallen. So spielt wie in vielen biografisch ausgerichteten Romanen die Geschichte die Hauptrolle, wie sie sich im Leben dessen spiegelt, von dem hier erzählt wird.
Erzählt mit betörender Sinnlichkeit
Die dramaturgische Kunst des Erzählers zeigt sich also nicht in den Wendungen des Geschehens, die sind vorgegeben, sondern in der Art und Weise, in der ihnen eine übers Biografische hinausgehende poetische Dimension erschlossen wird.
Das gelingt in den verschiedenen Lebensphasen dieser sehr langen Reise unterschiedlich intensiv und blüht erzählerisch vor allem dann auf, wenn Dai Sijie Bilder findet, die seine beiden großen Themen sinnfällig werden lassen: die Begegnung der Kulturen und die überzeitliche betörende Kraft der Sinnlichkeit.