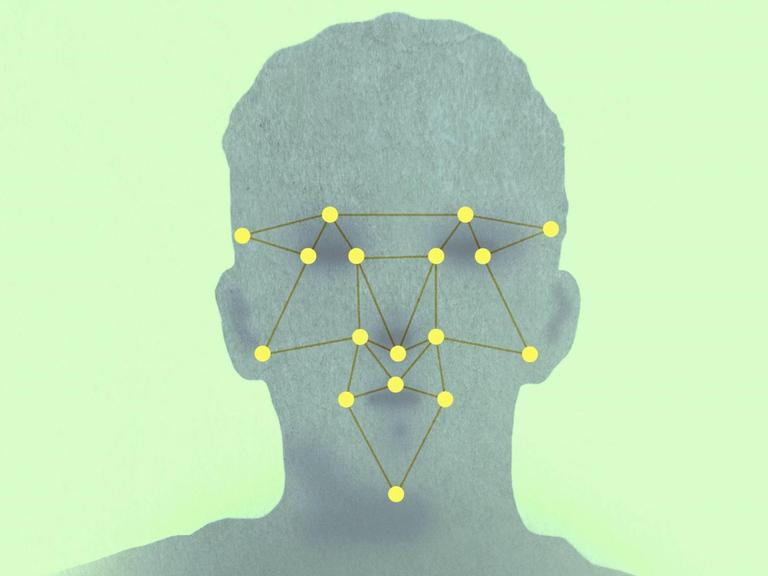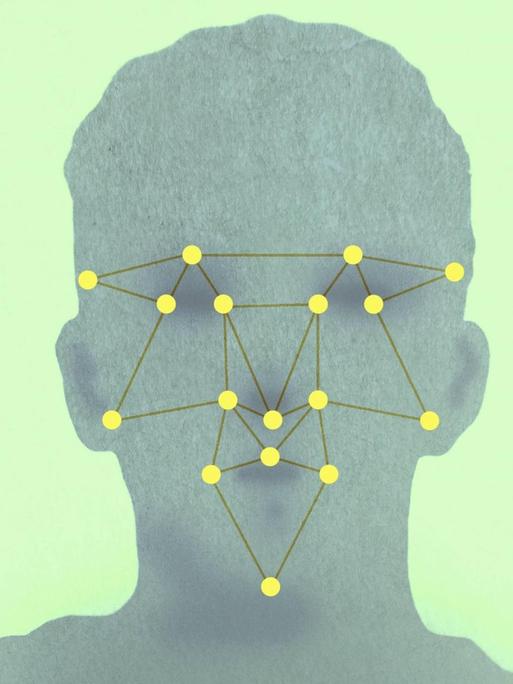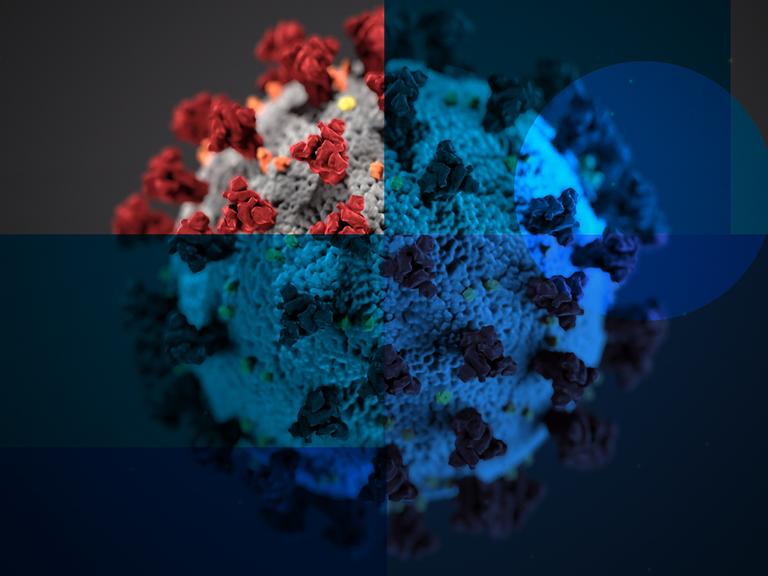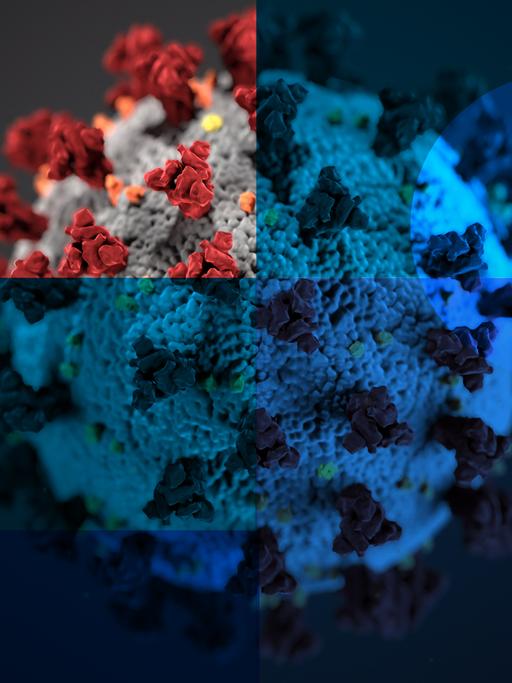Erstaunlich reibungslos für ein Regierungsprojekt
14:50 Minuten

Normalerweise bekommen Digitalprojekte der Regierung reihenweise Kritik bis hin zum Shitstorm. Doch bei der Corona-App lief alles anders – auch, weil von Anfang an an Kritiker gedacht wurde.
Seit Dienstag ist es so weit: Die Corona-App ist da. Eine App, die man sich auf dem Smartphone installieren kann und die automatisiert verfolgt und warnt, wenn man sich längere Zeit in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten hat.
Über die Funktionalität und das Für und Wider wurde in den vergangenen Wochen viel gesprochen und diskutiert (auch bei uns). Doch was bisher wenig beleuchtet wurde: Die Art, wie die App in der öffentlichen Diskussion stattgefunden hat. Dabei lief diese sehr anders, als man es sonst gewohnt ist.
App ohne Aufschrei
Schaut man sich die Vergangenheit an, gab es immer einen großen Aufschrei, wenn es um digitale Großprojekte des Staates ging. Egal ob Wahlcomputer, Staatstrojaner, elektronisches Anwaltspostfach – es gab viele Proteste, die Gräben waren tief und die Positionen unüberwindlich. Zu tief saß das Misstrauen der Netzaktivisten in den Staat.
Doch jetzt stellt selbst Linus Neumann, Sprecher des sonst immer kritischen Chaos Computer Clubs, verwundert fest:
"Ich bin jetzt hier in der Situation, bei einer Veröffentlichung von SAP, Deutscher Telekom und Bundesregierung keine nennenswerten Mängel beklagen zu können. Das ist auch für mich jetzt schwierig."
Der CCC ist kein TÜV
Empfehlen möchte der CCC die App jedoch nicht. Denn es ist eben einfacher zu zeigen, wo ein Fehler liegt, als nachzuweisen, dass etwas ganz sicher funktioniert. Dirk Engling, ein weiterer Pressesprecher des Clubs, erklärt, dass sich die Hacker durchaus als Erklärer und mahnende Stimmen sehen, aber eben nicht als Prüfinstanz:
"Das ist, als ob wir als gesellschaftliche Institution sagen: ‘Es wäre schön, wenn es einen TÜV gäbe, der sich alle Autos, die auf der Straße fahren, angucken’, was dann aber nicht heißt, dass man als Organisation, die das fordert, sich jedes einzelne Auto draußen selbst angucken möchte. Das sollen dann die handwerklich begabten, nämlich die, die beim TÜV als Ingenieure arbeiten, machen und implementieren."
Auch beim TÜV ist man positiv überrascht
Etwas, das ja auch tatsächlich passiert. Denn die Corona-Warn-App wurde vom TÜVit des TÜV Nord getestet – in einer für die Prüforganisation etwas ungewohnten Art. Open Source ist dort zwar nicht ganz unbekannt, aber normalerweise können sie den Quellcode analysieren, bevor er veröffentlicht wird. Etwas, das in diesem Fall anders war.
Doch TÜVit-Geschäftsführer Dirk Kretzschmar kann der Situation durchaus etwas Positives abgewinnen. Zwar hätte er sich erst Sorgen gemacht, dass jemand anders den Code schneller analysieren könnte, als seine Leute, doch diesen Standpunkt hat er geändert:
"Letztendlich ist es ja eigentlich nur positiv, wie eine Art Unterstützung. Man ist eigentlich Teil dieser Community, versucht, dann den Code abzuarbeiten und dort Schwachstellen zu finden. Und die Veröffentlichung dieser Schwachstellen führte dann dazu, dass wir zum Beispiel bestimmte Sachen nur noch einmal selbst bestätigen mussten, statt selber darauf zu kommen."
So findet zumindest auf der technischen Ebene scheinbar ein Umdenken statt, das dazu führt, dass sowohl Politik als auch Wirtschaft zum ersten Mal in großem Maßstab die Vorteile von Open Source für sich entdecken. Die Transparenz bringt ja nicht nur technische Offenheit, sondern kann auch für Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen, weil so nachvollziehbarer ist, ob da im Code wirklich keine verborgenen Sachen stecken.
Nicht alle sind glücklich
Doch nicht alle, die an der Diskussion beteiligt waren, hatten das Gefühl, dass sich wirklich alle Seiten ein Gehör verschaffen konnten:
"Das Problem an der Debatte rund um die rechtlichen Fragen ist, dass die zunehmend komplizierter sind. Deshalb seien die technischer Einzelheiten in der Debatte vielleicht nachvollziehbar geführt worden. Wenn wir aber über rechtliche Seite sprechen: Da haben wir schlicht als Juristen ein bisschen die Zuhörerschaft verloren. Und deswegen ist der Teil einfach nicht ganz so präzise in der Debatte gehört worden – einfach, weil er nicht so leicht verdaulich ist."
Das sagt Malte Engeler, Jurist, von Beruf Richter am Verwaltungsgericht, in der Diskussion aber als Teil der Zivilgesellschaft unterwegs. Er ist Mitglied bei den Grünen und bei der Neuen Richtervereinigung und Teil einer Gruppe von Menschen, die gefordert hatten, dass die Corona-Warn-App einen eigenen gesetzlichen Rahmen erhält. (Wir berichteten)
Zu kompliziert für die öffentliche Debatte
Die Große Koalition hat dem Vorschlag, ein Gesetz für die App zu verabschieden, allerdings eine Absage erteilt. Auf der rechtlichen Seite verlief die Debatte also eher wie eine klassische netzpolitische Diskussion als auf der technischen Seite: Experten und Aktivisten mit hörenswerten Argumenten werden nicht berücksichtigt, weil die Materie zu kompliziert scheint und keine Einsicht herrscht, dass man sich mit dem Thema beschäftigen muss – oder will. Dabei ist absehbar, dass sich aus dem Fehlen eines solchen Gesetzes konkrete Nachteile ergeben, meint zumindest Engeler:
"Ich sehe aktuell sehr viele Stimmen, die berichten, dass zum Beispiel Anwälte Anfragen in der Beratung bekommen, wie man das umsetzen kann. Es gibt auch erste Unternehmen, die von Arbeitnehmenden verlangt haben, dass sie die App installieren. Und ich glaube, diese Probleme werden denn die nächsten Wochen an vielen Stellen auftauchen."
Nutzungszwang ist juristisch nicht kategorisch auszuschließen
Diese rechtliche Unklarheit führe laut Engeler dazu, dass der Einsatz der eigentlich klar als freiwillig angekündigten App vielleicht doch erzwungen werden könnte:
"Es ist auf keinen Fall so, dass es kategorisch auszuschließen ist. Das heißt, in einem gewissen Rahmen wäre es aktuell rechtlich durchaus zulässig, irgendeinen Zugang zu irgendwelchen Diensten an die Nutzung der App zu knüpfen. Für Arbeitnehmende ist es meiner Ansicht nach auch nicht kategorisch auszuschließen. Aus diesem Grund gibt es aktuell ja unter anderem auch von den Grünen klare Entwürfe für ein Gesetz, das gerade den Bereich des Arbeitsrechts regeln würde."
Und auch sonst ist es keineswegs so, dass die App unkontrovers ist. Einen guten Überblick liefert der Artikel "Handreichung: Was an und rund um die CoronaWarnApp zu kritisieren ist" des Journalisten und Algorithmwatch-Mitgründers Lorenz Matzat, in dem aufgezählt wird, welche Punkte noch offen sind.
Weg in den Solutionismus?
Derzeit wird viel über die Kosten diskutiert. So kosten Entwicklung und Betrieb über 60 Millionen Euro. Ist das zu viel? Über die Benutzbarkeit, die Fehlerquote und dass es eigentlich kein Konzept gibt, wie man den Erfolg der App misst, wird auch gestritten. Es ist ja nicht einmal klar, was die App im Endeffekt bringt – die Chancen sind nicht schlecht, dass sie helfen kann, aber wie gut, das ist noch völlig offen.
Doch die Gefahr, dass die App konkret missbraucht werden könnte, sehen die Experten eher nicht. Schließlich liege der Quellcode offen, viele Augen schauten darauf und es sei wichtig, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Software nicht verloren gehe.
Gleichzeitig könnte ein so gut laufendes, staatliches IT-Projekt Solutionismus Vorschub leisten. Also der politischen Einstellung, dass alle gesellschaftlichen Probleme technisch zu lösen seien. Da muss man also in Zukunft aufpassen, dass die Politik nicht bei jedem Problem sagt: "Hey, lasst uns eine App machen!"