Bryan Washington: "Lot. Geschichten einer Nachbarschaft"
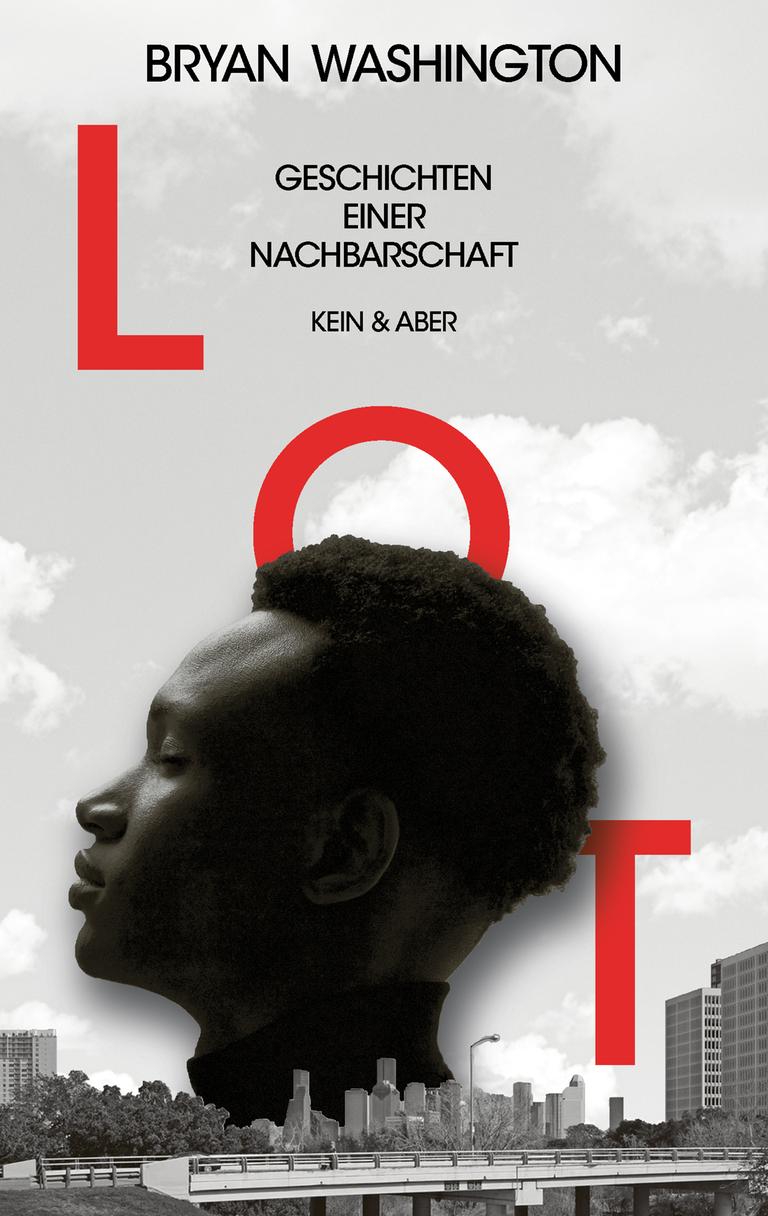
© Kein & Aber
Am Rande von Houston
07:08 Minuten
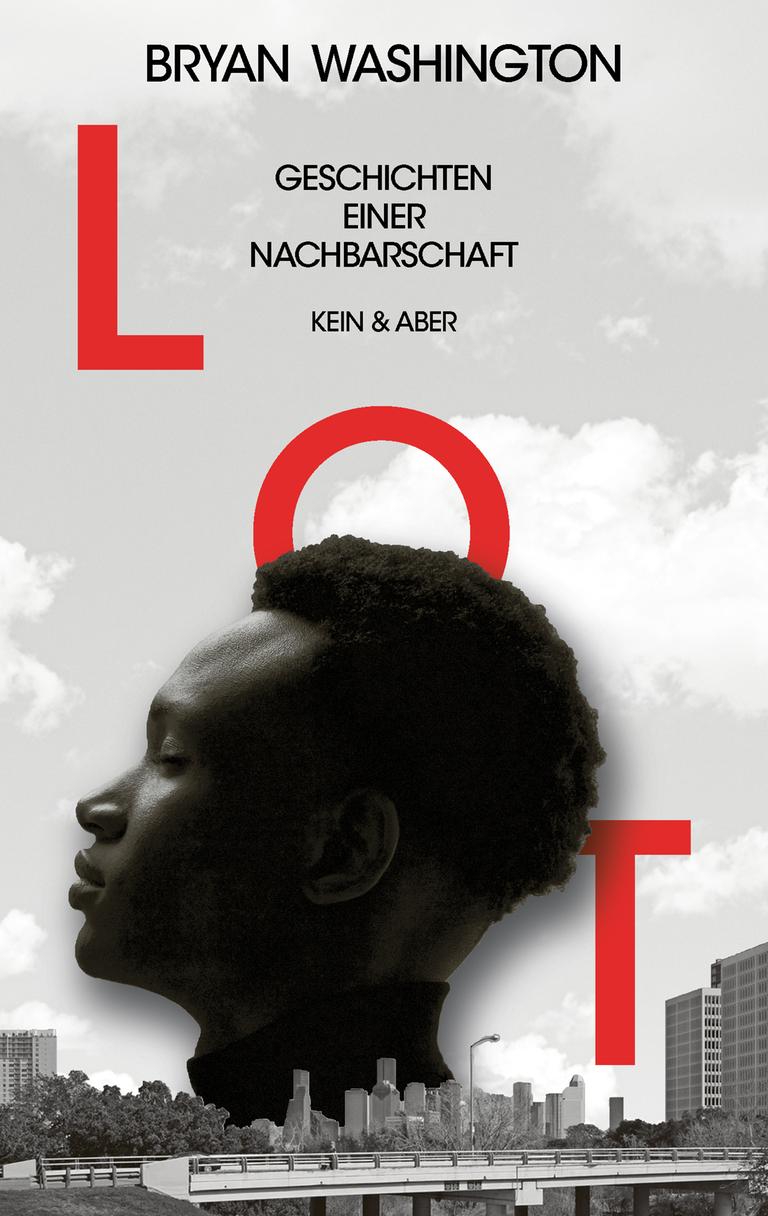
Bryan Washington
Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence
Lot. Geschichten einer NachbarschaftKein&Aber, Berlin 2022235 Seiten
23,00 Euro
Der junge afroamerikanische Schriftsteller Bryan Washington erzählt mit lakonischer Präzision von Unbehaustsein und fragilen Glücksmomenten innerhalb einer feindlichen Umwelt. Dabei verfällt er nie in eine sentimentale Solidarität mit den Ausgegrenzten.
Was man hierzulande bislang mit der texanischen Stadt Houston verbindet, ist wahrscheinlich vor allem ein als verkürztes Zitat berühmt gewordener Funkspruch: "Houston – wir haben ein Problem".
Die Protagonisten in Bryan Washingtons Erzählband „Lot“ befinden sich zwar nicht in einer Raumkapsel, könnten jedoch durchaus als „Abgehängte“ bezeichnet werden. Doch „abgehängt“ von wem oder was, da in den Randvierteln der Außenbezirke von Houston das Leben ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten zu gehorchen scheint?
Freudlos kiffende Jugendliche
Der 1993 geborene afroamerikanische Schriftsteller Bryan Washington ist in dieser weiträumigen, von stehenden Gewässern, Highways und Bahnschienen durchzogenen Gegend aufgewachsen, und seine in der Ich-Form erzählten Geschichten lassen sich (auch) autobiografisch lesen.
Ein junger Mann, Sohn einer schwarzen Mutter und eines mal an-, mal abwesenden Latino-Vaters, sucht zusammen mit seinen Brüdern einen Platz auf der Welt, die hier freilich nur in ihrer Schrumpfform als Prekariatsareal existiert. Drogenhändler und Stricher, Müll und Abfall in den verschlammten Bayous (die keineswegs „blue“ sind wie in den Schnulzen von Roy Orbison und Paola), harte Rap- oder Cumbia-Rhythmen aus alten Chevys, in denen freudlos kiffende Jugendliche hocken – sofern sie kein Crack rauchen oder einander über den Haufen schießen.
Anti-Helden werden nicht als Opfer stilisiert
Es ist die große Stärke dieser Erzählungen, dass sie keine sentimentalische „Solidarität der Ausgegrenzten“ behaupten, ihre Anti-Helden nicht zu hehren Opfern des „Systems“ stilisieren und gerade deshalb – in unscheinbaren Nebensätzen, quasi von der Seite her - Menschen erstehen lassen in ihrer Einmaligkeit und hochkomplexen Ambivalenz.
Doch keine Zeit zu aufwendigem Psychologisieren, da der schlecht bezahlte Kellnerjob bald beginnt oder Polizisten auftauchen oder die gestresste Mutter ins kleine Häuschen zurückkehrt, wo einer ihrer Söhne gerade mit dem Nachbarsjungen ...
Was derart hastig vonstattengeht, ist indessen mit einer geradezu unglaublichen Ruhe erzählt und wird in manchen Momenten sogar überraschend emotional. So etwa, wenn ein Stricher sich plötzlich in einen Kunden verliebt, jedoch vor allem darauf bedacht ist, dass sein ehemaliger, inzwischen HIV-positiver Zuhälter, nicht unter die Räder kommt.
Oder wenn der Icherzähler nach einer erstmals gemeinsam verbrachten Nacht mit einem gleichaltrigen Teenager sein bislang ungenutztes Potenzial für Empathie entdeckt.
Dazu die Geschichten, die in diesen Geschichten erzählt werden: Wenn Arbeitskollegen, Straßen- und Zufallsbekanntschaften etwas von sich preisgeben, Fragmente von Biografien, die einen Abgrund erahnen lassen aus Einsamkeit, Resignation und einem Aufbegehren, das sich allzu oft im Kreis dreht.
„So läuft es meistens. Eine halbe Geschichte, und schon sind sie wieder weg. Ich weiß nicht, was mit diesen Leuten passiert oder wo zum Teufel sie enden.“
Lakonische Sätze, die nie ins Adjektiv-Selige abgleiten und gerade in ihrer Härte von der Verletzlichkeit derer zeugen, die sie beschreiben.
Frauenfiguren am eindringlichsten geschildert
Wobei eine identitätspolitische Lesart in die Irre führen würde: Das Coming-out des Icherzählers verläuft nämlich eher unspektakulär und ist beinahe zweitrangig angesichts der Frage, ob und wie man dieser hoffnungslosen Welt entkommen könnte.
In seinem gefeierten Debütroman von 2020, dem ebenfalls auf Deutsch übersetzten „Dinge, an die wir glauben“, hatte Bryan Washington bereits bewiesen, dass man erstens entkommen kann und zweitens die soziale Komponente nicht alles dominiert: Ein afroamerikanisch-japanisches Männerpaar kämpft darum, seine Liebe zu bewahren – und dies in einer stabileren Umwelt, die keineswegs per se „feindlich“ ist.
Ohnehin sind die Frauenfiguren in „Lot“ am eindringlichsten geschildert. Ob die hart schuftende Mutter des Icherzählers oder die gewitzt-lesehungrige Cousine: Sie sind es, die sich der nihilistischen Verführung wirklich entgegenstemmen – und deshalb auch am stärksten im Gedächtnis bleiben.




