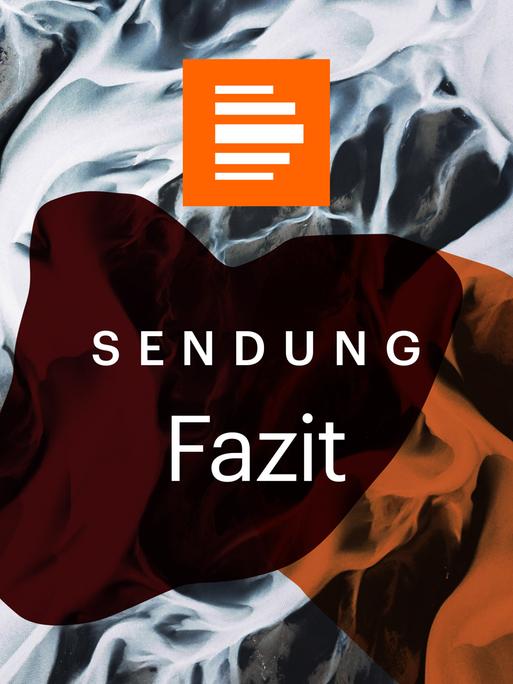Blick nach Osten, Blick nach Westen
Das Festival "euro-scene" in Leipzig entstand kurz nach der Wende - vor allem mit dem Ziel, das Theater in Osteuropa zu entdecken und nach Deutschland zu holen. Heute hat es seinen Blick in alle Richtungen Europas gewendet und zeigt auch zeitgenössischen Tanz.
In Youtube-Videos spiegeln sich in schönster Vielfalt all die privaten Obsessionen und Leidenschaften seiner weltweiten Nutzer in kleinen Filmen wieder: Die Hausfrau, die den Klang eines Föns aufgenommen hat und jetzt als Stundenvideo präsentiert - für alle die das Geräusch auch so beruhigend finden, der Hobby-Schütze, der begeistert zielt und feuert, der Tierfreund, der sich von seinem Hund ablecken lässt oder der Computerfreak, der vorführt, wie er seinen Speicherplatz erweitert. Hunderte Videos hat sich die kroatische Performerin Barbara Matijevic angeschaut und viele solcher selbsterklärenden Filme zusammengeschnitten.
Jetzt hält, hebt, legt oder stellt sie den Laptop immer so, dass sie den gezeigten Ausschnitt mit dem eigenen Körper ergänzt. Sind also Hände im Bild zu sehen – verschwinden ihre hinter dem Bildschirm – wird eine Fußübung gefilmt, hält sie das Gerät vor die Füße. Das macht sie so geschickt, dass man das Video als Teil ihrer Person erlebt. Manchmal übernimmt sie die Kommentare der Videos – teils lässt sie die Filmer selbst sprechen – in der Pose, die der Filmemacher vermutlich eingenommen hat, als er die Kamera auf sich hielt. Durch ihre trockene, choreografisch exakte Präsentation, entstehen so witzige Szenen und ironisch Kommentare zur heutigen Medienwelt. Das Publikum war begeistert.
Festivalleiterin Ann-Elisabeth Wolff lud auch in diesem Jahr ganz unterschiedliche bereits festivalerprobte Produktionen aus ganz Europa zu ihrer "euro scene". Mit kleinerem Budget, nachdem ein Hauptsponsor des Festivals ausgestiegen war. Für das Leipziger Publikum dennoch eine schöne und gern angenommene Gelegenheit, einen Querschnitt aus prominenten und weniger bekannten europäischen Künstlern zu erleben. Eine Produktion des beinahe Stammgastes Alvis Hermanis – der jetzt nur noch Opern inszenieren will – gab das Festivalmotto "Schwarze Milch".
In seinem Stück erzählt Hermanis wehmütig und mit zarter Ironie von einer märchenhaften, archaischen Zeit, in der die Bauern ihre Tiere noch verstanden, in der man den Kühen vorlas oder mit ihnen eine rauchte, als diese weinen konnten oder sich aus Liebe umbrachten. Die Aufführung beschreibt die heutige Entfremdung von Tieren und Menschen, die Industrialisierung der Landwirtschaft und die Folgen der Globalisierung.
Junge Schauspielerinnen in Sommerkleidern und mit riesigen Brüsten verwandeln sich auf der Bühne aus Bäuerinnen in Kühne: durch Kuhmarken in den Ohren, Hörner auf dem Kopf und Glocken um den Hals. Faszinierend echt ahmen sie den Gang der Tiere und das Schleudern der Schwänze nach. Aber auch wenn das Ensemble des Rigaer Theaters schönste Schauspielkunst darbietet: Hermanis träumt ein bisschen zu positiv von der vergangenen Zeit – und die Dauerparallele von dickbrüstiger Frau und sanfter, blöder Kuh ist durchaus diskussionswürdig.
Wie unterschiedlich gut dokumentarisches Theater gelingen kann, war an zwei Arbeiten bestens abzulesen: Die Wiener Choreografin Christine Gaigg scheiterte mit ihrem Versuch – zwei Theaterskandale ins Verhältnis zu setzen: In "De Sacre" zog sie Parallelen zwischen Strawinskys "Frühlingsopfer" in der Choreografie von Vaclav Nijinski vor 100 Jahren in Paris uraufgeführt – und dem Auftritt von Pussy Riot in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale 99 Jahre später. Sie seziert mit ihren Tänzerinnen und Tänzern einzelne Momente aus dem bekannten Youtube-Video der feministischen Punkband – um zu demonstrieren, wie gewaltlos die jungen Frauen aufgetreten seien. Dazwischen liest sie mit dem Russland-Experten Erich Klein immer wieder erklärende Texte zur Geschichte des Choreografen Nijinski und zu den Umständen des Pussy-Riot-Auftritts, so dass die Aufführung wie ein Proseminar mit echten Bildeinblendungen wirkt – die zwar für Momente stark sind, wenn beide Tanzchoreografien miteinander verflochten werden – nachvollziehbare Parallelen der Skandale allerdings erschlossen sich dem ratlos bleibenden Publikum nicht.
Ganz anders dagegen die Arbeiten der Künstlergruppe Brokentalkers aus Dublin. In "Blue Boy" blättern sie ein düsteres Kapitel irischer Geschichte auf: katholische Erziehungsanstalten, in denen Kinder gefoltert, erniedrigt, missbraucht und mitunter getötet wurden. Einzelheiten aus dem 2009 veröffentlichten Ryan-Report über ein sadistisches Regime verwandeln die Künstler in eine verstörende und bewegende Bühnencollage aus Live-Musik, Einspielungen von aufgezeichneten Erfahrungsberichten einstiger Insassen und Fernsehberichten. Tänzer mit Papiermasken ergänzen in ryhthmischen, verstörenden Bewegungen, mit Taubstummen-Gesten die grausamen Berichte – wie diese Aufzählung von Gegenständen wie Hammer, Peitsche, Faust oder Brennnesseln, mit denen die Heimkinder geschlagen wurden:
"'Blue Boy' findet adäquate Bilder für ein gesellschaftliches Trauma – zu einem Thema, über das noch vor einigen Jahren in Irland nicht gesprochen werden konnte."
Zurückgekehrt ins Schauspielhaus, das eine neue Leitung hat - ist in diesem Jahr ein Lieblingskind der "euro scene": Zum 11. Mal gab es den Wettbewerb um das beste deutsche Tanzsolo – eine Idee – übernommen vom belgischen Choreografen Alain Platel : Auf einem Sieben-Meter-Durchmesser-Tisch durften Profis und Laien die Jury und das Publikum in jeweils fünf Minuten von ihrem Tanzsolo überzeugen.
Diese Art des künstlerischen Tabledance – der von Puppentanz über indische Folklore hin zu Break- oder Ausdruckstanz reichte – könnte ein echter Publikumsrenner sein: mit freiem Eintritt, einem weniger geschwätzigen Moderator – und ohne die Unsitte, jeden Tänzer zu einem Kurzinterview zu zwingen. Die Teilnehmer jedenfalls waren so unterschiedlich wie beeindruckend. Davon bitte mehr!
Jetzt hält, hebt, legt oder stellt sie den Laptop immer so, dass sie den gezeigten Ausschnitt mit dem eigenen Körper ergänzt. Sind also Hände im Bild zu sehen – verschwinden ihre hinter dem Bildschirm – wird eine Fußübung gefilmt, hält sie das Gerät vor die Füße. Das macht sie so geschickt, dass man das Video als Teil ihrer Person erlebt. Manchmal übernimmt sie die Kommentare der Videos – teils lässt sie die Filmer selbst sprechen – in der Pose, die der Filmemacher vermutlich eingenommen hat, als er die Kamera auf sich hielt. Durch ihre trockene, choreografisch exakte Präsentation, entstehen so witzige Szenen und ironisch Kommentare zur heutigen Medienwelt. Das Publikum war begeistert.
Festivalleiterin Ann-Elisabeth Wolff lud auch in diesem Jahr ganz unterschiedliche bereits festivalerprobte Produktionen aus ganz Europa zu ihrer "euro scene". Mit kleinerem Budget, nachdem ein Hauptsponsor des Festivals ausgestiegen war. Für das Leipziger Publikum dennoch eine schöne und gern angenommene Gelegenheit, einen Querschnitt aus prominenten und weniger bekannten europäischen Künstlern zu erleben. Eine Produktion des beinahe Stammgastes Alvis Hermanis – der jetzt nur noch Opern inszenieren will – gab das Festivalmotto "Schwarze Milch".
In seinem Stück erzählt Hermanis wehmütig und mit zarter Ironie von einer märchenhaften, archaischen Zeit, in der die Bauern ihre Tiere noch verstanden, in der man den Kühen vorlas oder mit ihnen eine rauchte, als diese weinen konnten oder sich aus Liebe umbrachten. Die Aufführung beschreibt die heutige Entfremdung von Tieren und Menschen, die Industrialisierung der Landwirtschaft und die Folgen der Globalisierung.
Junge Schauspielerinnen in Sommerkleidern und mit riesigen Brüsten verwandeln sich auf der Bühne aus Bäuerinnen in Kühne: durch Kuhmarken in den Ohren, Hörner auf dem Kopf und Glocken um den Hals. Faszinierend echt ahmen sie den Gang der Tiere und das Schleudern der Schwänze nach. Aber auch wenn das Ensemble des Rigaer Theaters schönste Schauspielkunst darbietet: Hermanis träumt ein bisschen zu positiv von der vergangenen Zeit – und die Dauerparallele von dickbrüstiger Frau und sanfter, blöder Kuh ist durchaus diskussionswürdig.
Wie unterschiedlich gut dokumentarisches Theater gelingen kann, war an zwei Arbeiten bestens abzulesen: Die Wiener Choreografin Christine Gaigg scheiterte mit ihrem Versuch – zwei Theaterskandale ins Verhältnis zu setzen: In "De Sacre" zog sie Parallelen zwischen Strawinskys "Frühlingsopfer" in der Choreografie von Vaclav Nijinski vor 100 Jahren in Paris uraufgeführt – und dem Auftritt von Pussy Riot in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale 99 Jahre später. Sie seziert mit ihren Tänzerinnen und Tänzern einzelne Momente aus dem bekannten Youtube-Video der feministischen Punkband – um zu demonstrieren, wie gewaltlos die jungen Frauen aufgetreten seien. Dazwischen liest sie mit dem Russland-Experten Erich Klein immer wieder erklärende Texte zur Geschichte des Choreografen Nijinski und zu den Umständen des Pussy-Riot-Auftritts, so dass die Aufführung wie ein Proseminar mit echten Bildeinblendungen wirkt – die zwar für Momente stark sind, wenn beide Tanzchoreografien miteinander verflochten werden – nachvollziehbare Parallelen der Skandale allerdings erschlossen sich dem ratlos bleibenden Publikum nicht.
Ganz anders dagegen die Arbeiten der Künstlergruppe Brokentalkers aus Dublin. In "Blue Boy" blättern sie ein düsteres Kapitel irischer Geschichte auf: katholische Erziehungsanstalten, in denen Kinder gefoltert, erniedrigt, missbraucht und mitunter getötet wurden. Einzelheiten aus dem 2009 veröffentlichten Ryan-Report über ein sadistisches Regime verwandeln die Künstler in eine verstörende und bewegende Bühnencollage aus Live-Musik, Einspielungen von aufgezeichneten Erfahrungsberichten einstiger Insassen und Fernsehberichten. Tänzer mit Papiermasken ergänzen in ryhthmischen, verstörenden Bewegungen, mit Taubstummen-Gesten die grausamen Berichte – wie diese Aufzählung von Gegenständen wie Hammer, Peitsche, Faust oder Brennnesseln, mit denen die Heimkinder geschlagen wurden:
"'Blue Boy' findet adäquate Bilder für ein gesellschaftliches Trauma – zu einem Thema, über das noch vor einigen Jahren in Irland nicht gesprochen werden konnte."
Zurückgekehrt ins Schauspielhaus, das eine neue Leitung hat - ist in diesem Jahr ein Lieblingskind der "euro scene": Zum 11. Mal gab es den Wettbewerb um das beste deutsche Tanzsolo – eine Idee – übernommen vom belgischen Choreografen Alain Platel : Auf einem Sieben-Meter-Durchmesser-Tisch durften Profis und Laien die Jury und das Publikum in jeweils fünf Minuten von ihrem Tanzsolo überzeugen.
Diese Art des künstlerischen Tabledance – der von Puppentanz über indische Folklore hin zu Break- oder Ausdruckstanz reichte – könnte ein echter Publikumsrenner sein: mit freiem Eintritt, einem weniger geschwätzigen Moderator – und ohne die Unsitte, jeden Tänzer zu einem Kurzinterview zu zwingen. Die Teilnehmer jedenfalls waren so unterschiedlich wie beeindruckend. Davon bitte mehr!