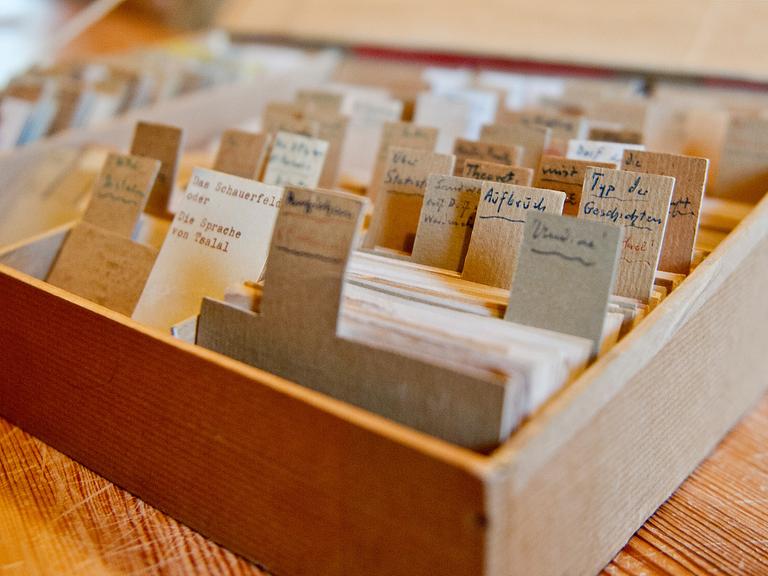Extreme, diametral entgegengesetzte Gefühle
Vier Rezensenten haben dasselbe Stück gesehen - doch ihr Empfinden könnte unterschiedlicher kaum sein. Ähnlich ist es beim neuen brandenburgischen Landtag. Nur Arno Schmidt scheint man sich einig zu sein - der wäre am Samstag 100 Jahre alt geworden.
Vier Zeitungen, eine Szene.
Zeitung 1: "Am Ende, als die Liebenden in ihrer Verrücktheit sich haben, (…) als er sie hochhebt und auf dem Kaminsims absetzt, sich selbst auf den Boden weiter weg an die Wand legt – geht der Himmel auf. Es wird Nacht. Sie schließen die Augen. Die Sterne funkeln im Theaterhimmel."
Zeitung 2: "Am Schluss jedenfalls liegen sie da, er am Boden, sie auf dem Kaminsims, erschlagen von den Emotionen, benommen wie unter Drogen. Am Nachthimmel über ihnen glänzen hell die Sterne.
Zeitung 1: "Am Ende, als die Liebenden in ihrer Verrücktheit sich haben, (…) als er sie hochhebt und auf dem Kaminsims absetzt, sich selbst auf den Boden weiter weg an die Wand legt – geht der Himmel auf. Es wird Nacht. Sie schließen die Augen. Die Sterne funkeln im Theaterhimmel."
Zeitung 2: "Am Schluss jedenfalls liegen sie da, er am Boden, sie auf dem Kaminsims, erschlagen von den Emotionen, benommen wie unter Drogen. Am Nachthimmel über ihnen glänzen hell die Sterne.
Zeitung 3: "Ein Schlachtfeld. Dorante liegt wimmernd am Boden, Araminte als Barockengel in weißem Rüschenkleid auf dem Kamin."
Zeitung 4: "Am Sternenhimmel, der sich über der letzten Szene auftut, knackt und ächzt es wie in den durcheinander fahrenden Wänden von Madame Aramintes kalter Luxuswohnung mit dem Zierkamin, in dem kein Feuer mehr brennt."
Haben die Rezensenten der FRANKFURTER ALLGEMEINEN, der SÜDDEUTSCHEN, der WELT und der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG wirklich das selbe Stück gesehen? Das haben sie, nämlich Pierre de Marivaux‘ Komödie "Les fausses confidences" in der Inszenierung von Luc Bondy am Pariser Odéon mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle. Nur was sie gesehen und vor allem was sie dabei empfunden haben, könnte unterschiedlicher kaum sein:
Eine Welt voller "Wunderflügelwesen" und das "pure Glück" im Falle des FAZ-Kritikers Gerhard Stadelmaier; "emotional unterkühlt(e) Konventionssteife" und "Schleier von Trübsal" dagegen bei SZ-Autor Joseph Hanimann. WELT-Rezensent Thomas Hahn deutet den Abend als Parabel auf das vom Liebesleben seines Präsidenten halb gefesselte, halb peinlich berührte Frankreich, und NZZ-Kritikerin Barbara Villiger Heilig weiß überhaupt nicht mehr, wo ihr der Kopf steht, und fragt angesichts des häufigen Kostümwechsels von Isabelle Huppert: "Warum bloß zieht sie sich ständig um?"
Extreme, wenngleich diametral entgegengesetzte Gefühle scheinen generell diesen Feuilletontag zu kennzeichnen, jedenfalls was die bauästhetische Wahrnehmung des neuen brandenburgischen Landtags im wiederrichteten Potsdamer Stadtschloss betrifft. Und wieder ist es die FAZ, die sich vor Glück kaum einkriegt: "Weiß, schnörkellos, zeitlos und zeitgenössisch zugleich", preist Dieter Bartetzko den Bau.
"Dieses die Vergangenheit nicht kopierende, sondern interpretierende Bekenntnis des Architekten und der Bauherren zur Gegenwart hat nicht nur für Potsdam und Brandenburg Gewicht, sondern auch für die gesamte Republik." Und wieder ist es die Konkurrenz aus Süddeutschland, die den Miesepeter gibt: "Was 'Landtagsrestaurant' heißt, kann man der Möblierung nach getrost Kantine nennen", mäkelt SZ-Autor Stephan Speicher. "Zieht man auch in ein Schloss, so soll doch nicht vergessen sein, dass Brandenburg ein armes Land ist."
Zu so viel Dissonanz passt es, das Arno Schmidt seinen Hundertsten feiert, und weil sich auf den noch nie jemand einen Reim machen konnte, versuchen es die gratulierenden Feuilletons zumeist gar nicht erst. "Schmidts Prosa ist nur was für gelehrte Spinner", listet Susanne Fischer, Geschäftsführerin der Arno-Schmidt-Stiftung und damit eine, die es wissen muss, in der TAZ eines von zehn angeblichen Vorurteilen über den Schriftsteller auf. "Falsch. Ungelehrte Spinner können sie auch lesen. Wer es verweigert, verpasst einen schönen Satz nach dem anderen. 'Der Mensch ist innen hohl, und das Übel in der Welt wächst beständig.'"
Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG lässt gleich sechs ihrer besten Federn die ganze Aufmacherseite mit Schmidt-Würdigungen vollschreiben und schreibt als Titel "In Sprachgewittern" drüber. Was Arno Schmidt von dieser Anspielung auf Ernst Jünger gehalten hätte, über den von ihm der markante Ausruf „Er mög‘ verenden!“ überliefert ist? Wer sich das fragt, bekommt von Martin Halter in der BERLINER ZEITUNG zur Antwort: ganz falsche Frage. "Auch wenn er sich im Grabe herumdrehen mag: Arno Schmidt ist einer von uns geworden."