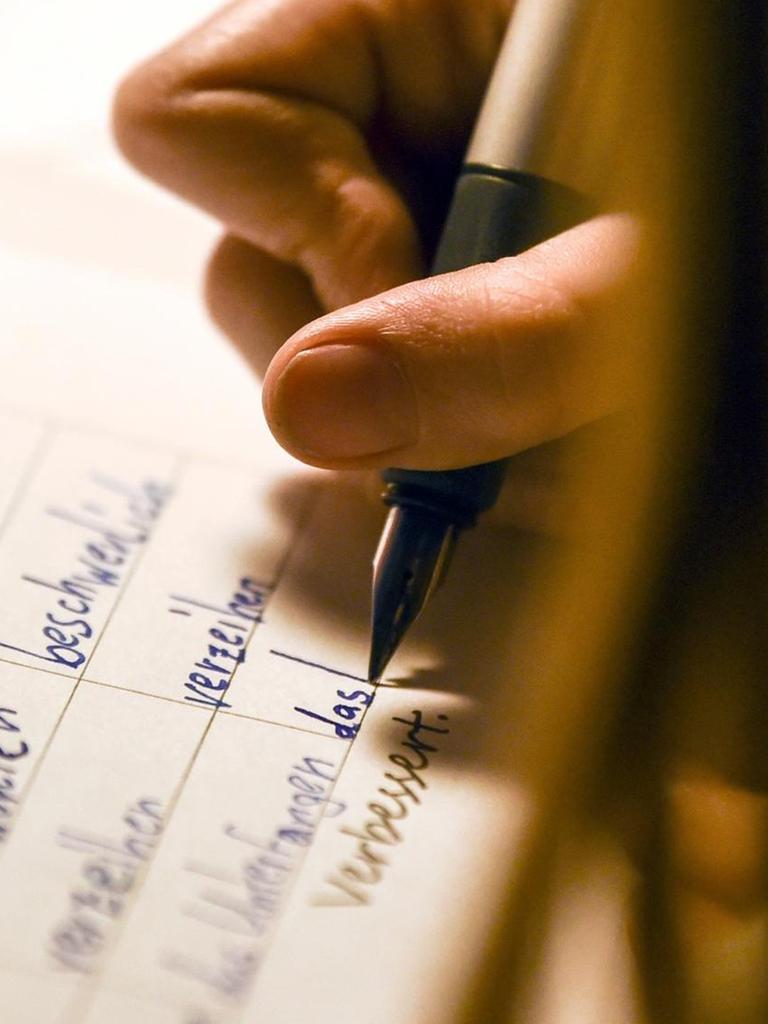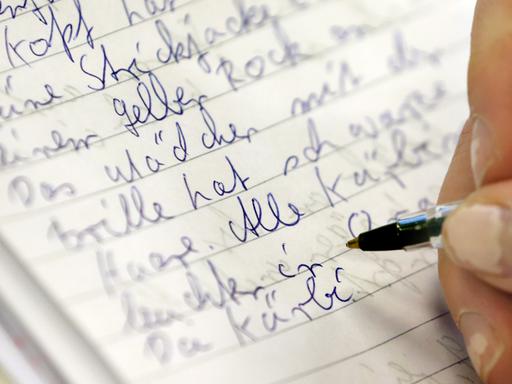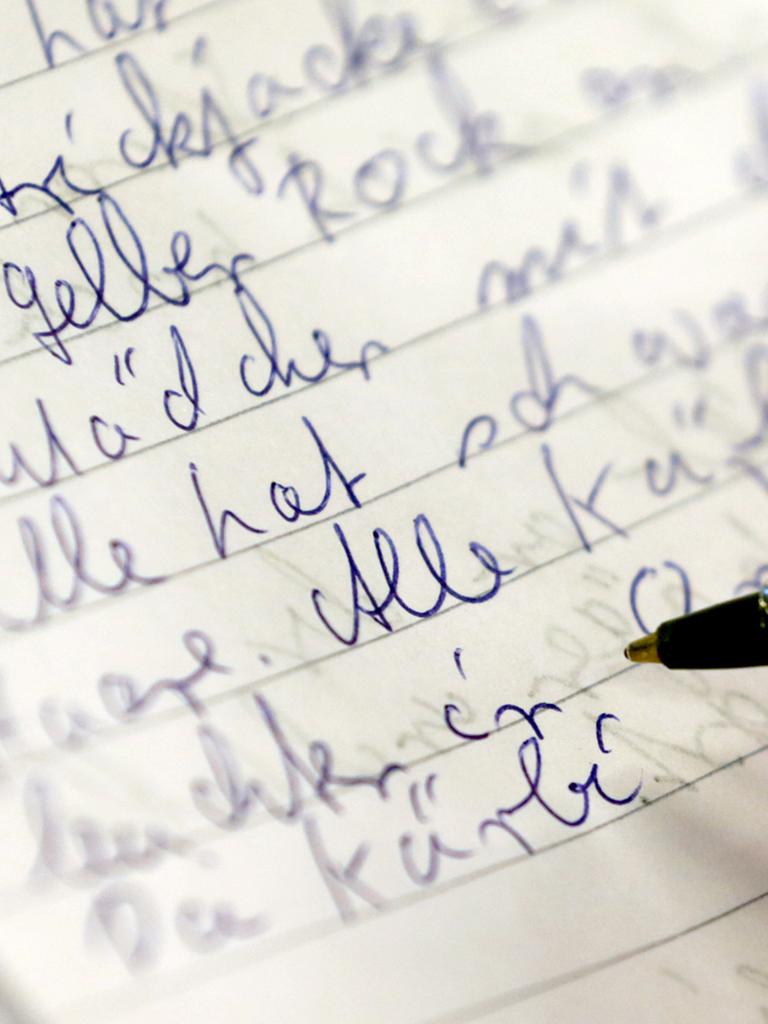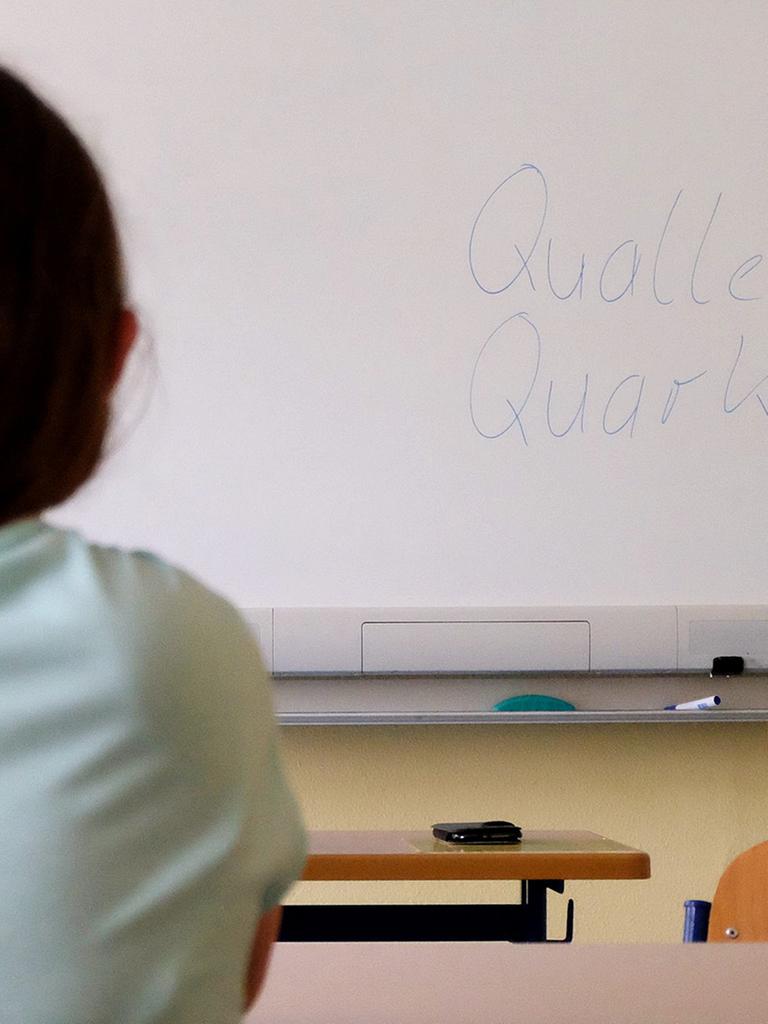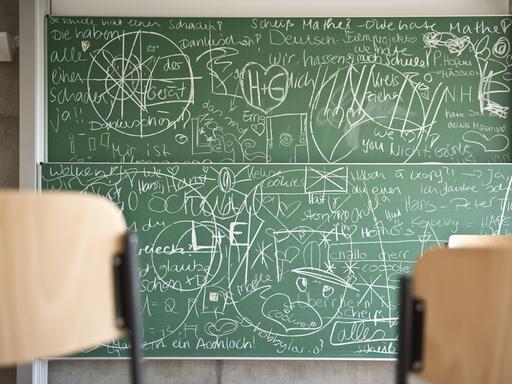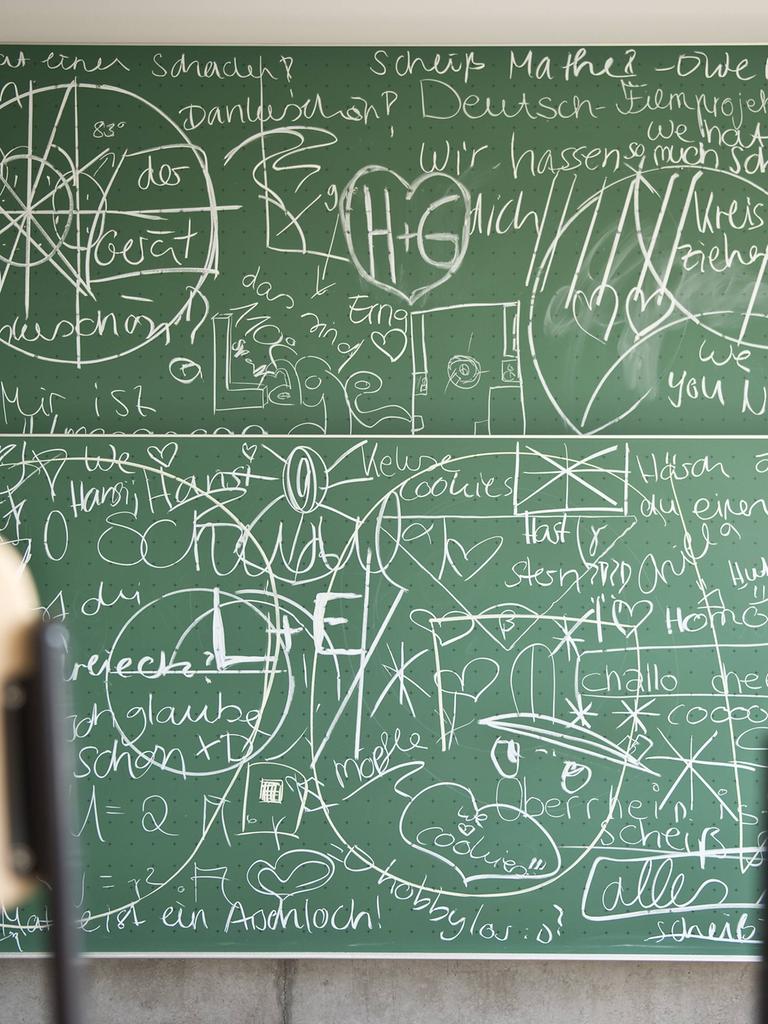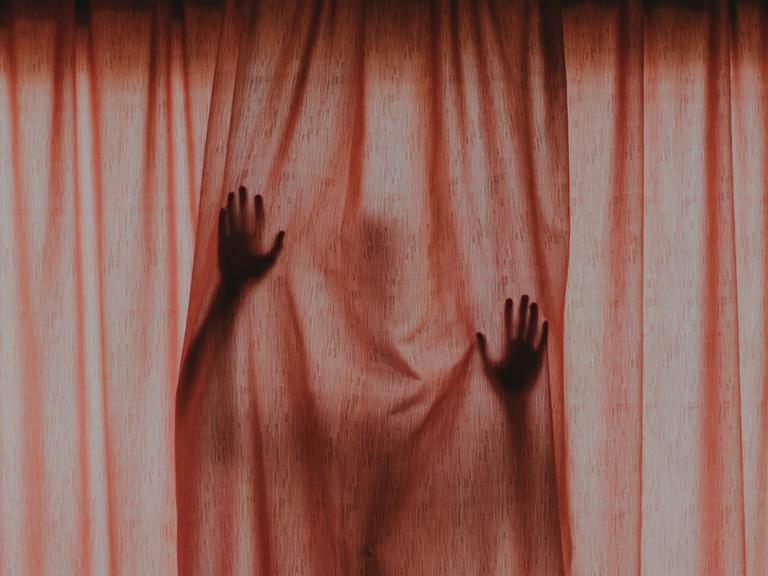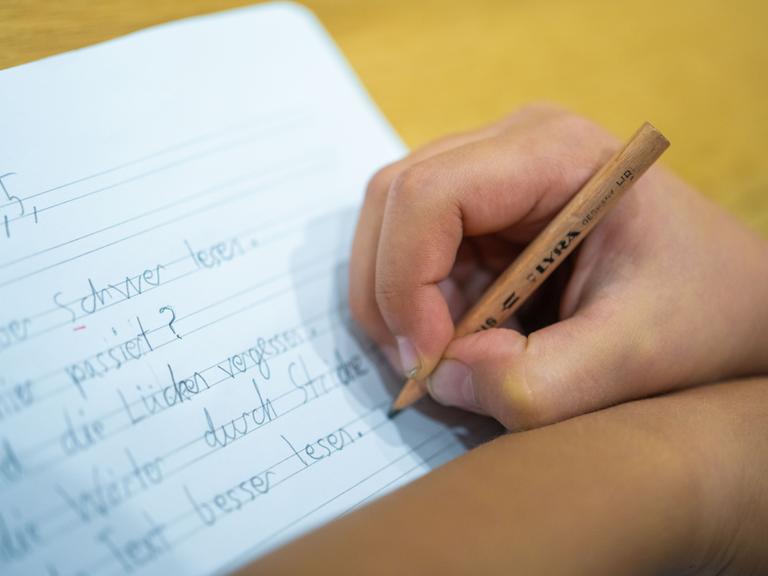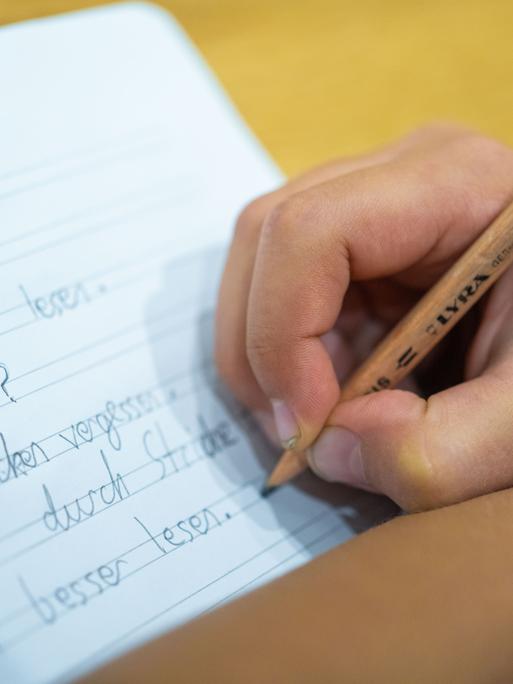Analphabetismus bei Erwachsenen
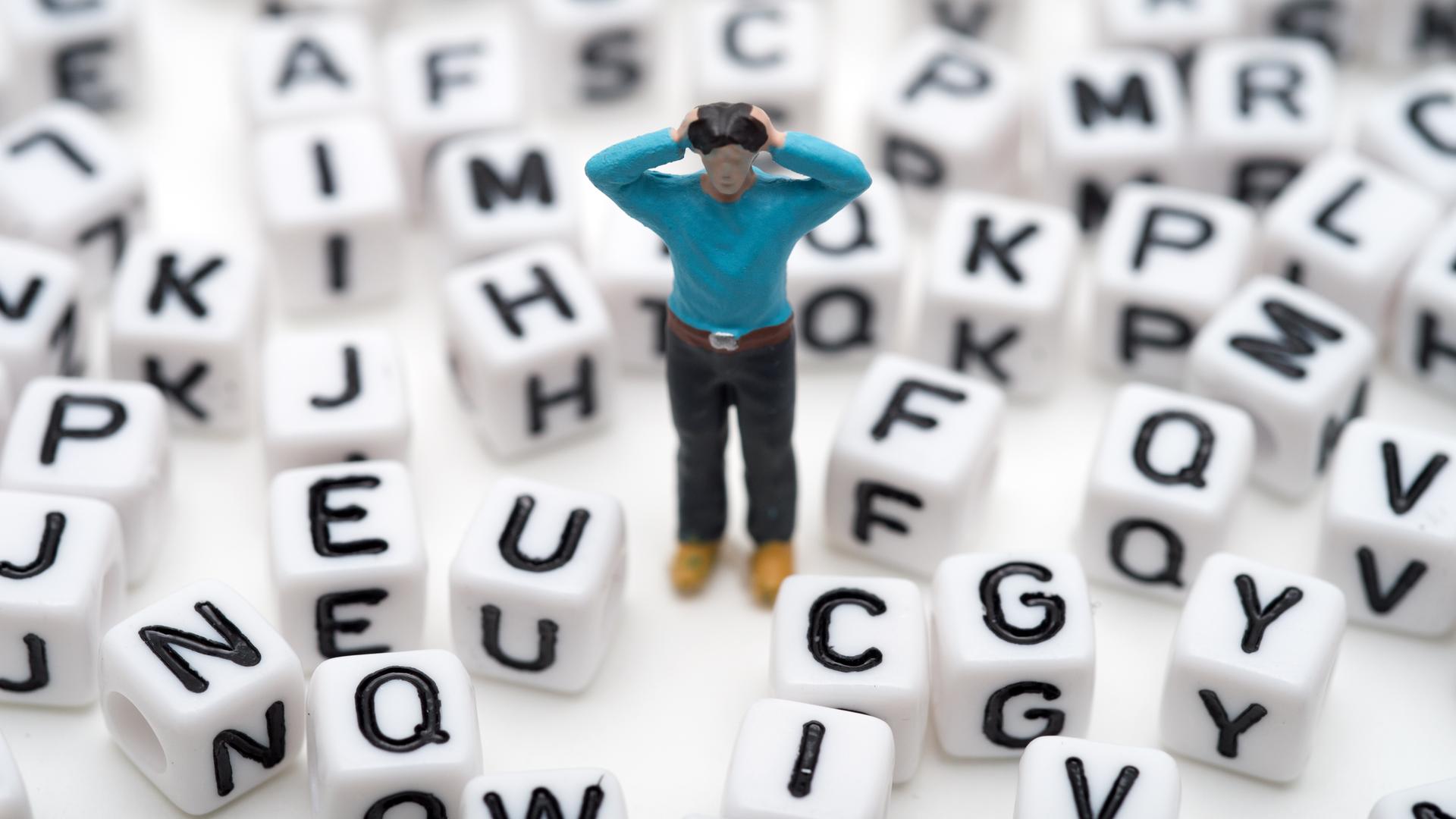
Zwischen sechs und fast elf Millionen Menschen in Deutschland können nicht lesen, schätzen Experten. © picture alliance / dpa Themendienst / Andrea Warnecke
Lesen lernen lohnt sich auch später im Leben
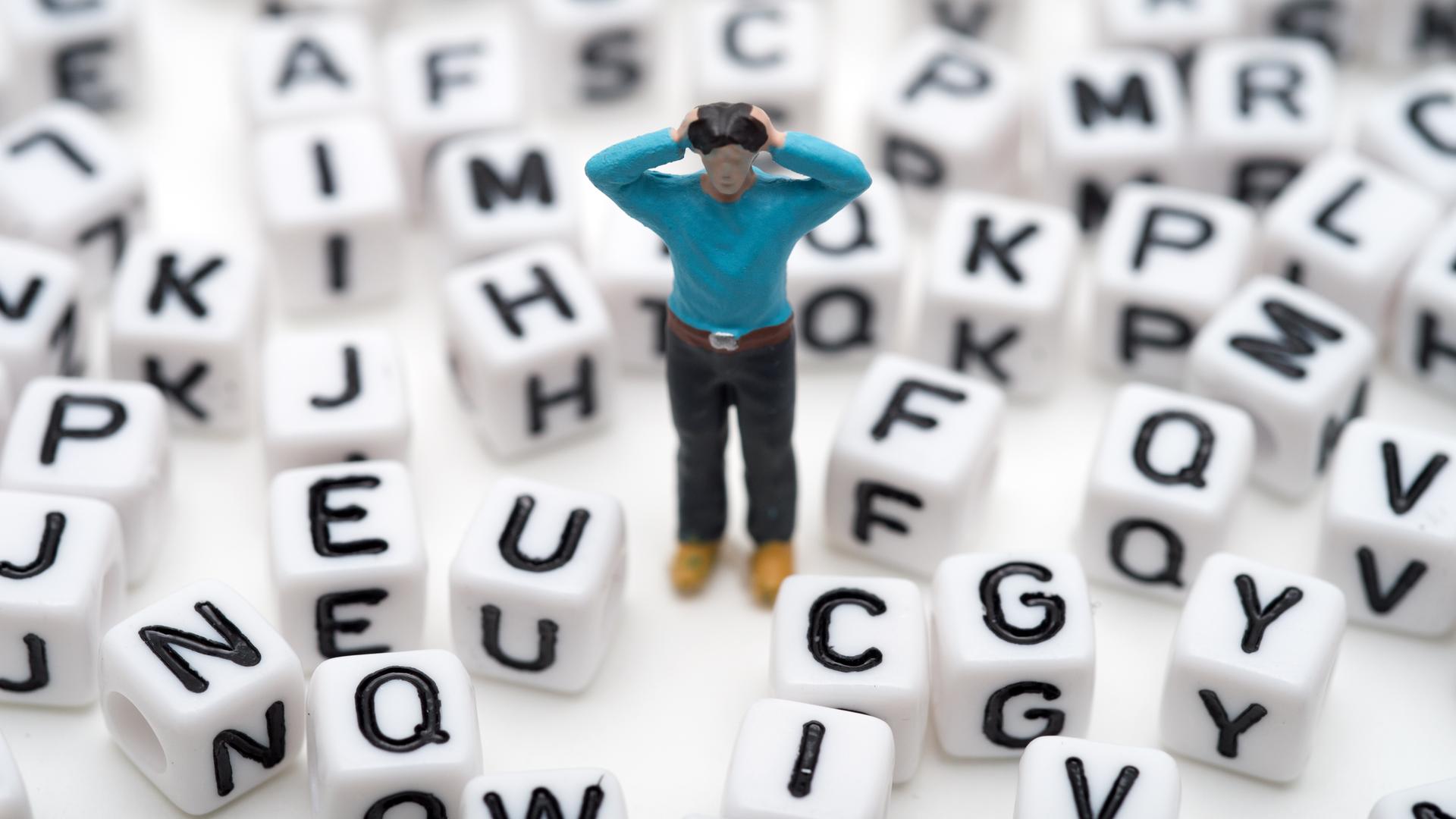
Millionen Menschen in Deutschland können nicht oder kaum lesen und schreiben. Das bringt Nachteile im Job und im Alltag. Oft schämen sich die Betroffenen. Spät lesen lernen wollen nur wenige. Dabei zeigt sich: Der Prozess ist zäh, aber lohnend.
Mit 65 Jahren setzt sich Rentner Emile Meoux in die Grundschulklasse seines Dorfes und will lesen lernen. Aus der bizarren Situation und den Konflikten zwischen dem starrköpfigen Analphabeten und den quirligen Kindern macht der französische Film „Es sind die kleinen Dinge“ eine charmante Komödie.
In der Realität ist es deutlich schwieriger, als Erwachsener noch lesen und schreiben zu lernen. Es dauert mehrere Jahre und erfordert viel Disziplin und Ausdauer. Deswegen wählen nur wenige diesen Weg: Schätzungen zufolge nur ein Prozent der Betroffenen.
Neue Zahlen belegen, dass in Deutschland die Quote der Menschen, die nicht oder nur kaum lesen können, weitgehend stagniert. Woran liegt das? Was kann dagegen getan werden? Ein Überblick.
Inhalt
Wie viele Erwachsene in Deutschland können nicht lesen und schreiben?
Mietverträge oder Behördenschreiben – wer nicht lesen kann, hat im Alltag ein Problem. Zwei Studien liefern Daten, wie viele Menschen davon in Deutschland betroffen sind. Weil sie die Maßstäbe, ab welchem Niveau jemand als gering literarisiert gilt, leicht unterschiedlich setzen, kommen sie zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Die LEO 2018-Erhebung geht von 6,2 Millionen Betroffenen aus. Eine Sonderauswertung der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Auftrag gegebenen PIAAC-Studie von 2023 nennt mit 10,6 Millionen Betroffenen in Deutschland eine noch deutlich höhere Zahl. Das entspricht rund 20 Prozent der Bevölkerung im Alter von 16 bis 65 Jahren (2012: 18 Prozent).
In dieser Gruppe sind echte Analphabeten, aber auch viele, die Wörter und einfachere Sätze lesen können und einen Schulabschluss geschafft haben, sich aber komplexere Texte nicht erschließen können.
Im Vergleich der Zahlen von 2012 bis 2023 zeigen sich einige Trends: Männer sind inzwischen häufiger betroffen als Frauen. Rund 55 Prozent der Betroffenen sind älter als 45 Jahre. Und: Signifikant gestiegen ist der Anteil von Zuwanderern.
Wie kommen erwachsene Analphabeten durch den Alltag?
Nicht lesen zu können, ist schambesetzt. Viele Betroffene verheimlichen es so gut es geht, indem sie beispielsweise Situationen meiden, in denen ihre Schwierigkeiten auffallen könnten.
Natürlich schlägt sich das auch auf das Berufsleben nieder. Überdurchschnittlich häufig landen sie nur in einfachen, schlecht bezahlten Hilfsjobs in der Logistik, der Reinigungsbranche oder in Großküchen, wo Lesen als Kompetenz nur eine geringe Rolle spielt. Insgesamt haben aus dieser Gruppe nur 60 Prozent Arbeit, in der Gesamtbevölkerung sind es knapp 80 Prozent.
Trotz dieser Nachteile berichten Betroffene, wie sie sich Jahre und Jahrzehnte erfolgreich durch schwierige Situationen „getrickst“ haben, gleichzeitig aber an Ängsten und geringem Selbstwertgefühl litten. So gut wie alle haben Menschen in ihrem persönlichen Umfeld, die um die Schwierigkeiten wissen und ihnen helfen – Partnerinnen oder Partner, Kinder oder Freunde.
Woher kommt dann der Impuls als Erwachsener doch noch mal die Schulbank zu drücken? Ein Jobverlust kann die Ursache sein. Viel häufiger ist jedoch das persönliche Netzwerk entscheidend: Enkel, die von der Schule kommen und etwas vorgelesen haben möchten, Freunde, die motivieren. Deshalb nehmen Hilfsangebote für Menschen, die kaum lesen und schreiben können, gezielt auch sie in den Fokus.
Wie können Erwachsene lesen und schreiben lernen?
Wer es wagt, sich auch später im Leben noch im Lesen zu verbessern, der gewinnt, ist Sabina Grbo überzeugt. Die Kursleiterin arbeitet für den Verein Lesen und Schreiben e.V. in Berlin, der wie viele andere Einrichtungen Tages- und Abendkurse zum Lesenlernen anbietet.
Grbo erlebt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer solcher Kurse als selbstbewusster und sortierter, wenn sie mit ihrer Lesekompetenz vorankommen. Nebenbei üben sie auch andere hilfreiche Dinge wie Konzentration oder Arbeitseinteilung und erleben, dass sie mit ihrem Problem nicht allein sind.
Auch das Erlernen neuer Worte ist ein wichtiger Teil von Alphabetisierungskursen. Menschen, die nicht gut lesen können, haben einen geringeren Wortschatz. Das behindert wiederum das Lesenlernen, sagt Cordula Löffler, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Weingarten: „Weil ich dann beim Lesen immer über Wörter stolpere, die ich nicht einordnen kann.“
Ebenfalls von Bedeutung ist die sogenannte phonologische Bewusstheit – ein Gefühl für die Laute, den Rhythmus und Artikulation von Sprache. Kinder können das spielerisch über Kinderlieder oder -reime lernen, erklärt Löffler, bei Erwachsenen müsse man sich etwas anderes einfallen lassen: „Mit jungen Leuten können Sie rappen und mit Songtexten arbeiten.“
Kurse und Angebote für Betroffene gibt es flächendeckend, von Volkshochschulen über Vereine bis hin zu privaten Initiativen. Unterstützung kommt auch von der Politik: Bund, Länder und gesellschaftliche Partnerorganisationen haben 2016 die Alphabetisierungsdekade ausgerufen. Der Anteil der Menschen mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben sollte gesenkt werden.
Der Blick auf die Zahlen zeigt: Das hat nicht geklappt. Doch in diesem Fall scheint Stagnation nicht unbedingt ein Manko zu sein. Trotz hoher Zuwanderung und Krisensituationen wie der Coronapandemie habe es Deutschland geschafft, das Niveau zu halten, betont die Erziehungsforscherin Anke Grotlüschen von der Universität Hamburg: „Das ist so weit erstmal gut.“
Analphabetismus und Populismus
Andererseits warnt Grotlüschen: Menschen mit solchen Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben seien leichter mit Sündenbock-Narrativen ("Die Zugewanderten sind an allem schuld") zu erreichen. Der Grund: Sie könnten solche Narrative nicht einfach überprüfen, denn das mache man fast immer durch Nachlesen.
Es scheint, als kämen fehlende Kompetenzen im Lesebereich rechtspopulistischen Parteien gerade recht. Diese hätten keinen Umverteilungsansatz, sagt Grotlüschen. Sozialdemokratische Bildungspolitik wolle nach unten verteilen, die Konservativen hingegen die Mittelschicht und die Bessergestellten mit Bildung versorgen.
"Populistische Bildungspolitik will nicht verteilen, sondern eigentlich nur die Themen setzen, nationalistische Themen setzen", betont Grotlüschen. Die fehlende Umverteilung gehe dann auf Kosten der Schwächsten.
Die Folgen könne man in Ländern beobachten, in denen Rechtspopulisten das Bildungssystem bereits vor längerer Zeit umgebaut hätten, wie beispielsweise in Polen. Die Analphabetisierungsquote steige, es gebe immer mehr Menschen, um die sich niemand mehr kümmere. Auch in Ungarn, Italien, Israel und den USA könne man "deutliche Verluste" bei den Literalitätswerten feststellen, sagt die Bildungsforscherin.
Katja Hanke, Jens Krepela, ahe