Zwischen Tradition und Innovation
Der Sammelband zeigt theologisch-politische Wechselverhältnisse in den 1960er und 70er Jahren auf. Dabei werden viele Details untersucht, die der breiteren Öffentlichkeit in ihren Auswirkungen auf heutige Verhältnisse nicht bekannt sind.
Die Frage nach dem Verhältnis von Religion und Politik ist zu allen Zeiten aktuell. Im Christentum wurde sie von Anfang an theologisch kontrovers diskutiert und durch weitreichende Entscheidungen beantwortet. Etwa durch die Allianzen von Thron und Altar im Mittelalter, die Stellung der Landesfürsten zur Reformation oder die verhängnisvollen Verbindungen der Deutschen Christen mit dem NS-Regime. Eben dieser letztgenannten Epoche wird im vorliegenden Sammelband, der sich in kulturgeschichtlicher Perspektive mit der Politisierung des Protestantismus in den 1960er und 70er Jahren beschäftigt, eine wichtige Rolle zugewiesen.
"Zweifellos spielt [...] in der Bundesrepublik Deutschland die NS-Vergangenheit und die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit ihr ebenso wie das Defizit an politischer Partizipation und öffentlicher Diskussionskultur in der Nachkriegszeit eine besondere Rolle für die Politisierung."
Wirkten sich in den 1950er Jahren noch nationale Orientierungen, traditionelle Staatsverklärungen und ein Misstrauen gegen politische Parteien aus, so können die Autorinnen und Autoren zeigen, dass und wie Demokratisierungsprozesse, Beteiligungskulturen, eine neue Ostpolitik und Ereignisse wie der Nord-Süd-Konflikt in den langen 60er Jahren Veränderungen im Protestantismus zeitigten.
Politisierung erscheint dabei als Kampfbegriff jener Zeit, in der sich Teile des Protestantismus vehement für eine apolitische Kirche einsetzten. Andere sprachen sich gegen ein individualistisch verkürztes Heilsverständnis und für die Beschäftigung mit Themen wie Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität aus. Deutlich wird dabei einerseits die bleibende Bedeutung theologischer Konzepte wie der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre und der von Karl Barth entworfenen Königsherrschaft-Christi-Lehre für die prinzipiell alternativen Einstellungen zum Verhältnis von Religion und Politik.
Andererseits forderten und ermöglichten die sozialen, medialen und generationellen Transformationsprozesse nicht nur politische Positionierungen seitens der Kirche, sondern wirkten tief in ihre eigenen Gestaltungsabläufe hinein. Das zeigen Einzelstudien zu Diskursen in den Evangelischen Studierendengemeinden, den Synoden, Berliner Gemeinden und den Formen der Politisierung des Religionsunterrichts.
Wie stark sich das erwachte Interesse an der sogenannten Dritten Welt, die Einstellungen zum Marxismus oder Feminismus auf die wissenschaftliche Arbeit auswirkten, verdeutlichen Analysen zu den Theologien der Hoffnung, der Revolution und der Befreiung. Diese bieten inhaltlich nicht viel Neues, aber können zeigen, wie gerade internationale Prozesse auf das theologische Denken einwirkten und von diesem Impulse empfangen konnten. Das ist angesichts eines gegenwärtig in Kirche und Gesellschaft eher zunehmenden Desinteresses an theologischer Intellektualität besonders zu würdigen.
Sichtbar wird auch der prägende Einfluss von Einzelpersonen wie Helmut Gollwitzer oder Walther Künneth, die durch entgegengesetzte Positionierungen kirchenpolitische Bedeutung erlangten. Zu den interessantesten Studien gehören diejenigen, die sich mit der bislang zu wenig erforschten Politisierung des Protestantismus in den Massenmedien und protestantischen Zeitschriften befassen. Wenngleich eine eigene Studie zu kirchlichen Denkschriften fehlt, wird gezeigt, wie einflussreiche Medienmogule einen konservativen, ausschließlich auf Transzendenzvermittlung fokussierten Kirchenbegriff favorisierten:
"Sowohl Augstein als auch Springer sahen in den Theorien und Praktiken progressiver Theologen und Priestergruppen eine Verfehlung der in ihren Augen eigentlich vorrangigen kirchlichen Aufgabe."
Ausgehend vom Katholikentag 1968 in Essen wird die Politisierung der anderen Konfession in den Blick genommen. Einige Beiträge widmen sich den Verhältnissen in Nachbarländern, die aufgrund unterschiedlicher Staats- und Kirchenverständnisse nur bedingt mit den deutschen Entwicklungen parallelisiert werden können.
Insgesamt zeichnet es das Buch aus, in kluger Begrenzung auf eine hochinteressante Epoche, die gegenwärtig zu oft klischeehaft als die "Zeit der 68er" verklärt oder abgewertet wird, theologisch-politische Wechselverhältnisse in ihrer Komplexität aufzuweisen und dabei die Bedeutung von Tradition und Innovation zu bedenken. Dabei werden viele Details untersucht, die der breiteren Öffentlichkeit in ihren Auswirkungen auf heutige Verhältnisse nicht bekannt sind. Ebenso wird deutlich, dass bestimmte Themen der "großen Politik" wie etwa die Auschwitzprozesse oder die Anfänge des Terrorismus im Protestantismus dieser Zeit kaum diskursiv behandelt wurden.
Leider fehlen Beiträge zur Bedeutung der Frankfurter Schule, zur Friedensethik bzw. zur damals kontrovers verhandelten Gewaltthematik. Gelegentlich werden aus Einzelereignissen zu pauschale Urteile für die Gegenwart gezogen, etwa wenn aufgrund des veränderten Wahlverhaltens von Mitgliedern einer einzigen Landeskirche gefolgert wird, dass die Politisierung des Protestantismus heute passé sei:
"Für die aktiven Kirchenmitglieder heute steht nicht mehr politisches Engagement im Vordergrund, sondern, neben der Wahrnehmung der Kasualien, vor allem die Pflege des persönlichen Glaubens."
Täuscht der Eindruck nicht, werden Kirchen gegenwärtig allerdings wieder wie in den 1950er Jahren in der Öffentlichkeit und von Politikern vor allem als moralische Instanzen wahrgenommen, woran sie selber nicht unschuldig sind. Dass das Evangelium auf die Rechtfertigung des gottlosen Menschen und nicht auf die Veredlung des Tugendhaften abzielt, droht darüber in Vergessenheit zu geraten.
Es ist nicht das geringste Verdienst des gut lesbaren Sammelbandes, dass er zeigt, wie viel der heutige Protestantismus vergangenen politischen Auseinandersetzungen verdankt, welche intellektuellen Potenziale er für die Weltgestaltung hat und wie anstrengend aber auch ergiebig und notwendig theologische Diskurse zu politischen Themen sind. Gerade in Zeiten, in denen im politischen Leben Inhalte, Konzepte und Handlungsoptionen zugunsten einer Orientierung an blassen Hoffnungsträgern und einer Vorliebe für moralisierende Statements marginalisiert werden, hat der Protestantismus einerseits eine Instrumentalisierung der Kirche durch die Politik abzuwehren und andererseits zu behaupten, dass es keine Bereiche unseres Lebens gibt, die sich dem Einflussbereich Gottes entziehen. Politische Abstinenz und Orientierung an einem nur noch privaten "Kuschelgott" (F.W. Graf) verbieten sich daher ebenso wie politischer Aktionismus, der ideologieanfällig und ohne Sensibilität für den Unterschied zwischen Letztem und Vorletztem das Reich Gottes auf Erden errichten möchte.
Protestantismus und Politik lassen sich nicht vorschnell auseinander dividieren oder auf einen Nenner bringen, und es ist kein Manko, dass die Herausgeber am Ende kein schnelles Fazit ziehen, sondern Fragen von bleibender Relevanz formulieren. Etwa:
"Inwiefern wirkte die Politisierung der Gesellschaft auf die Politisierung des Protestantismus ein, inwiefern strahlt die Politisierung des Protestantismus auf die Gesellschaft ab? Ging die Politisierung des Protestantismus 'von unten', 'von oben' oder von einer komplexen Wechselwirkung beider Pole aus?"
Wer in seiner Urteilsbildung diesbezüglich weiterkommen möchte, wird von den Anregungen und den leserfreundlichen Zusammenfassungen von Diskussionsabläufen profitieren.
K. Fitschen, S. Hermle, K. Kunter, C. Lepp, A. Roggenkamp-Kaufmann (Hgg.): Die Politisierung des Protestantismus. Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland während der 1960er und 70er Jahre
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011
"Zweifellos spielt [...] in der Bundesrepublik Deutschland die NS-Vergangenheit und die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit ihr ebenso wie das Defizit an politischer Partizipation und öffentlicher Diskussionskultur in der Nachkriegszeit eine besondere Rolle für die Politisierung."
Wirkten sich in den 1950er Jahren noch nationale Orientierungen, traditionelle Staatsverklärungen und ein Misstrauen gegen politische Parteien aus, so können die Autorinnen und Autoren zeigen, dass und wie Demokratisierungsprozesse, Beteiligungskulturen, eine neue Ostpolitik und Ereignisse wie der Nord-Süd-Konflikt in den langen 60er Jahren Veränderungen im Protestantismus zeitigten.
Politisierung erscheint dabei als Kampfbegriff jener Zeit, in der sich Teile des Protestantismus vehement für eine apolitische Kirche einsetzten. Andere sprachen sich gegen ein individualistisch verkürztes Heilsverständnis und für die Beschäftigung mit Themen wie Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität aus. Deutlich wird dabei einerseits die bleibende Bedeutung theologischer Konzepte wie der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre und der von Karl Barth entworfenen Königsherrschaft-Christi-Lehre für die prinzipiell alternativen Einstellungen zum Verhältnis von Religion und Politik.
Andererseits forderten und ermöglichten die sozialen, medialen und generationellen Transformationsprozesse nicht nur politische Positionierungen seitens der Kirche, sondern wirkten tief in ihre eigenen Gestaltungsabläufe hinein. Das zeigen Einzelstudien zu Diskursen in den Evangelischen Studierendengemeinden, den Synoden, Berliner Gemeinden und den Formen der Politisierung des Religionsunterrichts.
Wie stark sich das erwachte Interesse an der sogenannten Dritten Welt, die Einstellungen zum Marxismus oder Feminismus auf die wissenschaftliche Arbeit auswirkten, verdeutlichen Analysen zu den Theologien der Hoffnung, der Revolution und der Befreiung. Diese bieten inhaltlich nicht viel Neues, aber können zeigen, wie gerade internationale Prozesse auf das theologische Denken einwirkten und von diesem Impulse empfangen konnten. Das ist angesichts eines gegenwärtig in Kirche und Gesellschaft eher zunehmenden Desinteresses an theologischer Intellektualität besonders zu würdigen.
Sichtbar wird auch der prägende Einfluss von Einzelpersonen wie Helmut Gollwitzer oder Walther Künneth, die durch entgegengesetzte Positionierungen kirchenpolitische Bedeutung erlangten. Zu den interessantesten Studien gehören diejenigen, die sich mit der bislang zu wenig erforschten Politisierung des Protestantismus in den Massenmedien und protestantischen Zeitschriften befassen. Wenngleich eine eigene Studie zu kirchlichen Denkschriften fehlt, wird gezeigt, wie einflussreiche Medienmogule einen konservativen, ausschließlich auf Transzendenzvermittlung fokussierten Kirchenbegriff favorisierten:
"Sowohl Augstein als auch Springer sahen in den Theorien und Praktiken progressiver Theologen und Priestergruppen eine Verfehlung der in ihren Augen eigentlich vorrangigen kirchlichen Aufgabe."
Ausgehend vom Katholikentag 1968 in Essen wird die Politisierung der anderen Konfession in den Blick genommen. Einige Beiträge widmen sich den Verhältnissen in Nachbarländern, die aufgrund unterschiedlicher Staats- und Kirchenverständnisse nur bedingt mit den deutschen Entwicklungen parallelisiert werden können.
Insgesamt zeichnet es das Buch aus, in kluger Begrenzung auf eine hochinteressante Epoche, die gegenwärtig zu oft klischeehaft als die "Zeit der 68er" verklärt oder abgewertet wird, theologisch-politische Wechselverhältnisse in ihrer Komplexität aufzuweisen und dabei die Bedeutung von Tradition und Innovation zu bedenken. Dabei werden viele Details untersucht, die der breiteren Öffentlichkeit in ihren Auswirkungen auf heutige Verhältnisse nicht bekannt sind. Ebenso wird deutlich, dass bestimmte Themen der "großen Politik" wie etwa die Auschwitzprozesse oder die Anfänge des Terrorismus im Protestantismus dieser Zeit kaum diskursiv behandelt wurden.
Leider fehlen Beiträge zur Bedeutung der Frankfurter Schule, zur Friedensethik bzw. zur damals kontrovers verhandelten Gewaltthematik. Gelegentlich werden aus Einzelereignissen zu pauschale Urteile für die Gegenwart gezogen, etwa wenn aufgrund des veränderten Wahlverhaltens von Mitgliedern einer einzigen Landeskirche gefolgert wird, dass die Politisierung des Protestantismus heute passé sei:
"Für die aktiven Kirchenmitglieder heute steht nicht mehr politisches Engagement im Vordergrund, sondern, neben der Wahrnehmung der Kasualien, vor allem die Pflege des persönlichen Glaubens."
Täuscht der Eindruck nicht, werden Kirchen gegenwärtig allerdings wieder wie in den 1950er Jahren in der Öffentlichkeit und von Politikern vor allem als moralische Instanzen wahrgenommen, woran sie selber nicht unschuldig sind. Dass das Evangelium auf die Rechtfertigung des gottlosen Menschen und nicht auf die Veredlung des Tugendhaften abzielt, droht darüber in Vergessenheit zu geraten.
Es ist nicht das geringste Verdienst des gut lesbaren Sammelbandes, dass er zeigt, wie viel der heutige Protestantismus vergangenen politischen Auseinandersetzungen verdankt, welche intellektuellen Potenziale er für die Weltgestaltung hat und wie anstrengend aber auch ergiebig und notwendig theologische Diskurse zu politischen Themen sind. Gerade in Zeiten, in denen im politischen Leben Inhalte, Konzepte und Handlungsoptionen zugunsten einer Orientierung an blassen Hoffnungsträgern und einer Vorliebe für moralisierende Statements marginalisiert werden, hat der Protestantismus einerseits eine Instrumentalisierung der Kirche durch die Politik abzuwehren und andererseits zu behaupten, dass es keine Bereiche unseres Lebens gibt, die sich dem Einflussbereich Gottes entziehen. Politische Abstinenz und Orientierung an einem nur noch privaten "Kuschelgott" (F.W. Graf) verbieten sich daher ebenso wie politischer Aktionismus, der ideologieanfällig und ohne Sensibilität für den Unterschied zwischen Letztem und Vorletztem das Reich Gottes auf Erden errichten möchte.
Protestantismus und Politik lassen sich nicht vorschnell auseinander dividieren oder auf einen Nenner bringen, und es ist kein Manko, dass die Herausgeber am Ende kein schnelles Fazit ziehen, sondern Fragen von bleibender Relevanz formulieren. Etwa:
"Inwiefern wirkte die Politisierung der Gesellschaft auf die Politisierung des Protestantismus ein, inwiefern strahlt die Politisierung des Protestantismus auf die Gesellschaft ab? Ging die Politisierung des Protestantismus 'von unten', 'von oben' oder von einer komplexen Wechselwirkung beider Pole aus?"
Wer in seiner Urteilsbildung diesbezüglich weiterkommen möchte, wird von den Anregungen und den leserfreundlichen Zusammenfassungen von Diskussionsabläufen profitieren.
K. Fitschen, S. Hermle, K. Kunter, C. Lepp, A. Roggenkamp-Kaufmann (Hgg.): Die Politisierung des Protestantismus. Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland während der 1960er und 70er Jahre
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011
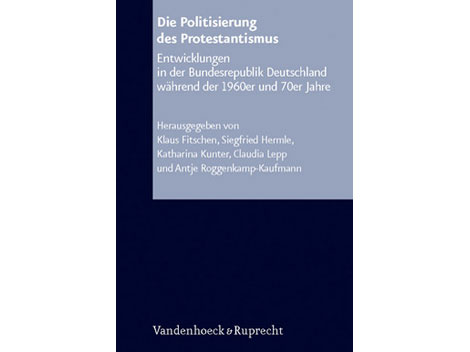
Cover: "Die Politisierung des Protestantismus" von K. Fitschen et al.© Vandenhoeck & Ruprecht
