Zwischen Kalkül und Empfindsamkeit
Zum 150. Geburtstag Gustav Mahlers erscheinen einige neue Biographien, darunter die von Constantin Floros, die sehr detailliertes musikalisches Wissen ausbreitet. Wenn man parallel dazu die von Franz Willnauer herausgegebenen Briefe Mahlers liest, rundet sich das Bild des Komponisten ab.
Mahler, im Monat zuvor Direktor der Königlichen Ungarischen Oper geworden und u.a. mit zu üppigen Gehaltsforderungen der erfolgreichen Sängerin Hermine Braga beschäftigt, schreibt am 7. Oktober 1888 an den Theateragenten Gustav Lewy:
"Werter Freund! Gewiß möchte ich sehr gerne auf Frau Braga reflectiren - aber ich kann doch die hiesigen Verhältnisse nicht umgestalten - ich kann bloß innerhalb der mir gegebenen Sachlage disponiren, und muss daher auf meinen Propositionen stehen bleiben. Da auch ich mich baldigst entscheiden muss (...), bitte ich Sie, mir sofort mitzutheilen, ob aufgrund meiner Offerte eine Einigung erzielt werden kann."
Zusammen mit dem Herausgeber staunt der Leser nicht schlecht, wie schnell sich der gerade mal 28-Jährige als routinierter Theaterdirektor erwies. Der Komponist tritt in diesem Band zunächst nicht in Erscheinung. Man glaubt, er wäre von den Verwaltungsgeschäften so absorbiert gewesen, dass er weder zum Komponieren, noch zum Dirigieren Zeit gefunden hätte.
Weit gefehlt. Mit einem Feuereifer sondergleichen stürzte er sich von einem Dirigat ins andere und von einem Musiktheater ins nächste. Nirgendwo schien es den Dirigenten zu halten, kompromisslos, wie er war. Tauchte eine Schwierigkeit auf, die ihm nicht ins ästhetische Konzept passte, kündigte er nicht selten vorzeitig seinen Vertrag. Prag, Leipzig, Budapest, Hamburg waren seine Stationen, um nur die wichtigsten zu nennen.
Seine ganze Unrast galt jedoch einem Ziel: es schließlich an die Spitze der Wiener Hofoper zu schaffen und nach Österreich, woher er kam, zurückzukehren. Im Brief vom 22. Dezember 1896 an Rosa Papier, eine Gesangslehrerin, die über Einfluss in Wiens Opernkreisen verfügte, heißt es:
"Wie glücklich ich mich schätzen würde, nach langen Wanderjahren endlich in meiner Heimat wirken zu dürfen, können Sie kaum ermessen. Manchmal kommt ein solches 'Heimweh' über mich, dass ich mir wirklich alle Mühe geben muss, nicht zu verzagen."
Das mit dem Heimweh war nicht geheuchelt. Aber wenn es um sein berufliches Fortkommen ging, konnte er schon mal nach Mitleid heischen. Weil er wusste, dass ihm der Ruf des nervösen Exzentrikers vorausging, fügte er in dem zitierten Brief die Sätze hinzu:
"Dass ich in dem Rufe eines Verrückten stehe, weiß ich sehr wohl. Aber auch Sie werden ermessen, was für eine Art Mensch das zu sein pflegt, der sich dieses Epithetons erfreut."
Hier drückte er auf die Tränendrüse. Mit Erfolg. Im April 1897 wurde er zum Kapellmeister ernannt, im Oktober desselben Jahres zum artistischen Direktor der K.u.K.-Oper in Wien. Es war die Krönung seiner Laufbahn als Dirigent fremder Werke.
Als der seiner eigenen stand ihm der phänomenale Auftritt mehr als zehn Jahre später noch bevor. Da lag seine Zeit in Wien schon lange zurück, er war zum gefeierten internationalen Star an der New Yorker Met geworden. Längst galt der große Zuspruch nicht mehr nur dem außergewöhnlichen Dirigenten. Er galt zugleich dem genialen Komponisten.
Der unternahm alles nur Erdenkliche, um seine Musik zu Gehör zu bringen. Zum Beispiel die "Symphonie der Tausend", seine Achte, an der sogar mehr als 1000 Teilnehmer mitwirkten. Es ist der Höhepunkt, auf den der Briefband Willnauers zusteuert.
Am 12. September 1910 sollte die Achte in München aufgeführt werden. Die Vorbereitungen sprengten so sehr das bislang gewohnte Maß, dass sich der Konzertunternehmer Emil Gutmann, der die Organisation übernahm, zu einer Art frühem Marketing nebst Gründung eines Ehrenkomitees zur Absicherung des Ganzen veranlasst sah. Das ging Mahler gehörig gegen den Strich. Im März 1910 schrieb er ihm von New York aus:
"Lieber Herr Gutmann, (...) lassen Sie alle Comitéterei und (völlig überflüssige) Reklame. Um ein Conzert zu machen, braucht man kein Comité. Und ich hasse das Alles, und ich fühle mich prostituiert bei solchem Humbug. Entweder fühle ich mich bei meiner Ankunft in Europa befriedigt bezüglich der künstlerischen Bedingung, (...) oder ich bin nicht befriedigt vom Stand der Dinge, und dann sage ich Ihnen augenblicklich und definitiv ab! (...) Nochmals: kein Comité! Ich verbitte mir Alles dergleichen!"
Da haben wir den Despoten Mahler, der nicht selten mit imperatorischer Geste Entscheidungen verfügte. Emil Gutmann aber ließ sich von ihm nicht beeindrucken und vermarktete die Aufführung seelenruhig weiter, bis die Halle mit 3000 Plätzen ausverkauft war. Es wurde Mahlers größter Erfolg. Der Herausgeber zitiert den Autor Paul Stefan:
"Der letzte Ton verklang. Die Stille hielt an. Plötzlich brachen die Viertausend, Hörer wie Ausführende, los, und dieser Sturm währte fast eine halbe Stunde."
Der Kommentar dazu von Willnauer:
"Man feierte den Komponisten wie den Dirigenten, der vielen schon wie vom Tod gezeichnet erschien."
Kein Jahr später starb Mahler, mit nicht einmal 51 Jahren. Der Briefband enthält mehr als nur diesen Spannungsbogen, der sich von den frühen Anfängen des noch unbekannten Kapellmeisters bis zum weltberühmten Komponisten erstreckt. Man findet u.a. interessante Briefe zur Beziehung von Mahler und Richard Strauss.
Mahler schätzte Strauss, besonders seine Oper "Salome". Von seinem symphonischen Schaffen war er jedoch nicht so überzeugt. Das erfahren wir vom Biographen Constantin Floros, der folgende Einschätzung gibt:
"Zeit seines Lebens stand Mahler als Komponist im Schatten seines weit berühmteren Freundes und Rivalen (...) Manche hellsichtigen Kritiker hatten allerdings erkannt, dass sich das Verhältnis im Laufe der Zeit ändern würde. So formuliert Ernst Otto Nodnagel den Satz: 'Strauss hat die Gegenwart, Mahler gehört die Zukunft.' Nodnagels Prophezeiung hat sich bewahrheitet. Heute erfreuen sich die Symphonien Mahlers weit größerer Beliebtheit."
Apropos: Floros erwähnt auch, dass Mahler die Achte als eine Art Messe verstand. Nicht nur sie ist voller religiöser Anspielungen. Auch die Vierte, in dessen ebenfalls 4. Satz das Gedicht "Der Himmel hängt voll Geigen" aus von Arnims "Des Knaben Wunderhorn" vertont wird - eine Art himmlische Wirtschaft, mit Brot backenden Engeln und Wein, der keinen Heller kostet. Alle genießen dieses himmlische Leben, das weltliche Getümmel ist fern und "St. Peter im Himmel sieht zu."
Wir lernen indes von Floros, dass Geigen bei Mahler als Toteninstrumente gelten, wie überhaupt diese Biografie sehr detailliertes musikalisches Wissen ausbreitet. Am besten, man liest sie neben dem Briefband. Dann weiß man auch, unter welchen Spannungen Mahler während der triumphalen Aufführung seiner Achten gelitten haben muss: Alma, seine Frau, war ihm untreu geworden. Auch ein erotischer Rivale überschattete die letzten Monate dieses großen Künstlers, der zwar nach außen ein Despot, nach innen aber ein weichherziger Mann war.
Constantin Floros: Gustav Mahler
C.H. Beck Verlag, München 2010
und
Gustav Mahler: "Verehrter Herr College!" Briefe an Komponisten, Dirigenten, Intendanten
herausgegeben und kommentiert von Franz Willnauer
Paul Zsolnay Verlag, Wien2010
"Werter Freund! Gewiß möchte ich sehr gerne auf Frau Braga reflectiren - aber ich kann doch die hiesigen Verhältnisse nicht umgestalten - ich kann bloß innerhalb der mir gegebenen Sachlage disponiren, und muss daher auf meinen Propositionen stehen bleiben. Da auch ich mich baldigst entscheiden muss (...), bitte ich Sie, mir sofort mitzutheilen, ob aufgrund meiner Offerte eine Einigung erzielt werden kann."
Zusammen mit dem Herausgeber staunt der Leser nicht schlecht, wie schnell sich der gerade mal 28-Jährige als routinierter Theaterdirektor erwies. Der Komponist tritt in diesem Band zunächst nicht in Erscheinung. Man glaubt, er wäre von den Verwaltungsgeschäften so absorbiert gewesen, dass er weder zum Komponieren, noch zum Dirigieren Zeit gefunden hätte.
Weit gefehlt. Mit einem Feuereifer sondergleichen stürzte er sich von einem Dirigat ins andere und von einem Musiktheater ins nächste. Nirgendwo schien es den Dirigenten zu halten, kompromisslos, wie er war. Tauchte eine Schwierigkeit auf, die ihm nicht ins ästhetische Konzept passte, kündigte er nicht selten vorzeitig seinen Vertrag. Prag, Leipzig, Budapest, Hamburg waren seine Stationen, um nur die wichtigsten zu nennen.
Seine ganze Unrast galt jedoch einem Ziel: es schließlich an die Spitze der Wiener Hofoper zu schaffen und nach Österreich, woher er kam, zurückzukehren. Im Brief vom 22. Dezember 1896 an Rosa Papier, eine Gesangslehrerin, die über Einfluss in Wiens Opernkreisen verfügte, heißt es:
"Wie glücklich ich mich schätzen würde, nach langen Wanderjahren endlich in meiner Heimat wirken zu dürfen, können Sie kaum ermessen. Manchmal kommt ein solches 'Heimweh' über mich, dass ich mir wirklich alle Mühe geben muss, nicht zu verzagen."
Das mit dem Heimweh war nicht geheuchelt. Aber wenn es um sein berufliches Fortkommen ging, konnte er schon mal nach Mitleid heischen. Weil er wusste, dass ihm der Ruf des nervösen Exzentrikers vorausging, fügte er in dem zitierten Brief die Sätze hinzu:
"Dass ich in dem Rufe eines Verrückten stehe, weiß ich sehr wohl. Aber auch Sie werden ermessen, was für eine Art Mensch das zu sein pflegt, der sich dieses Epithetons erfreut."
Hier drückte er auf die Tränendrüse. Mit Erfolg. Im April 1897 wurde er zum Kapellmeister ernannt, im Oktober desselben Jahres zum artistischen Direktor der K.u.K.-Oper in Wien. Es war die Krönung seiner Laufbahn als Dirigent fremder Werke.
Als der seiner eigenen stand ihm der phänomenale Auftritt mehr als zehn Jahre später noch bevor. Da lag seine Zeit in Wien schon lange zurück, er war zum gefeierten internationalen Star an der New Yorker Met geworden. Längst galt der große Zuspruch nicht mehr nur dem außergewöhnlichen Dirigenten. Er galt zugleich dem genialen Komponisten.
Der unternahm alles nur Erdenkliche, um seine Musik zu Gehör zu bringen. Zum Beispiel die "Symphonie der Tausend", seine Achte, an der sogar mehr als 1000 Teilnehmer mitwirkten. Es ist der Höhepunkt, auf den der Briefband Willnauers zusteuert.
Am 12. September 1910 sollte die Achte in München aufgeführt werden. Die Vorbereitungen sprengten so sehr das bislang gewohnte Maß, dass sich der Konzertunternehmer Emil Gutmann, der die Organisation übernahm, zu einer Art frühem Marketing nebst Gründung eines Ehrenkomitees zur Absicherung des Ganzen veranlasst sah. Das ging Mahler gehörig gegen den Strich. Im März 1910 schrieb er ihm von New York aus:
"Lieber Herr Gutmann, (...) lassen Sie alle Comitéterei und (völlig überflüssige) Reklame. Um ein Conzert zu machen, braucht man kein Comité. Und ich hasse das Alles, und ich fühle mich prostituiert bei solchem Humbug. Entweder fühle ich mich bei meiner Ankunft in Europa befriedigt bezüglich der künstlerischen Bedingung, (...) oder ich bin nicht befriedigt vom Stand der Dinge, und dann sage ich Ihnen augenblicklich und definitiv ab! (...) Nochmals: kein Comité! Ich verbitte mir Alles dergleichen!"
Da haben wir den Despoten Mahler, der nicht selten mit imperatorischer Geste Entscheidungen verfügte. Emil Gutmann aber ließ sich von ihm nicht beeindrucken und vermarktete die Aufführung seelenruhig weiter, bis die Halle mit 3000 Plätzen ausverkauft war. Es wurde Mahlers größter Erfolg. Der Herausgeber zitiert den Autor Paul Stefan:
"Der letzte Ton verklang. Die Stille hielt an. Plötzlich brachen die Viertausend, Hörer wie Ausführende, los, und dieser Sturm währte fast eine halbe Stunde."
Der Kommentar dazu von Willnauer:
"Man feierte den Komponisten wie den Dirigenten, der vielen schon wie vom Tod gezeichnet erschien."
Kein Jahr später starb Mahler, mit nicht einmal 51 Jahren. Der Briefband enthält mehr als nur diesen Spannungsbogen, der sich von den frühen Anfängen des noch unbekannten Kapellmeisters bis zum weltberühmten Komponisten erstreckt. Man findet u.a. interessante Briefe zur Beziehung von Mahler und Richard Strauss.
Mahler schätzte Strauss, besonders seine Oper "Salome". Von seinem symphonischen Schaffen war er jedoch nicht so überzeugt. Das erfahren wir vom Biographen Constantin Floros, der folgende Einschätzung gibt:
"Zeit seines Lebens stand Mahler als Komponist im Schatten seines weit berühmteren Freundes und Rivalen (...) Manche hellsichtigen Kritiker hatten allerdings erkannt, dass sich das Verhältnis im Laufe der Zeit ändern würde. So formuliert Ernst Otto Nodnagel den Satz: 'Strauss hat die Gegenwart, Mahler gehört die Zukunft.' Nodnagels Prophezeiung hat sich bewahrheitet. Heute erfreuen sich die Symphonien Mahlers weit größerer Beliebtheit."
Apropos: Floros erwähnt auch, dass Mahler die Achte als eine Art Messe verstand. Nicht nur sie ist voller religiöser Anspielungen. Auch die Vierte, in dessen ebenfalls 4. Satz das Gedicht "Der Himmel hängt voll Geigen" aus von Arnims "Des Knaben Wunderhorn" vertont wird - eine Art himmlische Wirtschaft, mit Brot backenden Engeln und Wein, der keinen Heller kostet. Alle genießen dieses himmlische Leben, das weltliche Getümmel ist fern und "St. Peter im Himmel sieht zu."
Wir lernen indes von Floros, dass Geigen bei Mahler als Toteninstrumente gelten, wie überhaupt diese Biografie sehr detailliertes musikalisches Wissen ausbreitet. Am besten, man liest sie neben dem Briefband. Dann weiß man auch, unter welchen Spannungen Mahler während der triumphalen Aufführung seiner Achten gelitten haben muss: Alma, seine Frau, war ihm untreu geworden. Auch ein erotischer Rivale überschattete die letzten Monate dieses großen Künstlers, der zwar nach außen ein Despot, nach innen aber ein weichherziger Mann war.
Constantin Floros: Gustav Mahler
C.H. Beck Verlag, München 2010
und
Gustav Mahler: "Verehrter Herr College!" Briefe an Komponisten, Dirigenten, Intendanten
herausgegeben und kommentiert von Franz Willnauer
Paul Zsolnay Verlag, Wien2010
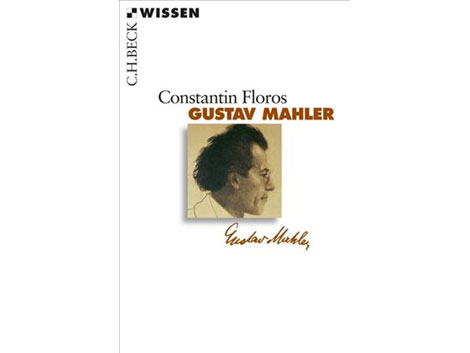
Constantin Floros: "Gustav Mahler"© Verlag C.H.Beck
