Wohlfühlfaktor Energiewende?
In immer mehr Städten öffnen Bio-Supermärkte. Der Widerstand gegen Kernkraft und Fracking ist groß. Doch es gibt auch Kritk am Engagement für die Umwelt: Wird Nachhaltigkeit zu einer Art Ersatzreligion? Darüber sprechen wir mit Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und dem Historiker Andreas Möller.
Maike Albath: Lesart Spezial, heute von der Leipziger Buchmesse. Einkaufen im Bio-Supermarkt mit dem Fahrrad, aber Fernreisen, iPhone und iPad. So sieht der Alltag vieler bundesdeutscher Großstädter aus. Welche Folgen wird die Energiewende haben? Ist sie nur ein Wohlfühlfaktor oder steht ein tatsächlicher Wandel an?
Wie es um die Deutschen und die Nachhaltigkeit bestellt ist, wollen wir in der Lesart diskutieren. Es gibt neue Bücher zum Thema. Zwei haben wir ausgesucht: „Kampf um Strom: Mythen, Macht und Monopole“ hat die Professorin für Energie, Ökonomie und Nachhaltigkeit Claudia Kemfert ihre Studie genannt. Guten Tag, Frau Kemfert.
Claudia Kemfert: Guten Tag, ich grüße Sie.
Maike Albath: Und Andreas Möller, Experte für Wissenschaft- und Technikkritik hat mit der Natur als Ersatzreligion abgerechnet. „Das grüne Gewissen. Wenn die Natur zur Ersatzreligion wird“ heißt sein neues Buch. Guten Tag, Herr Möller.
Andreas Möller: Guten Tag, Frau Albath.
Maike Albath: Im Titel klingt ja eine leise Kritik an. Haben Sie denn kein grünes Gewissen?
Andreas Möller: Doch, ich habe ein grünes Gewissen, das aber sehr individuell, ich glaube, wie bei vielen Menschen aus den Erfahrungen, Bildern, Projektionen, die ich an die Natur habe, gespeist ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Teil der ganzen Geschichte, dass wir zunehmend versuchen, Handlungen auch im Alltag zu individualisieren, zu privatisieren, zu entscheiden, was nachhaltig ist und was nicht. Wir kriegen einen gewissen Input auch durch die Diskurse, die in der Gesellschaft laufen. Aber natürlich habe ich ein grünes Gewissen, definitiv. Das Thema Natur ist für mich eine Herzensangelegenheit, aber nicht nur, sondern eben auch eines, das von Zeit zu Zeit auch eine kritische Revision braucht, vor allem hinsichtlich der Maßnahmen, von denen wir der Meinung sind, dass sie im Sinne der Natur sind und uns näher zur Natur bringen.
Maike Albath: Etwas, das man aus dem Buch von Andreas Möller erfährt, Claudia Kemfert, ist ja, dass er eigentlich bemerkt, dass sich in Deutschland doch so eine gewisse Technikfeindlichkeit breitgemacht hat. Teilen Sie diesen Eindruck?
Claudia Kemfert: Nein, den teile ich in keinster Weise, weil ich glaube, dass wir keine technikfeindliche Gesellschaft haben, sondern es geht um eine Technik der Vergangenheit versus Technik der Zukunft. Das ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung und keine emotionale oder rein romantische Entscheidung, wie Herr Möller ja in seinem Buch darlegt, sondern es ist wirklich auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Es ist nicht alles nur Romantik. Die Menschen wollen ja nicht den Menschen aus der Gesellschaft herausholen und nur noch die Natur haben, sondern es geht darum, dass wir reale Fakten haben.
Es gibt eine Begrenzung des Wachstums. Wir haben keinen Protest gegen Veränderungen. Die Energiewende ist nicht nur romantisch, sondern hat wirklich reale Gründe und nicht gefühlte Gründe. Ich glaube, da muss man schon deutlich hingucken, was man machen kann.
Ich teile die Ansicht, dass der Hype oder die Hysterie, die da beschrieben werden, überzogen sind. Aber die grundsätzliche Ablehnung von Klimaschutz, von Umweltschutz und auch des gesellschaftlichen Wandels, das finde ich dann doch ein bisschen zu viel.
Maike Albath: So weit geht Andreas Möller ja nicht, sondern es ist auch eine Beschreibung und der Versuch, kulturhistorisch zu erforschen, wie sich das mit der Beziehung zur Natur verhält in Deutschland. Ein Wort dazu, Andreas Möller: Sie haben ja bewusst diesen historischen Ansatz gewählt.
Andreas Möller: Wenn Sie mir gestatten, ich mache noch einen kurzen Schlenker. Wir sind hier auf dem Leipziger Messegelände, unweit des BMW-Werkes. Also: Natürlich sind die Deutschen keine technikfeindliche Nation, ganz im Gegenteil. Was das, was die Soziologen „Alltags- und Gebrauchstechnik“ nennen anbelangt, sind sie sogar ein technikaffines Volk. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wenn man sich die%ausgaben pro Haushalt für Kühlschränke, Waschmaschinen, neue Automobile, iPhones und so weiter anguckt, dann liegen wir im europäischen Durchschnitt sogar ganz oben, in einem interessanten Verhältnis übrigens zu den Ausgaben für Nahrungsmittel. – Darum geht es nicht.
Es gibt aber eine spezifische Phobie gegenüber Großtechnologien, die durchaus historisch gewachsen ist. Die Technik als Staatstechnik, und das kann man am Energiesektor sehr, sehr gut zeigen, ist in Deutschland vollkommen anders konnotiert als das zum Beispiel in Frankreich oder in den Vereinigten Staaten, in der ehemaligen DDR, in der Sowjetunion und in vielen anderen Staaten auch der Fall ist. Das hat viele Elemente, aber sie führen mich am Ende zu dem Punkt, warum die Energiewende zumindest als Programm in Deutschland ganz gut funktioniert und bislang – damit ist jetzt der gefühlte Sektor gemeint – auch noch nicht auf größere Widerstände gestoßen ist.
Wir sind sehr landsmannschaftlich geprägt. Das mag ein bisschen pittoresk klingen, aber small is beautiful. Das ist ein gewisser Rückfall auch in Dezentralitäts- und Autarkiemetaphern, das kann man bei Frau Kemfert sehr schön lesen. Wenn wir angesichts eines EU-Binnenmarktes, der 2014 in Europa herrschen wird und die freie Wahl des Einkaufs auch von Energie ermöglicht, wenn wir dort anfangen, von energieautarken Dörfern in Brandenburg, in Bayern zu sprechen, dann ist das für mich eine Form von Idealisierung, die mit der globalen Vernetzung, die wir nicht nur im Energiebereich, aber auch gerade dort erleben, nicht zu tun hat.
Noch mal zu Ihrer Frage zurück, wenn Sie das gestatten. Machen wir es kurz: Ich glaube, das Stichwort der Romantik als eine emotionale Antwort des einen, in der Natur zu sein, auch mit Gott, eine Antwort auf die Aufklärung im 19. Jahrhundert, das ist ein gängiger Topos, der immer wieder gebraucht wird. Ich glaube, wenn man irgendwo auf der Straße die Probe aufs Exempel machen würde, wie weit das mit dem Verständnis der Romantik, was sie eigentlich meint, her ist, dann würde man doch das eine oder andere merkwürdige Ergebnis haben.
Aber ich glaube, was entscheidend ist auch für das Technikbild heute noch, der gesamte Kernenergiediskurs, den wir haben, ist wie in keinem anderen Land geprägt von einer Melange aus friedlicher und so genannter nicht friedlicher Nutzung der Kernenergie; Deutschland als Aufmarschplatz der Supermächte; die latente Gefahr eines atomaren Krieges; die Waldsterbensdebatte parallel 1982 und 1983 bis zu Tschernobyl: All das prägt bis heute aus.
Maike Albath: Aber es spricht ja auch für ein Bürgerbewusstsein, wenn man sich zum Beispiel über die Nachsorge überhaupt Gedanken macht, auch zu der die Frage, wie Atomkraftwerke, die abgeschaltet werden, rückgebaut werden können. Frau Kemfert, das Stichwort war Dezentralisierung.
Claudia Kemfert: Ich halte es für grundfalsch, dass man jetzt meint, dass die Energiewende in Deutschland eine Autarkie hervorbringt. Das ist überhaupt nicht die Motivation. Es geht darum, dass man einerseits eine dezentrale Energieversorgung haben wird, also beispielsweise Solaranlagen auf dem Dach, Biomasseanlagen oder auch Windanlagen. Aber es wird durchaus auch Großprojekte geben, auch in Europa. Da stimme ich mit Herrn Möller überhaupt nicht überein. Denn es geht ja gerade darum, das zusammenzubringen, dass man einerseits die Großprojekte hat, wie beispielsweise Solaranlagen auch im Süden, Wind- und Wasserkraft, Speichertechnologie im Norden, und dass man das zusammenbringt.
Ich finde in dem Buch von Herrn Möller doch eine sehr starke Verklärung der Atomkraft als eine Technik der Vergangenheit, die wir auch in der Zukunft brauchen. Das, glaube ich, ist doch ein bisschen sehr romantisch gedacht, wenn Sie mir das erlauben. Einerseits sind Sie ja jemand, der das kritisiert. Andererseits habe ich den Eindruck, dass Sie die Atomenergie romantisieren. Wenn Sie da von Ihren Begegnungen durch stillgelegte Atomkraftwerke berichten, finde ich das dann doch etwas schizophren, muss ich fast sagen.
Und ich glaube auch, dass Sie uns sagen müssten, für wen Sie heute eigentlich arbeiten. Herr Möller, ich glaube, dass das etwas ist, was auch die Intention dieses Buches deutlich macht. Das ist eine Kampfschrift gegen den Klimaschutz, gegen Umweltschutz, gegen gesellschaftliche Prozesse im Bereich der Energiewende. Und die sind aus meiner Sicht auch wirtschaftlich motiviert. Und das fände ich sehr fair, wenn wir das auch erfahren würden, warum Sie das aufschreiben.
Andreas Möller: Ja, das haben wir im Prinzip schon erfahren, weil Sie das ja coram publico mitgeteilt haben. Ich fange mal vorne an mit dem Punkt der Kernenergie. Wenn Sie es nicht rausgelesen haben, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, das im Nachhinein einzufordern. Dieses Buch ist – man mag es kaum glauben – so etwas wie ein Hybrid. Es hat durchaus literarische Züge. Gerade das Kapitel, das Sie ansprechen, ist weniger wehmütig gemeint im Sinne einer Technologie, an die sich mein Herz klammert, sondern es ist eher die Besichtigung eines technischen Zeitalters, das so nicht mehr kommen wird.
Das hat unmittelbar damit zu tun, dass ich die 60er Jahre, die 70er Jahre sehr stark reflektiere. Warum ist Deutschland an diesen Stellen so geworden, wie es geworden ist? Es ist kein Zufall, wenn wir mal im Sinne der Natur denken, dass die Kernkraftwerke genau dort entstanden sind, wo sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg industrialisiert hat, nämlich da, wo man revierfern war, dort, wo es große Flussläufe gab, dort in Baden-Württemberg, im Rhein-Main-Gebiet oder auch in Bayern, da, wo heute die großen Wirtschaftszentren sind.
Nichts liegt mir ferner als der Versuch, eine Technologie, die sich seit 30 Jahren als schwierig erwiesen hat in der Gesellschaft, auf Teufel kommt raus zu verteidigen. Ich stelle nur gewisse Fragen, wie es hinsichtlich der Konsequenz der sehr emotional schnell vollzogenen Maßnahmen im März 2011 bestellt ist. Die Energiewende – das schreiben Sie ja auch vollkommen zu Recht – ist ja etwas, was vollkommen losgelöst ist von dem Thema Fukushima. Das Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG), der beschlossene Ausbau der erneuerbaren Energien, der ist seit dem rot-grünen Atomkonsens und, wie gesagt, dem Thema EEG, ist seit dem Anfang der 2000er Jahre da. Das hat nur einen zusätzlichen Schub gegeben.
Ich habe, wenn wir tatsächlich über Personen reden wollen, und wir können gerne auch über Ihre Person reden und die Frage stellen, welche Position Sie dort einnehmen, ob es eine wissenschaftliche Neutralität gibt oder ob Sie sich durchaus als Promoterin auch der erneuerbaren Energien verstehen, wie Sie das ja am Anfang schreiben, was ich absolut souverän finde. Ein Wort zu meiner Person: Es ist mittlerweile das dritte Buch, das sich mit den Themen Natur, Gesellschaft und Technik auseinandersetzt – in einer etwas anderen Form. Ich bin für ein Unternehmen tätig, das ist richtig, seit einem Jahr. Das tue ich. Und ich war vorher im Bereich der Politikberatung für eine der beiden nationalen Wissenschaftsakademien. Dort ist die ganze Reflektion Technik, Gesellschaft im Guten wie im Schlechten auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Es gibt Leute, die die oder die andere Position auch haben.
Maike Albath: Und das ist ja auch so, dass interessengeleitete Argumentation durchaus ihre Bedeutung und ihre Funktion hat.
Claudia Kemfert: Absolut.
Maike Albath: Wir müssen ja ins Gespräch kommen und uns austauschen über die verschiedenen Positionen. Claudia Kemfert, ich finde schon, dass bei Andreas Möller deutlich wird, er spricht ja auch ganz andere Bereiche der Gesellschaft an, zum Beispiel die Medizin, die Erwartung, dass man perfekt versorgt wird, auf der anderen Seite aber eine Impfmüdigkeit oder ein Desinteresse an bestimmten Entwicklungen. Und ich glaube, es ist so diese Doppelung, dass man auf der einen Seite sehr teilhaben will an der modernen Welt, aber dennoch immer annimmt, dass der Strom wirklich aus der Steckdose kommt, also diese ganz alte Frage, und dass es so eine gewisse Biedermeierlichkeit gibt in einer bestimmten bürgerlichen Schicht und so eine Tendenz zum Reaktionären. – Würden Sie das nicht teilen?
Claudia Kemfert: Durchaus. Und da, finde ich, hat Herr Möller auch wichtige Punkte angesprochen, die ich teilweise auch teile, weil ich im privaten Bekanntenkreis genügend Personen kenne, die sich ähnlich verhalten, auch ähnlich schizophren verhalten. Das finde ich auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite, und da komme ich noch mal zu der interessengeleiteten Argumentation zurück, finde ich das völlig in Ordnung, wenn man es dann auch deutlich macht. Deswegen ist in meinem Buch auch das Anliegen, gleich zu Anfang zu sagen: Ich bin Wissenschaftlerin, ich beschäftige mich seit 25 Jahren damit, aber ich stehe auf einer Seite, nämlich dass ich es richtig finde, die Energiewende zu machen.
Das jetzt als Romantik abzutun, als seien wir alle völlig verblendet, weil wir nur Fukushima und gefühlten Risiken hinterher leben, das, glaube ich, ist so nicht richtig. Und an diversen Stellen ist es mir dann auch teilweise nicht ganz klar. Denn Sie sprechen zu Recht an, es geht ja darum, dass man Menschen auch so ein bisschen den Finger in die Wunde legen soll. Warum verhalten sie sich so? Warum haben wir eine Impfmüdigkeit? Warum kaufen Menschen im Bio-Supermarkt? – Aber all das jetzt so lächerlich zu machen und zu sagen, na ja, warum machen die das überhaupt, eigentlich bräuchten wir das doch gar nicht, das finde ich dann schon schade, weil das Thema an sich gut ist, das auch zu beleuchten und auch deutlich zu machen: Lasst uns in eine Welt gehen. Und das ist auch am Ende des Buches von Herrn Möller, da stimme ich völlig überein, ein positiver Ausblick. Ich glaube, so weit auseinander sind wir gar nicht.
Nur eben diese Zurückblende, dass diejenigen, die sich für Umwelt und Klimaschutz engagieren, sei es wie auch immer, dann lächerlich gemacht werden, das finde ich ein bisschen schade.
Maike Albath: Ich glaube, es ist einfach der Punkt, dass Sie, Andreas Möller, deutlich machen wollen, dass es eine Realitätsverleugnung ist, wenn wir nur noch Manufactum-Waren kaufen und uns nicht mehr darum kümmern, wo das eigentlich herkommt.
Herr Möller, am Ende Ihres Buches plädieren Sie ja für eine heitere Gelassenheit. Wie sähe denn idealerweise die Gesellschaft aus, eine moderne Gesellschaft, die mit den Herausforderungen umgehen kann?
Andreas Möller: Das ist jetzt ein großes Wort, wenn ich am Ende dieses Buches vom Versuch einer Naturphilosophie spreche. Ich glaube, dass es an Hybris grenzt, die falsch ist, wenn wir glauben, dass wir der Garant der Natur sind in all dem, was wir tun. Ich glaube, dass es wichtig ist, anders als die Natur, die ganz unmittelbar ist und keinen freien Willen kennt, dass es wichtig ist und geradezu das Signum der menschlichen Kultur, dass wir das, was wir tun, auch reflektieren können und entsprechende Kurskorrekturen vornehmen können. – Das sehe ich auch so.
Aber ich glaube, wir sollten uns – und das meine ich mit „heiterer Gelassenheit“ – nicht zurücklehnen, aber Vertrauen in uns selbst haben. Denn der Punkt, an dem wir heute als Gesellschaft stehen, dass wir uns gewissermaßen in einem postmaterialistischen Wertebegriff bewegen, der in der Stringenz unserer Entwicklung liegt, dieser Weg hat uns mit einer hohen Konsequenz zu den Diskursen geführt, die wir heute in der Gesellschaft führen. Und genau das ist etwas, was ich absolut unterstütze.
Ich glaube einfach nur, dass wir uns der Konsequenz unserer Maßnahmen wieder neu bewusst werden müssen und auch der Bedeutung, die die Natur in diesem Zusammenhang spielt. Ich glaube nicht nur, dass wir – empirisch gesprochen – nie so weit von der Natur entfernt waren, wie heute, sondern dass uns etwas in den Schoß fällt, was wir als eine Metapher für Werte gebrauchen, die wir in der Gesellschaft ansonsten zunehmend vermissen.
Ich will das jetzt nicht in die Länge ziehen. Aber von der gewollten Bindungslosigkeit bis hin zur Karriereplanung ist heute nicht so sehr en vogue wie die Selbstbestimmtheit. Gleichzeitig gibt es den Wunsch an die Rückbindung, an einen anderen Zusammenhang und Werte, die über das rein Materielle hinausweisen. Ich möchte einfach, dass wir ernst machen mit den vollmundigen Ankündigungen, die wir haben. Autoren neigen ja immer so ein bisschen dazu, sich selbstironisch noch mal über die Schulter zu schauen, dass sie ihren eigenen Kosmos für die Welt halten. Ich glaube, der Kosmos, in den wir drei uns vielleicht bewegen, ist nicht unbedingt repräsentativ für das, was in Deutschland ist. Aber Sie sehen doch, dass die dritte Landtagswahl in Folge jetzt mit an die Grünen gegangen ist; dass Printprodukte wie „Landlust“ mittlerweile ein Millionenpublikum finden, wenn man die Ableger auch mit dazu zählt; und dass so ein gewisser Hang zur Behaglichkeit, gleichzeitig mit dem hohen moralischen Anspruch der Nachhaltigkeit zu bemerken ist.
Und ich frage einfach: Wie sieht es aus mit unserem permanenten Anspruch auf digitale Innovation, mit dem Anspruch auf Mobilität? Ich glaube, ein heute 19-Jähriger hat schon einen größeren CO2-Footprint als mein Großvater in seinem ganzen Leben gehabt hat.
Maike Albath: Das ist etwas, was man aus dem Buch von Andreas Möller erfahren kann, auch, dass Natur immer etwas Gemachtes ist, etwas Geschaffenes vom Menschen. Es heißt „Das grüne Gewissen“ und liegt bei Hanser vor. Der Band von Claudia Kemfert ist „Kampf um Strom“ betitelt. Claudia Kemfert, ist diese Wende, die Energiewende möglicherweise das neue Stuttgart 21 oder der Flughafen Berlin-Brandenburg?
Claudia Kemfert: Na, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir das besser machen. Aber ich muss leider sagen, im Moment ist das Management dieses wichtigen Projektes ein reines Desaster. Und es droht so etwas zu werden wie ein Stuttgart 21. Aber grundsätzlich halte ich das Projekt für richtig. Ich glaube auch, dass man es schaffen kann, die Energieversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen, Energie einzusparen, wegzukommen von der alten Technik. Und dass das auch wirtschaftlich machbar ist und dadurch viele Chancen in Deutschland entstehen, in neuen Arbeitsplätzen, in Veränderungen, die durchaus Sinn machen. Insofern ist es ein wichtiges Projekt und ich denke, man kann es auch schaffen.
Maike Albath: Wen macht Claudia Kemfert denn als Gegner der Energiewende aus, Andreas Möller?
Andreas Möller: Das ist natürlich ein Volltreffer. Das ganze Buch hat ja eine stark bellizistische Metaphorik, möchte ich das mal nennen. Man kann sehr, sehr viele Begriffe wie Schlacht, Kampf, Mythos und anderes mehr finden. Auch der Buchtitel, den fand ich sehr schön. Als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich, Felix Dahn: „Kampf um Rom“. Der steht bei uns zu Hause in einer ganz alten Ausgabe. Ich hatte ein bisschen Schiss vorm Lesen vor dem Interview, weil ich dachte, ich muss jetzt durch so einen Ben-Hur-mäßigen Wälzer durchkämpfen. Als ich das Cover dann gesehen habe, dachte ich ein bisschen an Dracula oder Schloss Schreckenstein. Es hat etwas sehr, sehr Dramatisches.
Maike Albath: Man muss dazu sagen, dass auf dem Cover Blitze abgebildet sind und ein Strommast. Es hat durchaus etwas Bedrohliches.
Claudia Kemfert: Und „Kampf um Rom“ ist ja eine Verfilmung mit entsprechenden Schauspielern der 60er Jahre. Insofern hat das schon eine Anlehnung. Es gibt wenige, die das auch tatsächlich wissen.
Maike Albath: Und dann noch die Alliteration „Mythen, Macht und Monopole“, auch das ein literarisches Stilmittel.
Andreas Möller: Ich antworte jetzt aber auf die Frage: In der Tat gibt es in Deutschland vier oder fünf, traditionelle, große Energieversorger, die etwas verloren haben. Die haben nicht nur durch Fukushima etwas verloren, sondern die sehen zunehmend ihre Geschäftsmodelle in Gefahr durch einen stärkeren Hang hin zur Dezentralität, zur Eigenversorgung, zum Aufbrechen alter Monopole. – Ich möchte es mal genauso wiedergeben.
Das sind gleichzeitig Unternehmen, die so viel wie niemand anderes im Bereich der erneuerbaren Energien, allein aus ganz knallharten ökonomischen Interessen, seit Jahren investieren. Ein Unternehmen wie E.ON oder wie RWE, ich weiß nicht, ob meine Zahlen noch aktuell sind, liegen ungefähr bei einem Investment von einer Milliarde Euro im Jahr. Bei RWE waren es Umsätze, die man halbiert und nur dafür zurücklegt. Das heißt, man hat sehr, sehr früh erkannt, dass zum Beispiel die Offshore-Technologie ein Geschäftsfeld sein würde, mit dem man punkten kann.
Das liegt am Erneuerbare Energien-Gesetz, an einer Einspeisevergütung, die sehr auskömmliche Renditen trotz der jetzt vom Bundesumweltminister Peter Altmaier eingebrachten Strompreisbremse bringen. Das ist die erste Gruppe der Lobbyisten, die Frau Kemfert sehr stark anspricht. Ich finde es fair, in meiner Gewichtung allerdings nicht ausreichend genug, dass sie auch einräumt, dass sich die Lobbylandschaft tatsächlich so fundamental verschoben hat im Hinblick auf die vielleicht etwas historischen Vorstellungen, die wir noch haben. Nicht-Regierungs-Organisationen wie Greenpeace oder der WWF agieren heute sehr, sehr professionell. Das Campaigning, das permanente Absondern von Meinungen im öffentlichen Raum ist flächenübergreifend. Insofern hat die Erneuerbare-Energien-Szene, das kann ich aus Berlin auch quantitativ berichten, eine sehr, sehr starke Lobby, die auch dabei ist.
Und dann geht es am Ende, auch um Unternehmen, die freigestellt sind, die so genannte energieintensive Industrie. Gestern habe ich auf einer Veranstaltung im Umweltministerium den Präsidenten des Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gehört: Wir liegen momentan bei einer EEG-Umlage von 5,3 Cent. Und der Präsident Arnold Wallraff hat gestern noch mal gesagt: Wenn wir alle Unternehmen von der chemischen Industrie bis zur Zementindustrie herausnehmen würden, würden wir von diesen 5,3 Cent momentan einen Cent einsparen. Aber die Kollateralschäden, die diese Unternehmen im internationalen Wettbewerb haben würden, die wären gewaltig …
Claudia Kemfert: …das müssen Sie ja sagen, weil Sie für ein Unternehmen arbeiten, das sehr, sehr energieintensiv ist und sich natürlich Sorgen darum macht. Das verstehe ich auch. Ich hätte es gut gefunden, wenn Sie es von Anfang an gesagt hätten. Aber das ist ein anderes Thema.
Maike Albath: Frau Kemfert, es steht ja im Klappentext, dass Herr Möller für die freie Wirtschaft arbeitet.
Claudia Kemfert: Gut, aber es wäre schön gewesen, wenn er sagt, er arbeitet für die energieintensiven Unternehmen. Deswegen verstehe ich ja auch das Anliegen. Das ist jetzt aber gar nicht mein Hauptpunkt.
Wer investiert im Moment in erneuerbare Energien? Das sind nicht die großen Vier. Es sind weder E.ON, noch RWE, die investieren auch, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, sind es mittlerweile über 50 Privathaushalte, also Menschen, die eine Solaranlage kaufen, Menschen, die sich in Energiegenossenschaften engagieren. Und das wird weiter zunehmen. In der Zukunft, da hat Herr Möller Recht, da werden auch die großen Vier mehr investieren, ganz klar, aber heute ist es so, dass gerade die Menschen investieren, die sich dezentral organisieren. Und das ist eine gute Entwicklung.
Das andere Thema, was angesprochen wurde, sind die Kosten, also die Umlage zur Förderung der erneuerbaren Energien. Die ist stark gestiegen aus den unterschiedlichsten Gründen, unter anderem deshalb, weil der Börsenpreis so stark sinkt, ein wichtiger Faktor für energieintensive Unternehmen, die davon ja auch wieder profitieren können. Insofern ist die Frage, was man auch von denen einfordern kann, wenn man jetzt eine faire Verteilung der Lasten einfordert. Aber ich glaube, wichtig ist hier, dass man verschiedene Konzepte umsetzt, um auch eine faire Verteilung zu haben.
Aber im Buch geht es mir darum, diese Lobbyisten darzustellen, deswegen spreche ich es auch so intensiv an: Lobbyisten, die ihre Interessen nicht offenlegen, sondern immer wieder gegen Klimaschutz argumentieren, immer wieder gegen die Energiewende argumentieren, um das ganze Projekt zu diskreditieren und gerade den Ökostrom zu stigmatisieren als nur teuer, unbezahlbar und nicht finanzierbar. – Das finde ich im Grunde genommen sehr schade, weil es hier um ein gutes und wichtiges Projekt geht.
Maike Albath: Und es geht ja auch darum, in Ihrem Buch zu zeigen, dass es nicht die gleichen Waffen sind, mit denen man kämpft. Man erfährt auch sehr viele Zahlen. Zahlen waren ja jetzt hier schon im Raum. Zum Beispiel, dass die großen Energieunternehmen in den letzten zehn Jahren unglaubliche Gewinne gemacht haben. Die haben sich versiebenfacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Herr Möller, eigentlich werden doch durch diese Umstellungen auch sehr viele neue Technologien befördert. Das müsste doch genau in Ihrem Sinne sein. Sie befürchten doch, dass Deutschland den Anschluss verliert bei diesen neuen Technologien.
Andreas Möller: Ich bin eigentlich ganz dankbar für den Punkt, an dem wir jetzt sind, weil er implizit bestätigt, was ich ein bisschen befürchte und was Ausdruck der Gemengelange ist, die wir gerade haben.
Der erste Punkt ist, und da würde ich auch intellektuell eine gewisse Trennung vornehmen: Das Projekt Energiewende zu diskreditieren, indem man sagt, dass ein Drittel der weltweit installierten PV-Zellen sich im Sonnenland Deutschland befinden, dass die EEG-Umlage, die Norbert Röttgen vor drei Jahren – Frau Kemfert kokettiert ja damit, dass es da gewisse Kontakte gab – noch bei 3,5 Cent lag, im Jahr 2010 bei 2 Cent lag, in diesem Jahr bei 5,3 Cent lag. Das ist nicht nur für Privathaushalte ein Schlag ins Kontor, wenn wir eine Steigerung von 160 bis 170 Prozent haben. Das ist vor allem für Unternehmen, die sich in Terawattstunden, also Millionen Kilowattstunden bewegen, richtig existenzgefährdend. Wenn Sie zum Beispiel ein Unternehmen der Aluminiumindustrie nehmen, wenn Sie dort die Befreiung von der EEG-Umlage kappen würden – die besondere Ausgleichsregelung nennt sich das in Deutsch –, dann hätte das ganz, ganz eklatante Folgen.
Zum Thema Wettbewerbsvorteil: Ich glaube, dass viele Unternehmen, von den Hightech-Herstellern bis zur Grundstoffindustrie, erkannt haben, dass dieses Thema – im Sinne auch eines systemischen Vorteils für die deutsche Industrie – ein großes Thema und auch ein großer Wettbewerb, ein Asset werden kann in den nächsten Jahren. Warum? Weil wir Agglomerationen weltweit sehen. Wir werden lokale Klimaschutzproblematiken auf dem Schirm haben. Die Bedeutung des Energieträgers Strom im Vergleich zu einer Regelenergie in Form von Öl oder Gas wird zunehmen. Das ist definitiv so.
Aber man darf das Kind eben nicht mit dem Bade ausschütten. Und das ist mein Grundanliegen in diesem Buch.
Wir können genauso an fossile Energien denken, an die Shellgasrevolution momentan in den Vereinigten Staaten und die Auswirkungen, die das Ganze auch hinsichtlich des Kohlemarktes hat. Auch das sind Technologien – wie CCS, wie Fracking, wie Clean coal – die es zum Beispiel für einen Forschungs- und Technologiestandort wie Deutschland auch im Sinne des Exportes zu fördern gilt.
An der Stelle noch ein kurzes Wort zu den Wettbewerbsvorteilen, die die Industrie angeblich durch die gesunkenen Börsenstrompreise hat. Das stimmt. Ich habe gestern selber auf die Seite geguckt. Wir liegen momentan am Terminmarkt ungefähr bei 40 Euro für die Megawattstunde. Wenn Sie umrechnen, dass die EEG-Umlage zurzeit bei 5,3 Cent pro Kilowattstunde liegt, dann kommen Sie auf einen Wert, der bei 53 Euro liegt. Man muss sich das mal vorstellen: Der Strompreis selber ist momentan billiger als die Ökostromumlage.
Die Unternehmen, die energieintensiv sind, für die das ein Drittel oder die Hälfte der Produktionskosten ausmacht, die kaufen natürlich nicht da, wo der Strompreis runtergeht, weil in der Mittagssonne, wie jetzt gerade, die Sonne scheint. Sondern die kaufen an Terminmärkten. Die häufig unterstellten Wettbewerbsvorteile durch gesunkene Börsenstrompreise kommen bei den Unternehmen zum großen Teil nicht an, weil sie an Terminmärkten langfristig vorausplanen. Und da sind die fossilen Energien, wie auch sonst im Energiemix, dominierend.
Maike Albath: Wie ist das mit diesen neuen Möglichkeiten des Fracking? Das ist ja sehr umstritten. Ist das etwas, was mit dem Umweltschutz noch in Einklang zu bringen ist und was mit den erneuerbaren Energien in irgendeiner Form in Zusammenhang zu bringen wäre aus Ihrer Perspektive, Claudia Kemfert?
Claudia Kemfert: Das Fracking kann Potenziale haben. Wir sehen in den USA, dass es tatsächlich den Gasmarkt revolutioniert hat. Es gibt mittlerweile ein Überangebot an Gas, was wiederum Effekte bei uns hat. Dadurch, dass Amerika weniger Kohle nachfragt, sinkt der Kohlepreis, was bei uns den Börsenpreis nach unten bringt. Gleichzeitig ist aber auch der CO2-Preis in Europa deutlich gesunken und damit ist Gas nicht mehr so attraktiv. Und deswegen muss man sich gut überlegen, ob man Fracking wirklich braucht.
Es kann also Potenziale heben, wenn man die Umweltgefahren im Griff hat und die Umweltauflagen erfüllt. Zum Beispiel in Amerika, zum Beispiel in Asien gibt es große, große Potenziale. Und da gibt es auch landschaftlich ganz andere Bedingungen als in Deutschland. Deshalb kann man sagen: Erst einmal sind die Potenziale in Deutschland sehr gering. Zum Zweiten sind die Umweltauflagen sehr, sehr hoch. Zum Dritten haben wir keinen Gasmangel. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Hype oder dieser Wunsch, dass alles verbessert wird, nicht richtig.
Ich würde aber gern zu dem kommen, was Herr Möller eben noch sagte, dass die Wettbewerbsbedingungen durch die Ökostromumlage nicht gut seien. Es ist ja so, dass die energieintensiven Unternehmen von der Zahlung der Ökostromumlageausgenommen sind, insbesondere diejenigen, die im internationalen Wettbewerb stehen und die sehr hohe Energiekosten haben. Und ich glaube, bei dem Unternehmen, für das Sie tätig sind, Herr Möller, ist das so. Was ja auch Sinn macht.
Aber im Moment sind sehr viele Unternehmen ausgenommen. Und da muss man sich schon fragen, wie man diese Umlage auch so fair verteilt, dass nicht nur die Privathaushalte so starke Preis-Steigerungen zahlen, sondern man diese auch anders verteilt. Das ist ein Thema in meinem Buch, in dem ich vorschlage: Lasst uns ehrlich diese Debatte führen. Lasst uns die Interessen offen legen. Lasst uns schauen, wie sich der Strompreis wirklich zusammensetzt. Und wer hat ein Interesse daran, dass man in dem Moment über bestimmte Dinge spricht? Man kann zum Beispiel auch Steuern senken, wenn man Strompreise senken will. Auch das wäre politisch eine Aufgabe, über die aber niemand spricht.
Insofern haben wir hier sehr große Scheindebatten von Lobbyisten, von Energiewendegegnern, die immer wieder behaupten, das sei alles nicht bezahlbar. Und dagegen wehre ich mich. Und da gibt’s genügend Argumente in meinem Buch.
Maike Albath: Claudia Kemfert sieht auch große Chancen in der grünen Zukunft und in den Möglichkeiten, die wir mit den erneuerbaren Energien haben. Wir sprachen über ihr Buch „Kampf um Strom“, erschienen im Murmann Verlag. „Das grüne Gewissen“ liegt bei Hanser vor, von Andreas Möller.
Wir haben jetzt noch Zeit für eine Lektüreempfehlung. Welchem Buch wünschen Sie viele Leser, Andreas Möller?
Andreas Möller: Das ist die berühmte Qual der Wahl. Ich hab mich für Henry David Thoreau: „Walden“ entschieden. Das ist eines der Bücher, die ich als erstes mit einem durchaus romantischen Gefühl des Wunsches nach Ausstieg, des Wunsches, aus der Stadt hinaus in die Natur, gelesen habe. Ich finde nach wie vor, dass es unter den Klassikern zu diesem Thema ein ganz wunderbares Buch ist, das beide Seiten abdeckt, nämlich auf der einen Seite die Sehnsucht nach der Natur und auf der anderen Seite auch den inneren Widerspruch, der ein bisschen ironisch gebrochen ist, dass das mit dem Ausstieg manchmal eben doch nicht so einfach ist – nach wie vor ein ganz großartiges Buch.
Maike Albath: Henry David Thoreau: „Walden oder Hüttenleben im Walde“ liegt im Manesse Verlag vor. Claudia Kemfert, Ihre Empfehlung?
Claudia Kemfert: Ja, meine ist seit 2010 geblieben, noch immer das Buch „Solar“ von Ian McEwan. Das ist eine herrliche Satire des Wissenschaftsbetriebs, zugleich eine Allegorie der Gesellschaft, die sich genauso unbarmherzig wie der Protagonist keinesfalls um den Schutz des Klimas kümmert, sondern eher durch Völlerei, maßlose Gier und Verachtung auffällt. Es ist eine herrliche Satire, britischer Zynismus, britischer Humor. Und wer den Protagonisten kennt, um den es hier geht in dem Buch, der wird herrlich lachen. Ich kenne ihn. Und insofern ist es unglaublich witzig, aber für alle Leser. Das kann ich uneingeschränkt empfehlen.
Maike Albath: Ian McEwan: „Solar“ ist bei Diogenes erschienen. – Von der Leipziger Buchmesse verabschiedet sich Maike Albath.
Wie es um die Deutschen und die Nachhaltigkeit bestellt ist, wollen wir in der Lesart diskutieren. Es gibt neue Bücher zum Thema. Zwei haben wir ausgesucht: „Kampf um Strom: Mythen, Macht und Monopole“ hat die Professorin für Energie, Ökonomie und Nachhaltigkeit Claudia Kemfert ihre Studie genannt. Guten Tag, Frau Kemfert.
Claudia Kemfert: Guten Tag, ich grüße Sie.
Maike Albath: Und Andreas Möller, Experte für Wissenschaft- und Technikkritik hat mit der Natur als Ersatzreligion abgerechnet. „Das grüne Gewissen. Wenn die Natur zur Ersatzreligion wird“ heißt sein neues Buch. Guten Tag, Herr Möller.
Andreas Möller: Guten Tag, Frau Albath.
Maike Albath: Im Titel klingt ja eine leise Kritik an. Haben Sie denn kein grünes Gewissen?
Andreas Möller: Doch, ich habe ein grünes Gewissen, das aber sehr individuell, ich glaube, wie bei vielen Menschen aus den Erfahrungen, Bildern, Projektionen, die ich an die Natur habe, gespeist ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Teil der ganzen Geschichte, dass wir zunehmend versuchen, Handlungen auch im Alltag zu individualisieren, zu privatisieren, zu entscheiden, was nachhaltig ist und was nicht. Wir kriegen einen gewissen Input auch durch die Diskurse, die in der Gesellschaft laufen. Aber natürlich habe ich ein grünes Gewissen, definitiv. Das Thema Natur ist für mich eine Herzensangelegenheit, aber nicht nur, sondern eben auch eines, das von Zeit zu Zeit auch eine kritische Revision braucht, vor allem hinsichtlich der Maßnahmen, von denen wir der Meinung sind, dass sie im Sinne der Natur sind und uns näher zur Natur bringen.
Maike Albath: Etwas, das man aus dem Buch von Andreas Möller erfährt, Claudia Kemfert, ist ja, dass er eigentlich bemerkt, dass sich in Deutschland doch so eine gewisse Technikfeindlichkeit breitgemacht hat. Teilen Sie diesen Eindruck?
Claudia Kemfert: Nein, den teile ich in keinster Weise, weil ich glaube, dass wir keine technikfeindliche Gesellschaft haben, sondern es geht um eine Technik der Vergangenheit versus Technik der Zukunft. Das ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung und keine emotionale oder rein romantische Entscheidung, wie Herr Möller ja in seinem Buch darlegt, sondern es ist wirklich auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Es ist nicht alles nur Romantik. Die Menschen wollen ja nicht den Menschen aus der Gesellschaft herausholen und nur noch die Natur haben, sondern es geht darum, dass wir reale Fakten haben.
Es gibt eine Begrenzung des Wachstums. Wir haben keinen Protest gegen Veränderungen. Die Energiewende ist nicht nur romantisch, sondern hat wirklich reale Gründe und nicht gefühlte Gründe. Ich glaube, da muss man schon deutlich hingucken, was man machen kann.
Ich teile die Ansicht, dass der Hype oder die Hysterie, die da beschrieben werden, überzogen sind. Aber die grundsätzliche Ablehnung von Klimaschutz, von Umweltschutz und auch des gesellschaftlichen Wandels, das finde ich dann doch ein bisschen zu viel.
Maike Albath: So weit geht Andreas Möller ja nicht, sondern es ist auch eine Beschreibung und der Versuch, kulturhistorisch zu erforschen, wie sich das mit der Beziehung zur Natur verhält in Deutschland. Ein Wort dazu, Andreas Möller: Sie haben ja bewusst diesen historischen Ansatz gewählt.
Andreas Möller: Wenn Sie mir gestatten, ich mache noch einen kurzen Schlenker. Wir sind hier auf dem Leipziger Messegelände, unweit des BMW-Werkes. Also: Natürlich sind die Deutschen keine technikfeindliche Nation, ganz im Gegenteil. Was das, was die Soziologen „Alltags- und Gebrauchstechnik“ nennen anbelangt, sind sie sogar ein technikaffines Volk. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wenn man sich die%ausgaben pro Haushalt für Kühlschränke, Waschmaschinen, neue Automobile, iPhones und so weiter anguckt, dann liegen wir im europäischen Durchschnitt sogar ganz oben, in einem interessanten Verhältnis übrigens zu den Ausgaben für Nahrungsmittel. – Darum geht es nicht.
Es gibt aber eine spezifische Phobie gegenüber Großtechnologien, die durchaus historisch gewachsen ist. Die Technik als Staatstechnik, und das kann man am Energiesektor sehr, sehr gut zeigen, ist in Deutschland vollkommen anders konnotiert als das zum Beispiel in Frankreich oder in den Vereinigten Staaten, in der ehemaligen DDR, in der Sowjetunion und in vielen anderen Staaten auch der Fall ist. Das hat viele Elemente, aber sie führen mich am Ende zu dem Punkt, warum die Energiewende zumindest als Programm in Deutschland ganz gut funktioniert und bislang – damit ist jetzt der gefühlte Sektor gemeint – auch noch nicht auf größere Widerstände gestoßen ist.
Wir sind sehr landsmannschaftlich geprägt. Das mag ein bisschen pittoresk klingen, aber small is beautiful. Das ist ein gewisser Rückfall auch in Dezentralitäts- und Autarkiemetaphern, das kann man bei Frau Kemfert sehr schön lesen. Wenn wir angesichts eines EU-Binnenmarktes, der 2014 in Europa herrschen wird und die freie Wahl des Einkaufs auch von Energie ermöglicht, wenn wir dort anfangen, von energieautarken Dörfern in Brandenburg, in Bayern zu sprechen, dann ist das für mich eine Form von Idealisierung, die mit der globalen Vernetzung, die wir nicht nur im Energiebereich, aber auch gerade dort erleben, nicht zu tun hat.
Noch mal zu Ihrer Frage zurück, wenn Sie das gestatten. Machen wir es kurz: Ich glaube, das Stichwort der Romantik als eine emotionale Antwort des einen, in der Natur zu sein, auch mit Gott, eine Antwort auf die Aufklärung im 19. Jahrhundert, das ist ein gängiger Topos, der immer wieder gebraucht wird. Ich glaube, wenn man irgendwo auf der Straße die Probe aufs Exempel machen würde, wie weit das mit dem Verständnis der Romantik, was sie eigentlich meint, her ist, dann würde man doch das eine oder andere merkwürdige Ergebnis haben.
Aber ich glaube, was entscheidend ist auch für das Technikbild heute noch, der gesamte Kernenergiediskurs, den wir haben, ist wie in keinem anderen Land geprägt von einer Melange aus friedlicher und so genannter nicht friedlicher Nutzung der Kernenergie; Deutschland als Aufmarschplatz der Supermächte; die latente Gefahr eines atomaren Krieges; die Waldsterbensdebatte parallel 1982 und 1983 bis zu Tschernobyl: All das prägt bis heute aus.
Maike Albath: Aber es spricht ja auch für ein Bürgerbewusstsein, wenn man sich zum Beispiel über die Nachsorge überhaupt Gedanken macht, auch zu der die Frage, wie Atomkraftwerke, die abgeschaltet werden, rückgebaut werden können. Frau Kemfert, das Stichwort war Dezentralisierung.
Claudia Kemfert: Ich halte es für grundfalsch, dass man jetzt meint, dass die Energiewende in Deutschland eine Autarkie hervorbringt. Das ist überhaupt nicht die Motivation. Es geht darum, dass man einerseits eine dezentrale Energieversorgung haben wird, also beispielsweise Solaranlagen auf dem Dach, Biomasseanlagen oder auch Windanlagen. Aber es wird durchaus auch Großprojekte geben, auch in Europa. Da stimme ich mit Herrn Möller überhaupt nicht überein. Denn es geht ja gerade darum, das zusammenzubringen, dass man einerseits die Großprojekte hat, wie beispielsweise Solaranlagen auch im Süden, Wind- und Wasserkraft, Speichertechnologie im Norden, und dass man das zusammenbringt.
Ich finde in dem Buch von Herrn Möller doch eine sehr starke Verklärung der Atomkraft als eine Technik der Vergangenheit, die wir auch in der Zukunft brauchen. Das, glaube ich, ist doch ein bisschen sehr romantisch gedacht, wenn Sie mir das erlauben. Einerseits sind Sie ja jemand, der das kritisiert. Andererseits habe ich den Eindruck, dass Sie die Atomenergie romantisieren. Wenn Sie da von Ihren Begegnungen durch stillgelegte Atomkraftwerke berichten, finde ich das dann doch etwas schizophren, muss ich fast sagen.
Und ich glaube auch, dass Sie uns sagen müssten, für wen Sie heute eigentlich arbeiten. Herr Möller, ich glaube, dass das etwas ist, was auch die Intention dieses Buches deutlich macht. Das ist eine Kampfschrift gegen den Klimaschutz, gegen Umweltschutz, gegen gesellschaftliche Prozesse im Bereich der Energiewende. Und die sind aus meiner Sicht auch wirtschaftlich motiviert. Und das fände ich sehr fair, wenn wir das auch erfahren würden, warum Sie das aufschreiben.
Andreas Möller: Ja, das haben wir im Prinzip schon erfahren, weil Sie das ja coram publico mitgeteilt haben. Ich fange mal vorne an mit dem Punkt der Kernenergie. Wenn Sie es nicht rausgelesen haben, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, das im Nachhinein einzufordern. Dieses Buch ist – man mag es kaum glauben – so etwas wie ein Hybrid. Es hat durchaus literarische Züge. Gerade das Kapitel, das Sie ansprechen, ist weniger wehmütig gemeint im Sinne einer Technologie, an die sich mein Herz klammert, sondern es ist eher die Besichtigung eines technischen Zeitalters, das so nicht mehr kommen wird.
Das hat unmittelbar damit zu tun, dass ich die 60er Jahre, die 70er Jahre sehr stark reflektiere. Warum ist Deutschland an diesen Stellen so geworden, wie es geworden ist? Es ist kein Zufall, wenn wir mal im Sinne der Natur denken, dass die Kernkraftwerke genau dort entstanden sind, wo sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg industrialisiert hat, nämlich da, wo man revierfern war, dort, wo es große Flussläufe gab, dort in Baden-Württemberg, im Rhein-Main-Gebiet oder auch in Bayern, da, wo heute die großen Wirtschaftszentren sind.
Nichts liegt mir ferner als der Versuch, eine Technologie, die sich seit 30 Jahren als schwierig erwiesen hat in der Gesellschaft, auf Teufel kommt raus zu verteidigen. Ich stelle nur gewisse Fragen, wie es hinsichtlich der Konsequenz der sehr emotional schnell vollzogenen Maßnahmen im März 2011 bestellt ist. Die Energiewende – das schreiben Sie ja auch vollkommen zu Recht – ist ja etwas, was vollkommen losgelöst ist von dem Thema Fukushima. Das Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG), der beschlossene Ausbau der erneuerbaren Energien, der ist seit dem rot-grünen Atomkonsens und, wie gesagt, dem Thema EEG, ist seit dem Anfang der 2000er Jahre da. Das hat nur einen zusätzlichen Schub gegeben.
Ich habe, wenn wir tatsächlich über Personen reden wollen, und wir können gerne auch über Ihre Person reden und die Frage stellen, welche Position Sie dort einnehmen, ob es eine wissenschaftliche Neutralität gibt oder ob Sie sich durchaus als Promoterin auch der erneuerbaren Energien verstehen, wie Sie das ja am Anfang schreiben, was ich absolut souverän finde. Ein Wort zu meiner Person: Es ist mittlerweile das dritte Buch, das sich mit den Themen Natur, Gesellschaft und Technik auseinandersetzt – in einer etwas anderen Form. Ich bin für ein Unternehmen tätig, das ist richtig, seit einem Jahr. Das tue ich. Und ich war vorher im Bereich der Politikberatung für eine der beiden nationalen Wissenschaftsakademien. Dort ist die ganze Reflektion Technik, Gesellschaft im Guten wie im Schlechten auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Es gibt Leute, die die oder die andere Position auch haben.
Maike Albath: Und das ist ja auch so, dass interessengeleitete Argumentation durchaus ihre Bedeutung und ihre Funktion hat.
Claudia Kemfert: Absolut.
Maike Albath: Wir müssen ja ins Gespräch kommen und uns austauschen über die verschiedenen Positionen. Claudia Kemfert, ich finde schon, dass bei Andreas Möller deutlich wird, er spricht ja auch ganz andere Bereiche der Gesellschaft an, zum Beispiel die Medizin, die Erwartung, dass man perfekt versorgt wird, auf der anderen Seite aber eine Impfmüdigkeit oder ein Desinteresse an bestimmten Entwicklungen. Und ich glaube, es ist so diese Doppelung, dass man auf der einen Seite sehr teilhaben will an der modernen Welt, aber dennoch immer annimmt, dass der Strom wirklich aus der Steckdose kommt, also diese ganz alte Frage, und dass es so eine gewisse Biedermeierlichkeit gibt in einer bestimmten bürgerlichen Schicht und so eine Tendenz zum Reaktionären. – Würden Sie das nicht teilen?
Claudia Kemfert: Durchaus. Und da, finde ich, hat Herr Möller auch wichtige Punkte angesprochen, die ich teilweise auch teile, weil ich im privaten Bekanntenkreis genügend Personen kenne, die sich ähnlich verhalten, auch ähnlich schizophren verhalten. Das finde ich auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite, und da komme ich noch mal zu der interessengeleiteten Argumentation zurück, finde ich das völlig in Ordnung, wenn man es dann auch deutlich macht. Deswegen ist in meinem Buch auch das Anliegen, gleich zu Anfang zu sagen: Ich bin Wissenschaftlerin, ich beschäftige mich seit 25 Jahren damit, aber ich stehe auf einer Seite, nämlich dass ich es richtig finde, die Energiewende zu machen.
Das jetzt als Romantik abzutun, als seien wir alle völlig verblendet, weil wir nur Fukushima und gefühlten Risiken hinterher leben, das, glaube ich, ist so nicht richtig. Und an diversen Stellen ist es mir dann auch teilweise nicht ganz klar. Denn Sie sprechen zu Recht an, es geht ja darum, dass man Menschen auch so ein bisschen den Finger in die Wunde legen soll. Warum verhalten sie sich so? Warum haben wir eine Impfmüdigkeit? Warum kaufen Menschen im Bio-Supermarkt? – Aber all das jetzt so lächerlich zu machen und zu sagen, na ja, warum machen die das überhaupt, eigentlich bräuchten wir das doch gar nicht, das finde ich dann schon schade, weil das Thema an sich gut ist, das auch zu beleuchten und auch deutlich zu machen: Lasst uns in eine Welt gehen. Und das ist auch am Ende des Buches von Herrn Möller, da stimme ich völlig überein, ein positiver Ausblick. Ich glaube, so weit auseinander sind wir gar nicht.
Nur eben diese Zurückblende, dass diejenigen, die sich für Umwelt und Klimaschutz engagieren, sei es wie auch immer, dann lächerlich gemacht werden, das finde ich ein bisschen schade.
Maike Albath: Ich glaube, es ist einfach der Punkt, dass Sie, Andreas Möller, deutlich machen wollen, dass es eine Realitätsverleugnung ist, wenn wir nur noch Manufactum-Waren kaufen und uns nicht mehr darum kümmern, wo das eigentlich herkommt.
Herr Möller, am Ende Ihres Buches plädieren Sie ja für eine heitere Gelassenheit. Wie sähe denn idealerweise die Gesellschaft aus, eine moderne Gesellschaft, die mit den Herausforderungen umgehen kann?
Andreas Möller: Das ist jetzt ein großes Wort, wenn ich am Ende dieses Buches vom Versuch einer Naturphilosophie spreche. Ich glaube, dass es an Hybris grenzt, die falsch ist, wenn wir glauben, dass wir der Garant der Natur sind in all dem, was wir tun. Ich glaube, dass es wichtig ist, anders als die Natur, die ganz unmittelbar ist und keinen freien Willen kennt, dass es wichtig ist und geradezu das Signum der menschlichen Kultur, dass wir das, was wir tun, auch reflektieren können und entsprechende Kurskorrekturen vornehmen können. – Das sehe ich auch so.
Aber ich glaube, wir sollten uns – und das meine ich mit „heiterer Gelassenheit“ – nicht zurücklehnen, aber Vertrauen in uns selbst haben. Denn der Punkt, an dem wir heute als Gesellschaft stehen, dass wir uns gewissermaßen in einem postmaterialistischen Wertebegriff bewegen, der in der Stringenz unserer Entwicklung liegt, dieser Weg hat uns mit einer hohen Konsequenz zu den Diskursen geführt, die wir heute in der Gesellschaft führen. Und genau das ist etwas, was ich absolut unterstütze.
Ich glaube einfach nur, dass wir uns der Konsequenz unserer Maßnahmen wieder neu bewusst werden müssen und auch der Bedeutung, die die Natur in diesem Zusammenhang spielt. Ich glaube nicht nur, dass wir – empirisch gesprochen – nie so weit von der Natur entfernt waren, wie heute, sondern dass uns etwas in den Schoß fällt, was wir als eine Metapher für Werte gebrauchen, die wir in der Gesellschaft ansonsten zunehmend vermissen.
Ich will das jetzt nicht in die Länge ziehen. Aber von der gewollten Bindungslosigkeit bis hin zur Karriereplanung ist heute nicht so sehr en vogue wie die Selbstbestimmtheit. Gleichzeitig gibt es den Wunsch an die Rückbindung, an einen anderen Zusammenhang und Werte, die über das rein Materielle hinausweisen. Ich möchte einfach, dass wir ernst machen mit den vollmundigen Ankündigungen, die wir haben. Autoren neigen ja immer so ein bisschen dazu, sich selbstironisch noch mal über die Schulter zu schauen, dass sie ihren eigenen Kosmos für die Welt halten. Ich glaube, der Kosmos, in den wir drei uns vielleicht bewegen, ist nicht unbedingt repräsentativ für das, was in Deutschland ist. Aber Sie sehen doch, dass die dritte Landtagswahl in Folge jetzt mit an die Grünen gegangen ist; dass Printprodukte wie „Landlust“ mittlerweile ein Millionenpublikum finden, wenn man die Ableger auch mit dazu zählt; und dass so ein gewisser Hang zur Behaglichkeit, gleichzeitig mit dem hohen moralischen Anspruch der Nachhaltigkeit zu bemerken ist.
Und ich frage einfach: Wie sieht es aus mit unserem permanenten Anspruch auf digitale Innovation, mit dem Anspruch auf Mobilität? Ich glaube, ein heute 19-Jähriger hat schon einen größeren CO2-Footprint als mein Großvater in seinem ganzen Leben gehabt hat.
Maike Albath: Das ist etwas, was man aus dem Buch von Andreas Möller erfahren kann, auch, dass Natur immer etwas Gemachtes ist, etwas Geschaffenes vom Menschen. Es heißt „Das grüne Gewissen“ und liegt bei Hanser vor. Der Band von Claudia Kemfert ist „Kampf um Strom“ betitelt. Claudia Kemfert, ist diese Wende, die Energiewende möglicherweise das neue Stuttgart 21 oder der Flughafen Berlin-Brandenburg?
Claudia Kemfert: Na, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir das besser machen. Aber ich muss leider sagen, im Moment ist das Management dieses wichtigen Projektes ein reines Desaster. Und es droht so etwas zu werden wie ein Stuttgart 21. Aber grundsätzlich halte ich das Projekt für richtig. Ich glaube auch, dass man es schaffen kann, die Energieversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen, Energie einzusparen, wegzukommen von der alten Technik. Und dass das auch wirtschaftlich machbar ist und dadurch viele Chancen in Deutschland entstehen, in neuen Arbeitsplätzen, in Veränderungen, die durchaus Sinn machen. Insofern ist es ein wichtiges Projekt und ich denke, man kann es auch schaffen.
Maike Albath: Wen macht Claudia Kemfert denn als Gegner der Energiewende aus, Andreas Möller?
Andreas Möller: Das ist natürlich ein Volltreffer. Das ganze Buch hat ja eine stark bellizistische Metaphorik, möchte ich das mal nennen. Man kann sehr, sehr viele Begriffe wie Schlacht, Kampf, Mythos und anderes mehr finden. Auch der Buchtitel, den fand ich sehr schön. Als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich, Felix Dahn: „Kampf um Rom“. Der steht bei uns zu Hause in einer ganz alten Ausgabe. Ich hatte ein bisschen Schiss vorm Lesen vor dem Interview, weil ich dachte, ich muss jetzt durch so einen Ben-Hur-mäßigen Wälzer durchkämpfen. Als ich das Cover dann gesehen habe, dachte ich ein bisschen an Dracula oder Schloss Schreckenstein. Es hat etwas sehr, sehr Dramatisches.
Maike Albath: Man muss dazu sagen, dass auf dem Cover Blitze abgebildet sind und ein Strommast. Es hat durchaus etwas Bedrohliches.
Claudia Kemfert: Und „Kampf um Rom“ ist ja eine Verfilmung mit entsprechenden Schauspielern der 60er Jahre. Insofern hat das schon eine Anlehnung. Es gibt wenige, die das auch tatsächlich wissen.
Maike Albath: Und dann noch die Alliteration „Mythen, Macht und Monopole“, auch das ein literarisches Stilmittel.
Andreas Möller: Ich antworte jetzt aber auf die Frage: In der Tat gibt es in Deutschland vier oder fünf, traditionelle, große Energieversorger, die etwas verloren haben. Die haben nicht nur durch Fukushima etwas verloren, sondern die sehen zunehmend ihre Geschäftsmodelle in Gefahr durch einen stärkeren Hang hin zur Dezentralität, zur Eigenversorgung, zum Aufbrechen alter Monopole. – Ich möchte es mal genauso wiedergeben.
Das sind gleichzeitig Unternehmen, die so viel wie niemand anderes im Bereich der erneuerbaren Energien, allein aus ganz knallharten ökonomischen Interessen, seit Jahren investieren. Ein Unternehmen wie E.ON oder wie RWE, ich weiß nicht, ob meine Zahlen noch aktuell sind, liegen ungefähr bei einem Investment von einer Milliarde Euro im Jahr. Bei RWE waren es Umsätze, die man halbiert und nur dafür zurücklegt. Das heißt, man hat sehr, sehr früh erkannt, dass zum Beispiel die Offshore-Technologie ein Geschäftsfeld sein würde, mit dem man punkten kann.
Das liegt am Erneuerbare Energien-Gesetz, an einer Einspeisevergütung, die sehr auskömmliche Renditen trotz der jetzt vom Bundesumweltminister Peter Altmaier eingebrachten Strompreisbremse bringen. Das ist die erste Gruppe der Lobbyisten, die Frau Kemfert sehr stark anspricht. Ich finde es fair, in meiner Gewichtung allerdings nicht ausreichend genug, dass sie auch einräumt, dass sich die Lobbylandschaft tatsächlich so fundamental verschoben hat im Hinblick auf die vielleicht etwas historischen Vorstellungen, die wir noch haben. Nicht-Regierungs-Organisationen wie Greenpeace oder der WWF agieren heute sehr, sehr professionell. Das Campaigning, das permanente Absondern von Meinungen im öffentlichen Raum ist flächenübergreifend. Insofern hat die Erneuerbare-Energien-Szene, das kann ich aus Berlin auch quantitativ berichten, eine sehr, sehr starke Lobby, die auch dabei ist.
Und dann geht es am Ende, auch um Unternehmen, die freigestellt sind, die so genannte energieintensive Industrie. Gestern habe ich auf einer Veranstaltung im Umweltministerium den Präsidenten des Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gehört: Wir liegen momentan bei einer EEG-Umlage von 5,3 Cent. Und der Präsident Arnold Wallraff hat gestern noch mal gesagt: Wenn wir alle Unternehmen von der chemischen Industrie bis zur Zementindustrie herausnehmen würden, würden wir von diesen 5,3 Cent momentan einen Cent einsparen. Aber die Kollateralschäden, die diese Unternehmen im internationalen Wettbewerb haben würden, die wären gewaltig …
Claudia Kemfert: …das müssen Sie ja sagen, weil Sie für ein Unternehmen arbeiten, das sehr, sehr energieintensiv ist und sich natürlich Sorgen darum macht. Das verstehe ich auch. Ich hätte es gut gefunden, wenn Sie es von Anfang an gesagt hätten. Aber das ist ein anderes Thema.
Maike Albath: Frau Kemfert, es steht ja im Klappentext, dass Herr Möller für die freie Wirtschaft arbeitet.
Claudia Kemfert: Gut, aber es wäre schön gewesen, wenn er sagt, er arbeitet für die energieintensiven Unternehmen. Deswegen verstehe ich ja auch das Anliegen. Das ist jetzt aber gar nicht mein Hauptpunkt.
Wer investiert im Moment in erneuerbare Energien? Das sind nicht die großen Vier. Es sind weder E.ON, noch RWE, die investieren auch, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, sind es mittlerweile über 50 Privathaushalte, also Menschen, die eine Solaranlage kaufen, Menschen, die sich in Energiegenossenschaften engagieren. Und das wird weiter zunehmen. In der Zukunft, da hat Herr Möller Recht, da werden auch die großen Vier mehr investieren, ganz klar, aber heute ist es so, dass gerade die Menschen investieren, die sich dezentral organisieren. Und das ist eine gute Entwicklung.
Das andere Thema, was angesprochen wurde, sind die Kosten, also die Umlage zur Förderung der erneuerbaren Energien. Die ist stark gestiegen aus den unterschiedlichsten Gründen, unter anderem deshalb, weil der Börsenpreis so stark sinkt, ein wichtiger Faktor für energieintensive Unternehmen, die davon ja auch wieder profitieren können. Insofern ist die Frage, was man auch von denen einfordern kann, wenn man jetzt eine faire Verteilung der Lasten einfordert. Aber ich glaube, wichtig ist hier, dass man verschiedene Konzepte umsetzt, um auch eine faire Verteilung zu haben.
Aber im Buch geht es mir darum, diese Lobbyisten darzustellen, deswegen spreche ich es auch so intensiv an: Lobbyisten, die ihre Interessen nicht offenlegen, sondern immer wieder gegen Klimaschutz argumentieren, immer wieder gegen die Energiewende argumentieren, um das ganze Projekt zu diskreditieren und gerade den Ökostrom zu stigmatisieren als nur teuer, unbezahlbar und nicht finanzierbar. – Das finde ich im Grunde genommen sehr schade, weil es hier um ein gutes und wichtiges Projekt geht.
Maike Albath: Und es geht ja auch darum, in Ihrem Buch zu zeigen, dass es nicht die gleichen Waffen sind, mit denen man kämpft. Man erfährt auch sehr viele Zahlen. Zahlen waren ja jetzt hier schon im Raum. Zum Beispiel, dass die großen Energieunternehmen in den letzten zehn Jahren unglaubliche Gewinne gemacht haben. Die haben sich versiebenfacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Herr Möller, eigentlich werden doch durch diese Umstellungen auch sehr viele neue Technologien befördert. Das müsste doch genau in Ihrem Sinne sein. Sie befürchten doch, dass Deutschland den Anschluss verliert bei diesen neuen Technologien.
Andreas Möller: Ich bin eigentlich ganz dankbar für den Punkt, an dem wir jetzt sind, weil er implizit bestätigt, was ich ein bisschen befürchte und was Ausdruck der Gemengelange ist, die wir gerade haben.
Der erste Punkt ist, und da würde ich auch intellektuell eine gewisse Trennung vornehmen: Das Projekt Energiewende zu diskreditieren, indem man sagt, dass ein Drittel der weltweit installierten PV-Zellen sich im Sonnenland Deutschland befinden, dass die EEG-Umlage, die Norbert Röttgen vor drei Jahren – Frau Kemfert kokettiert ja damit, dass es da gewisse Kontakte gab – noch bei 3,5 Cent lag, im Jahr 2010 bei 2 Cent lag, in diesem Jahr bei 5,3 Cent lag. Das ist nicht nur für Privathaushalte ein Schlag ins Kontor, wenn wir eine Steigerung von 160 bis 170 Prozent haben. Das ist vor allem für Unternehmen, die sich in Terawattstunden, also Millionen Kilowattstunden bewegen, richtig existenzgefährdend. Wenn Sie zum Beispiel ein Unternehmen der Aluminiumindustrie nehmen, wenn Sie dort die Befreiung von der EEG-Umlage kappen würden – die besondere Ausgleichsregelung nennt sich das in Deutsch –, dann hätte das ganz, ganz eklatante Folgen.
Zum Thema Wettbewerbsvorteil: Ich glaube, dass viele Unternehmen, von den Hightech-Herstellern bis zur Grundstoffindustrie, erkannt haben, dass dieses Thema – im Sinne auch eines systemischen Vorteils für die deutsche Industrie – ein großes Thema und auch ein großer Wettbewerb, ein Asset werden kann in den nächsten Jahren. Warum? Weil wir Agglomerationen weltweit sehen. Wir werden lokale Klimaschutzproblematiken auf dem Schirm haben. Die Bedeutung des Energieträgers Strom im Vergleich zu einer Regelenergie in Form von Öl oder Gas wird zunehmen. Das ist definitiv so.
Aber man darf das Kind eben nicht mit dem Bade ausschütten. Und das ist mein Grundanliegen in diesem Buch.
Wir können genauso an fossile Energien denken, an die Shellgasrevolution momentan in den Vereinigten Staaten und die Auswirkungen, die das Ganze auch hinsichtlich des Kohlemarktes hat. Auch das sind Technologien – wie CCS, wie Fracking, wie Clean coal – die es zum Beispiel für einen Forschungs- und Technologiestandort wie Deutschland auch im Sinne des Exportes zu fördern gilt.
An der Stelle noch ein kurzes Wort zu den Wettbewerbsvorteilen, die die Industrie angeblich durch die gesunkenen Börsenstrompreise hat. Das stimmt. Ich habe gestern selber auf die Seite geguckt. Wir liegen momentan am Terminmarkt ungefähr bei 40 Euro für die Megawattstunde. Wenn Sie umrechnen, dass die EEG-Umlage zurzeit bei 5,3 Cent pro Kilowattstunde liegt, dann kommen Sie auf einen Wert, der bei 53 Euro liegt. Man muss sich das mal vorstellen: Der Strompreis selber ist momentan billiger als die Ökostromumlage.
Die Unternehmen, die energieintensiv sind, für die das ein Drittel oder die Hälfte der Produktionskosten ausmacht, die kaufen natürlich nicht da, wo der Strompreis runtergeht, weil in der Mittagssonne, wie jetzt gerade, die Sonne scheint. Sondern die kaufen an Terminmärkten. Die häufig unterstellten Wettbewerbsvorteile durch gesunkene Börsenstrompreise kommen bei den Unternehmen zum großen Teil nicht an, weil sie an Terminmärkten langfristig vorausplanen. Und da sind die fossilen Energien, wie auch sonst im Energiemix, dominierend.
Maike Albath: Wie ist das mit diesen neuen Möglichkeiten des Fracking? Das ist ja sehr umstritten. Ist das etwas, was mit dem Umweltschutz noch in Einklang zu bringen ist und was mit den erneuerbaren Energien in irgendeiner Form in Zusammenhang zu bringen wäre aus Ihrer Perspektive, Claudia Kemfert?
Claudia Kemfert: Das Fracking kann Potenziale haben. Wir sehen in den USA, dass es tatsächlich den Gasmarkt revolutioniert hat. Es gibt mittlerweile ein Überangebot an Gas, was wiederum Effekte bei uns hat. Dadurch, dass Amerika weniger Kohle nachfragt, sinkt der Kohlepreis, was bei uns den Börsenpreis nach unten bringt. Gleichzeitig ist aber auch der CO2-Preis in Europa deutlich gesunken und damit ist Gas nicht mehr so attraktiv. Und deswegen muss man sich gut überlegen, ob man Fracking wirklich braucht.
Es kann also Potenziale heben, wenn man die Umweltgefahren im Griff hat und die Umweltauflagen erfüllt. Zum Beispiel in Amerika, zum Beispiel in Asien gibt es große, große Potenziale. Und da gibt es auch landschaftlich ganz andere Bedingungen als in Deutschland. Deshalb kann man sagen: Erst einmal sind die Potenziale in Deutschland sehr gering. Zum Zweiten sind die Umweltauflagen sehr, sehr hoch. Zum Dritten haben wir keinen Gasmangel. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Hype oder dieser Wunsch, dass alles verbessert wird, nicht richtig.
Ich würde aber gern zu dem kommen, was Herr Möller eben noch sagte, dass die Wettbewerbsbedingungen durch die Ökostromumlage nicht gut seien. Es ist ja so, dass die energieintensiven Unternehmen von der Zahlung der Ökostromumlageausgenommen sind, insbesondere diejenigen, die im internationalen Wettbewerb stehen und die sehr hohe Energiekosten haben. Und ich glaube, bei dem Unternehmen, für das Sie tätig sind, Herr Möller, ist das so. Was ja auch Sinn macht.
Aber im Moment sind sehr viele Unternehmen ausgenommen. Und da muss man sich schon fragen, wie man diese Umlage auch so fair verteilt, dass nicht nur die Privathaushalte so starke Preis-Steigerungen zahlen, sondern man diese auch anders verteilt. Das ist ein Thema in meinem Buch, in dem ich vorschlage: Lasst uns ehrlich diese Debatte führen. Lasst uns die Interessen offen legen. Lasst uns schauen, wie sich der Strompreis wirklich zusammensetzt. Und wer hat ein Interesse daran, dass man in dem Moment über bestimmte Dinge spricht? Man kann zum Beispiel auch Steuern senken, wenn man Strompreise senken will. Auch das wäre politisch eine Aufgabe, über die aber niemand spricht.
Insofern haben wir hier sehr große Scheindebatten von Lobbyisten, von Energiewendegegnern, die immer wieder behaupten, das sei alles nicht bezahlbar. Und dagegen wehre ich mich. Und da gibt’s genügend Argumente in meinem Buch.
Maike Albath: Claudia Kemfert sieht auch große Chancen in der grünen Zukunft und in den Möglichkeiten, die wir mit den erneuerbaren Energien haben. Wir sprachen über ihr Buch „Kampf um Strom“, erschienen im Murmann Verlag. „Das grüne Gewissen“ liegt bei Hanser vor, von Andreas Möller.
Wir haben jetzt noch Zeit für eine Lektüreempfehlung. Welchem Buch wünschen Sie viele Leser, Andreas Möller?
Andreas Möller: Das ist die berühmte Qual der Wahl. Ich hab mich für Henry David Thoreau: „Walden“ entschieden. Das ist eines der Bücher, die ich als erstes mit einem durchaus romantischen Gefühl des Wunsches nach Ausstieg, des Wunsches, aus der Stadt hinaus in die Natur, gelesen habe. Ich finde nach wie vor, dass es unter den Klassikern zu diesem Thema ein ganz wunderbares Buch ist, das beide Seiten abdeckt, nämlich auf der einen Seite die Sehnsucht nach der Natur und auf der anderen Seite auch den inneren Widerspruch, der ein bisschen ironisch gebrochen ist, dass das mit dem Ausstieg manchmal eben doch nicht so einfach ist – nach wie vor ein ganz großartiges Buch.
Maike Albath: Henry David Thoreau: „Walden oder Hüttenleben im Walde“ liegt im Manesse Verlag vor. Claudia Kemfert, Ihre Empfehlung?
Claudia Kemfert: Ja, meine ist seit 2010 geblieben, noch immer das Buch „Solar“ von Ian McEwan. Das ist eine herrliche Satire des Wissenschaftsbetriebs, zugleich eine Allegorie der Gesellschaft, die sich genauso unbarmherzig wie der Protagonist keinesfalls um den Schutz des Klimas kümmert, sondern eher durch Völlerei, maßlose Gier und Verachtung auffällt. Es ist eine herrliche Satire, britischer Zynismus, britischer Humor. Und wer den Protagonisten kennt, um den es hier geht in dem Buch, der wird herrlich lachen. Ich kenne ihn. Und insofern ist es unglaublich witzig, aber für alle Leser. Das kann ich uneingeschränkt empfehlen.
Maike Albath: Ian McEwan: „Solar“ ist bei Diogenes erschienen. – Von der Leipziger Buchmesse verabschiedet sich Maike Albath.
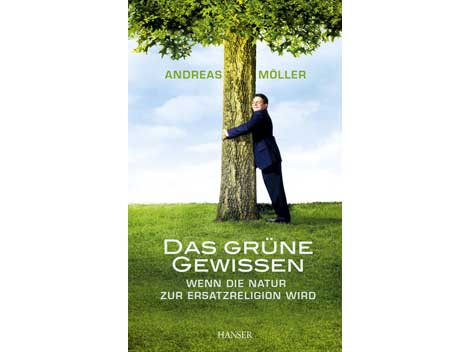
Andreas Möller: Das grüne Gewissen – Wenn die Natur zur Ersatzreligion wird© Carl Hanser Verlag
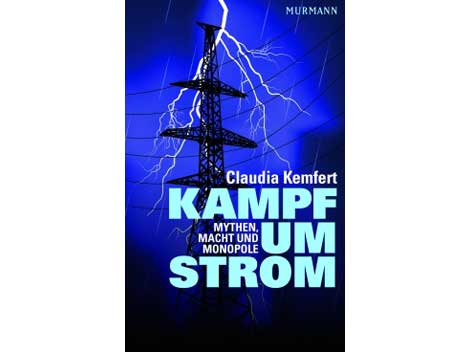
Claudia Kemfert: Kampf um Strom: Mythen, Macht und Monopole© Murmann Verlag
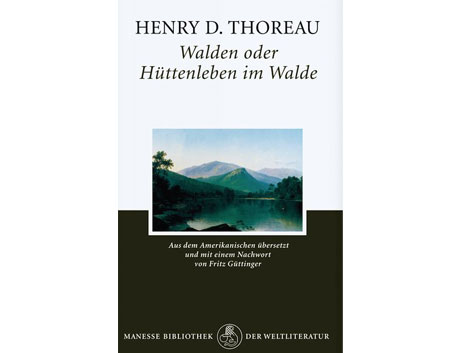
Buchcover „Walden oder Hüttenleben im Walde“ von Henry D. Thoreau© Manesse Bibliothek der Weltliteratur
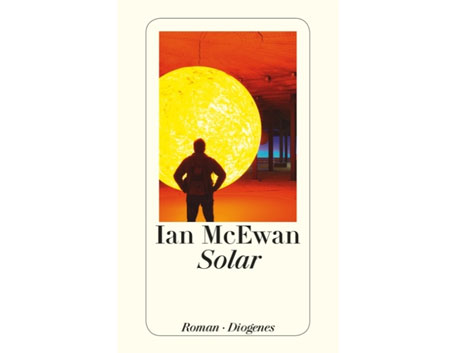
Buchcover „Solar“ von Ian McEwan© Diogenes
