Wer Obama ablösen will, kommt an ihnen nicht vorbei
Die Journalistin Eva Schweitzer verbrachte vier Wochen im Bibelgürtel, also in den Südstaaten der USA, um der christlich-fundierten Ideologie der Tea Party auf die Spur zu kommen. Die Autorin schafft es, die Wurzeln der konservativen amerikanischen Bewegung buchstäblich bloßzulegen.
Eva Schweitzer ist bestens geeignet, den Europäern die Amis im Allgemeinen und das Phänomen Tea Party im Besonderen näherzubringen: Die promovierte Amerikanistin wuchs in Deutschland und den USA auf, sie lebt seit vielen Jahren dies- und jenseits des Atlantiks, mit Wohnsitzen in Berlin und New York.
Die Recherchen für Ihr Buch über Amerikas "Neue Rechte" führten die Autorin jedoch weit weg von "Big Apple", gilt New York doch nach amerikanischen Maßstäben als eher linksliberale Metropole, in der es zwar auch Millionen konservativer Wähler der Republikaner gibt, aber vergleichsweise wenig Anhänger der Tea Party.
Fast 20.000 Kilometer legte Eva Schweitzer kreuz und quer in den Vereinigten Staaten zurück, um dem Geist - beziehungsweise Ungeist - dieser noch recht jungen, aber bereits äußerst einflussreichen Bewegung nachzuspüren. Die Journalistin verbrachte viele Wochen in den so genannten "Heartlands", im weitgehend ländlichen "Bible Belt", wo die stark christlich fundierte Ideologie der Tea Party auf besonders fruchtbaren Boden stößt.
Dort, aber auch in den urbanen Zentren des weiten Landes beobachtete die Autorin den wachsenden Einfluss der Tea-Party-Bewegung. Ein Einfluss, der maßgeblich begünstigt wird durch die tief greifende Verunsicherung, die die Amerikaner als Spätfolge von "nine-eleven" und als Reaktion auf die anhaltend schwere Wirtschaftskrise befallen hat - was sich längst in reaktionären, teilweise bizarren Ansichten Bahn bricht, wie Eva Schweitzer meint:
"Die Tea Party, die ja ursprünglich angefangen hat als eine Bewegung, die gegen höhere Steuern, gegen mehr Staat war, ist jetzt mutiert in eine Bewegung, die sich mit den religiösen Ultras assoziiert hat - gegen Schwulenehe, Abtreibung, Verhütung, Ehescheidung; das ganze katholische Programm. Sie ist sehr anti-gewerkschaftlich, eines ihrer Ziele ist, die Macht der Gewerkschaften zu brechen. Und sie ist auch sehr spalterisch, sie ist strukturell in Teilen rassistisch, und auch sehr gegen Immigranten gerichtet."
Ein wenig schmeichelhafter Befund, der sich wie ein roter Faden auch durch das knapp 280 Seiten starke Buch zieht. Die Entschiedenheit, mit der Eva Schweitzer über die Tea Party, deren Vertreter wie Anhänger urteilt, ist Stärke und Schwäche des Buches zugleich.
Es gelingt der Autorin, die Wurzeln der Tea Party buchstäblich bloßzulegen - dabei entsteht ein unheilvolles Bild aus Chauvinismus und Bigotterie, aus Überheblichkeit und Unwissenheit, aus Selbstgerechtigkeit und Rassismus. Einem Rassismus, der sich zuvorderst gegen Präsident Obama, den verhassten schwarzen Mann im Weißen Haus richtet, aber auch - in besonders verquaster Weise - gegen jüdische Amerikaner, sofern sie im Verdacht stehen, anders zu denken und zu leben, als es dem Wertekanon der "Neuen Rechten" entspricht:
"Es gibt eigentlich keinen offenen Antisemitismus. Im Gegenteil, die Tea Party ist pro-zionistisch, sie sind pro Israel. Sie hassen die linke Presse - was die so links nennen, also die liberale Presse. Und insbesondere mögen die diese ganzen jüdischen Journalisten nicht. Also, es ist so ein Antisemitismus, ohne das Wort Jude zu verwenden, der sich im Grunde gegen linke Intellektuelle wendet."
So weit, so stark - vor allem meinungsstark. Die Schwäche des Buches liegt indes darin, dass es der Autorin trotz ihrer kundigen Schilderungen von Land und Leuten und all der Exkursionen in die amerikanische Historie und Seele nicht erschöpfend gelingt, das Phänomen Tea Party wirklich überzeugend begreiflich zu machen. Salopp gesagt: Eva Schweitzer kann erklären, wie Amerikaner "ticken", aber sie kann nicht so recht verständlich machen, warum sie so "ticken".
Das mag daran liegen, dass die Autorin ganz offensichtlich geradezu abgestoßen ist von der - wie es im Buchuntertitel etwas reißerisch heißt - "weißen Wut", die sie bei ihren Recherchen erlebt hat. Der Leser aber fragt sich nach der Lektüre verwundert - und auch verschreckt -, wie es nur möglich ist, dass zigmillionen kreuzbrave Amerikaner dermaßen einfältig reaktionären Rattenfängern auf den Leim gehen.
Diese Schwäche des Buches wird auch nicht gänzlich dadurch aufgewogen, dass die Autorin klar offenlegt, welch knallharte ökonomische Interessen hinter der vermeintlichen Grasswurzelbewegung stehen und sie steuern.
"Big Money" hat sehr rasch erkannt, dass die Finanzierung der Tea-Party-Bewegung und deren krude, rückwärts gewandte Weltsicht die Chance auf ein hoch rentables Investment darstellt: Die Lockerung von Umweltauflagen, die Beschränkung von Arbeitnehmerrechten, der Abbau sozialer Standards, und vor allem die Ablehnung eines Krankenversicherungsschutzes für alle Amerikaner - für den Obama steht -, dafür lohnt es sich aus Sicht kühl kalkulierender Kapitalisten zu kämpfen.
Da die Medien der USA bekanntlich nahezu ausnahmslos privatwirtschaftlich organisiert sind, findet die Tea Party auch dort breiteste publizistische Unterstützung. Wobei sich - wie Eva Schweitzer ebenfalls eindrucksvoll zeigt - unter den amerikanischen Journalisten zahlreiche bekannte Köpfe finden, die das Geschäft der "Neuen Rechten" mit nachgerade religiöser Inbrunst betreiben; geradezu so, als befänden sie sich auf einem Kreuzzug.
Nachdrücklich beschreibt die Autorin, wie die Anhänger der Tea Party seit dem Amtsantritt von Präsident Obama die Republikanische Partei mit ihrem Gedankengut infiziert haben und inzwischen die "Grand Old Party" vor sich hertreiben: Wer Barack Obama im Weißen Haus ablösen will, kommt an der Agenda der "Neuen Rechten" nicht vorbei, so die Kernaussage des Buches.
Allerdings haben die Ereignisse seit Redaktionsschluss des Buches vor sechs Monaten Eva Schweitzers Ausgangsthese von der drohenden Machtübernahme der Tea-Party-Bewegung zwar nicht widerlegt, jedoch eindeutig relativiert. Denn inzwischen weiß man: Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird ein stramm Konservativer, aber kein Tea-Party-Mann sein.
Auch Eva Schweitzer rechnet nunmehr damit, dass sich der eher gemäßigte Mitt Romney bei der Kandidatenkür durchsetzen dürfte - die Tea Party werde ihm dann aber einen der ihren an die Seite stellen:
"Romney ist im Grunde seines Herzens moderat. Deswegen ist so die gängige Einschätzung, dass Romney mit einem dieser Leute als Vizepräsident antreten muss, um gewählt zu werden. Man weiß natürlich bis heute noch nicht, wer - er ist ja noch gar nicht Kandidat. Aber das denke ich, daran wird er nicht vorbeikönnen. Also er wird irgendeinen Südstaatler, der den Evangelikalen nahesteht, die ja mit der Tea Party schon so halb verschmolzen sind, als Vizepräsident auswählen. Und so wird so über die Hintertür einer dieser Leute ins Weiße Haus kommen, weil so ganz vorbei kommt man an denen nicht."
Trotz der angesprochenen Schwächen ist das Tea-Party-Porträt aus der Feder von Eva Schweitzer ein gelungenes und lesenswertes Buch, das sein "Haltbarkeitsdatum" auch dann noch nicht überschritten haben wird, wenn die Vereinigten Staaten ihren nächsten Präsidenten gewählt haben.
Eva C. Schweitzer: Tea Party. Die weiße Wut.
Was Amerikas Neue Rechte so gefährlich macht.
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2012
Die Recherchen für Ihr Buch über Amerikas "Neue Rechte" führten die Autorin jedoch weit weg von "Big Apple", gilt New York doch nach amerikanischen Maßstäben als eher linksliberale Metropole, in der es zwar auch Millionen konservativer Wähler der Republikaner gibt, aber vergleichsweise wenig Anhänger der Tea Party.
Fast 20.000 Kilometer legte Eva Schweitzer kreuz und quer in den Vereinigten Staaten zurück, um dem Geist - beziehungsweise Ungeist - dieser noch recht jungen, aber bereits äußerst einflussreichen Bewegung nachzuspüren. Die Journalistin verbrachte viele Wochen in den so genannten "Heartlands", im weitgehend ländlichen "Bible Belt", wo die stark christlich fundierte Ideologie der Tea Party auf besonders fruchtbaren Boden stößt.
Dort, aber auch in den urbanen Zentren des weiten Landes beobachtete die Autorin den wachsenden Einfluss der Tea-Party-Bewegung. Ein Einfluss, der maßgeblich begünstigt wird durch die tief greifende Verunsicherung, die die Amerikaner als Spätfolge von "nine-eleven" und als Reaktion auf die anhaltend schwere Wirtschaftskrise befallen hat - was sich längst in reaktionären, teilweise bizarren Ansichten Bahn bricht, wie Eva Schweitzer meint:
"Die Tea Party, die ja ursprünglich angefangen hat als eine Bewegung, die gegen höhere Steuern, gegen mehr Staat war, ist jetzt mutiert in eine Bewegung, die sich mit den religiösen Ultras assoziiert hat - gegen Schwulenehe, Abtreibung, Verhütung, Ehescheidung; das ganze katholische Programm. Sie ist sehr anti-gewerkschaftlich, eines ihrer Ziele ist, die Macht der Gewerkschaften zu brechen. Und sie ist auch sehr spalterisch, sie ist strukturell in Teilen rassistisch, und auch sehr gegen Immigranten gerichtet."
Ein wenig schmeichelhafter Befund, der sich wie ein roter Faden auch durch das knapp 280 Seiten starke Buch zieht. Die Entschiedenheit, mit der Eva Schweitzer über die Tea Party, deren Vertreter wie Anhänger urteilt, ist Stärke und Schwäche des Buches zugleich.
Es gelingt der Autorin, die Wurzeln der Tea Party buchstäblich bloßzulegen - dabei entsteht ein unheilvolles Bild aus Chauvinismus und Bigotterie, aus Überheblichkeit und Unwissenheit, aus Selbstgerechtigkeit und Rassismus. Einem Rassismus, der sich zuvorderst gegen Präsident Obama, den verhassten schwarzen Mann im Weißen Haus richtet, aber auch - in besonders verquaster Weise - gegen jüdische Amerikaner, sofern sie im Verdacht stehen, anders zu denken und zu leben, als es dem Wertekanon der "Neuen Rechten" entspricht:
"Es gibt eigentlich keinen offenen Antisemitismus. Im Gegenteil, die Tea Party ist pro-zionistisch, sie sind pro Israel. Sie hassen die linke Presse - was die so links nennen, also die liberale Presse. Und insbesondere mögen die diese ganzen jüdischen Journalisten nicht. Also, es ist so ein Antisemitismus, ohne das Wort Jude zu verwenden, der sich im Grunde gegen linke Intellektuelle wendet."
So weit, so stark - vor allem meinungsstark. Die Schwäche des Buches liegt indes darin, dass es der Autorin trotz ihrer kundigen Schilderungen von Land und Leuten und all der Exkursionen in die amerikanische Historie und Seele nicht erschöpfend gelingt, das Phänomen Tea Party wirklich überzeugend begreiflich zu machen. Salopp gesagt: Eva Schweitzer kann erklären, wie Amerikaner "ticken", aber sie kann nicht so recht verständlich machen, warum sie so "ticken".
Das mag daran liegen, dass die Autorin ganz offensichtlich geradezu abgestoßen ist von der - wie es im Buchuntertitel etwas reißerisch heißt - "weißen Wut", die sie bei ihren Recherchen erlebt hat. Der Leser aber fragt sich nach der Lektüre verwundert - und auch verschreckt -, wie es nur möglich ist, dass zigmillionen kreuzbrave Amerikaner dermaßen einfältig reaktionären Rattenfängern auf den Leim gehen.
Diese Schwäche des Buches wird auch nicht gänzlich dadurch aufgewogen, dass die Autorin klar offenlegt, welch knallharte ökonomische Interessen hinter der vermeintlichen Grasswurzelbewegung stehen und sie steuern.
"Big Money" hat sehr rasch erkannt, dass die Finanzierung der Tea-Party-Bewegung und deren krude, rückwärts gewandte Weltsicht die Chance auf ein hoch rentables Investment darstellt: Die Lockerung von Umweltauflagen, die Beschränkung von Arbeitnehmerrechten, der Abbau sozialer Standards, und vor allem die Ablehnung eines Krankenversicherungsschutzes für alle Amerikaner - für den Obama steht -, dafür lohnt es sich aus Sicht kühl kalkulierender Kapitalisten zu kämpfen.
Da die Medien der USA bekanntlich nahezu ausnahmslos privatwirtschaftlich organisiert sind, findet die Tea Party auch dort breiteste publizistische Unterstützung. Wobei sich - wie Eva Schweitzer ebenfalls eindrucksvoll zeigt - unter den amerikanischen Journalisten zahlreiche bekannte Köpfe finden, die das Geschäft der "Neuen Rechten" mit nachgerade religiöser Inbrunst betreiben; geradezu so, als befänden sie sich auf einem Kreuzzug.
Nachdrücklich beschreibt die Autorin, wie die Anhänger der Tea Party seit dem Amtsantritt von Präsident Obama die Republikanische Partei mit ihrem Gedankengut infiziert haben und inzwischen die "Grand Old Party" vor sich hertreiben: Wer Barack Obama im Weißen Haus ablösen will, kommt an der Agenda der "Neuen Rechten" nicht vorbei, so die Kernaussage des Buches.
Allerdings haben die Ereignisse seit Redaktionsschluss des Buches vor sechs Monaten Eva Schweitzers Ausgangsthese von der drohenden Machtübernahme der Tea-Party-Bewegung zwar nicht widerlegt, jedoch eindeutig relativiert. Denn inzwischen weiß man: Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird ein stramm Konservativer, aber kein Tea-Party-Mann sein.
Auch Eva Schweitzer rechnet nunmehr damit, dass sich der eher gemäßigte Mitt Romney bei der Kandidatenkür durchsetzen dürfte - die Tea Party werde ihm dann aber einen der ihren an die Seite stellen:
"Romney ist im Grunde seines Herzens moderat. Deswegen ist so die gängige Einschätzung, dass Romney mit einem dieser Leute als Vizepräsident antreten muss, um gewählt zu werden. Man weiß natürlich bis heute noch nicht, wer - er ist ja noch gar nicht Kandidat. Aber das denke ich, daran wird er nicht vorbeikönnen. Also er wird irgendeinen Südstaatler, der den Evangelikalen nahesteht, die ja mit der Tea Party schon so halb verschmolzen sind, als Vizepräsident auswählen. Und so wird so über die Hintertür einer dieser Leute ins Weiße Haus kommen, weil so ganz vorbei kommt man an denen nicht."
Trotz der angesprochenen Schwächen ist das Tea-Party-Porträt aus der Feder von Eva Schweitzer ein gelungenes und lesenswertes Buch, das sein "Haltbarkeitsdatum" auch dann noch nicht überschritten haben wird, wenn die Vereinigten Staaten ihren nächsten Präsidenten gewählt haben.
Eva C. Schweitzer: Tea Party. Die weiße Wut.
Was Amerikas Neue Rechte so gefährlich macht.
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2012
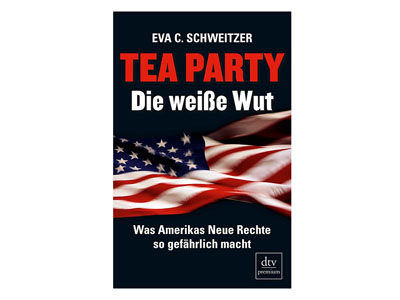
Eva C. Schweitzer: "Tea Party. Die weiße Wut.© DTV
