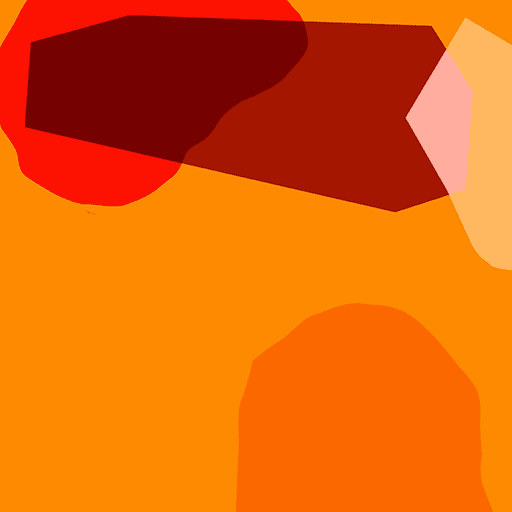Signaturen

Es geht um die alte und neue Lust am Zusammenspiel von Bild und Erzählung. Und um die Frage: Wer sieht mehr Dimensionen?
Janos Frecot: "Fotografie hat ihn immer interessiert als eine Technik zum Ordnen und sammeln und festhalten der Wirklichkeit und in den 30er-Jahren hat er auch schon einen Kamera gehabt und hat fotografiert, diese Negative sind in Bargfeld im Archiv erhalten."
Gerd Rauscher: "Das sind immer Aufbruchszeiten, in denen Faktografisches wichtig wird... aufs Detail zu gucken und zu sehen, was nicht kommensurabel ist, was nicht zuzuordnen ist, das ist sicher Teil der Aufbruchskultur der 60er-Jahre."
Thomas von Steinaecker: "Ich sag das jetzt überspitzt, aber für mich beinhaltet das Medium Buch theoretisch letztlich alle Medien und ist nicht auf Buchstaben und Text beschränkt."
Vor 20 Jahren noch hätte kaum jemand der Fotografie noch eine Zukunft zugetraut. Sie drohte in Randbereiche der bildenden Kunst abzudriften oder in ideenloser Urlaubsknipserei unterzugehen. Nun ist sie wieder ins Zentrum der bildenden Kunst, aber auch der Literatur gerückt.
Durch die elektronischen Kameras wurde das Fotografieren immer einfacher und immer billiger. Inzwischen sind sie zu einem Nebenbei-Werkzeug geworden: Jedes noch so banale Elektronik-Gerät hat neben einem Taschenrechner und der Datumsanzeige auch eine Kamera installiert. Von der Wahrnehmung bis zum Foto ist es nur eine minimale Handbewegung auf den Auslöser, die oft genug das wirkliche Sehen ersetzt.
Die Konsumgewohnheiten haben sich geändert: Fernsehen, Illustrierte und Zeitungen sind bildlastiger geworden. Sogar traditionelle Medien wie Zeitungen treten in ihren Online-Ausgaben mit einem neuen, bildorientierten Layout auf. In vielen Internet-Blogs werden Bilder und Texte miteinander verwoben.
Andererseits: Bilder allein erklären nicht. Bilder allein erzählen keine Geschichten. Sie brauchen die Unterstützung von Information und Text.
Bild und Text reflektieren die Welt, die unmittelbaren sozialen Ereignisse, aber auch das künstlerische Verstehen. Wie genau ist ihr Verhältnis zueinander? Konkurrieren sie um die Aufmerksamkeit? Unterstützen sie den Leser und Zuschauer bei seinem Wunsch, die Welt zu verstehen?
Arno Schmidt, der gerühmte, der gefürchtete Autor von "Schule der Atheisten" und "Zettels Traum" war ein grafischer Schriftsteller. Seine Typoskripte ließen sich, als sie Anfang der 60er- und 70er-Jahre zuerst erschienen, gar nicht mit den herkömmlichen Satzmaschinen setzen, sie mussten fotografiert und zu Büchern gebunden werden − das ergab Lesewälzer im Atlasformat.
Arno Schmidt schrieb nach Gusto Groß- und Kleinbuchstaben, verkürzte für die umgangssprachliche Wiedergabe die geschriebenen Wörter, bis sie so aussahen, wie der Volksmund sie aussprach, andere Wörter verband er durch ein Gleichheits=Zeichen, wenn es ihm sinnstiftend erschien und insgesamt streute er mit lockerer Hand, aber nach genauem Plan, Satzzeichen über das Schriftbild. Er spielte mit Buchstaben: Ein Stacheldraht in der Erzählung wurde zu einer langen Kette von x-en im Schriftbild. Seine Romane waren bei ihrem Erscheinen in den 1970er-Jahren eine optische Herausforderung und sind es auch noch heute.
Manche sagen: Zumutung.
Selbstvergewisserung und Inszenierung
Janos Frecot: "Fotografie hat ihn immer interessiert als eine Technik zum Ordnen und Sammeln und Festhalten der Wirklichkeit und in den 30er-Jahren hat er auch schon einen Kamera gehabt und hat fotografiert, diese Negative sind in Bargfeld im Archiv erhalten."
Janos Frecot, Fotograf und Bibliothekar, war Leiter der von ihm aufgebauten Photografischen Sammlung der Berlinischen Galerie. Er kuratierte eine Ausstellung mit Aufnahmen Arno Schmidt und gestaltete Fotobände mit den Bildern des Schriftstellers:
"Ich sehe die vielen Porträts, die gemacht worden sind von den beiden gegenseitig, sie hat ihn und er hat sie... das ist eine Selbstvergewisserung und auch eine gewisse Art der Selbstinszenierung, grad wenn man diese frühen Porträts denkt, von denen ich ziemlich sicher bin, dass es seine Bildideen sind, auch wenn vielleicht Alice die Kamera gehalten und abgedrückt hat."
Es gibt ein Foto aus dem Jahr 1952 in Castel, einem der vorübergehenden Wohnorte von Arno und Alice Schmidt. Beide stehen nebeneinander im Garten. Der Mann ist groß, breitschultrig, daneben, mit etwas Distanz, etwas schmaler und verhuscht, die Frau.
Arno Schmidt trägt ein ärmelloses Feinrippunterhemd und kurze Hosen. Für das Foto hat er allem Anschein nach tief eingeatmet und die Luft angehalten, um einen imposanten Brustkorb zu formen. Er kommt nicht rüber wie Tarzan, aber für einen Literaten kann er mit einer bemerkenswert sportlichen Figur angeben. Und er tut dies mit erkennbarem Vergnügen.
Janos Frecot: "Genau so ist es, er hat viel Spaß daran gehabt, seine Körperkraft und seine Größe zu thematisieren, sozusagen: An meinem Brustkorb kann man stundenlang entlanglaufen! Und dieses Bild... ist mit Selbstauslöser gemacht. Während andere immer ängstlich in die Kamera starren und auf das Surren und Klicken warten, hat er rumgealbert und mal Luft angehalten und Alice bewundert ihn und das ist wohl das Wichtigste daran."
Ende der 1950er-Jahre zog Arno Schmidt in den kleinen Ort Bargfeld tief in der Lüneburger Heide. In dem Text "Kühe in Halbtrauer" von 1961 reflektiert er diesen Um- und Rückzug:
"Und wieder zurück über sehr sandige Wege. Die dicke=fette Landluft inhalieren. Kühe in Halbtrauer; zwischen und verdorrten Sumpf=Birken." (Arno Schmidt, Kühe in Halbtrauer, Haffmanns Verlag, Bargfelder Ausgabe)
Porst, das ist der Versandhändler Foto-Porst. Aus dessen Katalog konnte man Fotoapparate bestellen, man konnte auch seine belichteten Filme einschicken und Abzüge machen lassen. Als Rahmenhandlung dient der Erzählung die Eroberung einer kleinen Unterkunft auf dem Land:
"Denn wer sich kein Haus kaufen kann - ... der mietet sich ein Baräckchen in der Heide. "Auf 99 Jahre; wie weiland Kiau=Tschou." ... Für einen Spottpreis übrigens, da es sich um <Ödland> handelte - Bauern verstehen ja nichts von Natur & deren Schönheit. Ich hatte noch zusätzlich 50 Mark pro Jahr dazugelegt, unter der Bedingung; daß die nicht verändert werden dürfte; ..." (Arno Schmidt, Kühe in Halbtrauer, Haffmanns Verlag, Bargfelder Ausgabe)

Der Schriftsteller Arno Schmidt© picture alliance / dpa
Später wird man dem zurückgezogen Lebenden den Kriegsnamen "Solipsist in der Heide" verleihen. Seine Landschaftsaufnahmen sind zumeist leer von Menschen. Gelegentlich sind sie von dem Schriftsteller selbst und seltener von seiner Frau Alice bevölkert. Mehrfach sieht man Arno Schmidt, auch mit seiner Frau, als Schatten im Vordergrund – denn: "Vordergrund macht's Bild gesund", war einer der Merksprüche, die den Fotoamateuren halfen, ihre Bilder zu verbessern. Oder auch: "Sonne lacht, Blende acht."
"So fing ich denn an zu knipsen: Sonnenflecke; eine stübchengroße Lichtung; verrosteten Stacheldraht (am Bahnhof, wo das Alteisen lag); larvenzerfressene Pilzruinen; ein Ast im Wald, oh ewig flüchtende Gestalt; einmal mitten ins deutsche Gewölk durch ein spreiziges Tännchen. Natürlich auch mich (mit Selbstauslöser)" (Arno Schmidt, Kühe in Halbtrauer, Haffmanns Verlag, Bargfelder Ausgabe)
Janos Frecot: "Er ist auch dort wie ein perfekter Archivar und Analytiker losgegangen und hat alles das fotografiert, was diese Landschaft ausmacht, und zwar nicht nur diese Pflanzenwelt, diese große Wiesenlandschaft, die Wälder, sondern was ihn dabei immer auch interessiert ist die Luftschaft, wie er das nennt, die Landschaft und die Luftschaft, das gehört zusammen."
Als Motive nutzt Schmidt gern Wasserläufe und Wege, die meist noch unbefestigte Sandwege sind, wenn es sich eben trifft, mit hohen Pappeln an beiden Wegrändern, um den Blick noch tiefer in die Landschaft zu führen. Selten gibt es Detailaufnahmen, er sucht die großen Landschaften, sucht die Linien in der Landschaft, die sie noch größer, breiter, tiefer erscheinen lassen.
Janos Frecot: "Uns ist aufgefallen, dass er in Ahlden gewesen ist, wo ja der Roman 'Das steinerne Herz' angesiedelt ist und in Ahlden hat er zum Beispiel einige Situationen fotografiert, die wortwörtlich auch in der Erzählung vorkommen... aber die Natur- und Landschaftsaufnahmen, die sind eine Art Parallelwerk zum Schreiben."
"Das ist das Schönste im >Leben: Nachttief und Mond, Waldsäume, ein stillglänzendes Gewässer fern in bescheidener Wieseneinsamkeit..." (Arno Schmidt, Kühe in Halbtrauer, Haffmanns Verlag , Bargfelder Ausgabe)
Und dazu die Person, die er einzig in der Landschaft interessant findet: Arno Schmidt. Berühmt ist jenes Foto, das ihn auf der Heide zeigt: Ein Sandweg führt in den Bildhintergrund, im Vordergrund steht ein blattloser Baum, senkrecht das Bild teilend. An den Baum gelehnt der Schriftsteller selbst, in schwarzer Lederjacke, ein Fernglas umgehängt, die Hand auf einen kräftigen Knüppel gelegt, der als Spazierstock oder Waffe dient.
Janos Frecot: "Viele von diesen Bildern sind natürlich für die Veröffentlichung gedacht und das hatte rein pekuniäre Gründe, die beiden haben immer Geld gebraucht und sie haben, wenn zum Beispiel zu einem runden Geburtstag eine Zeitung anrief und sagte: Wir schicken ihnen da jemanden vorbei, der möchte gern ein Interview machen und es kommt auch ein Fotograf mit; dann hieß es sofort: Fotografen brauchen wir nicht, wir fotografieren selbst und dann hat Alice ihn fotografiert und hat diese Fotos verkauft an die Zeitung. Also insofern sind diese Bilder für die Veröffentlichung aufgenommen und haben dazu beigetragen, dass eben dieses Menschenabweisende des großen Einzelgängers, das dieses Bild wirklich festgehalten und propagiert wird."
Arno Schmidt, der 1979 verstorben ist, war zeit seines Lebens ein nicht unbedingt viel gelesener, aber doch bekannter Schriftsteller. In den letzten Jahren wird er zunehmend auch als Fotograf mit einem eigenständigen Blick auf die Landschaft wahrgenommen.
Janos Frecot: "Also wenn ich mir beispielsweise Landschaftsbilder von norddeutschen Fotografen ansehe wie Alfred Ehrhardt oder manches von Albert Renger-Patsch, um mal ein paar ganz große Namen zu nennen, dann sehe ich da durchaus Verwandtschaften ... weil sie eine Qualität haben, sie haben schon eine besondere Qualität des Hinschauens und des Wahrnehmens von Aspekten, an denen man normalerweise vorbei läuft − das ist schon etwas Besonderes."
Zu Beginn war es der Reiz des Neuen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war eine neue Technologie aufgekommen, die Fotografie. Sie wurde relativ schnell handhabbar auch für den Amateur. Natürlich war sie noch umständlich, man brauchte schwere, massive Stative um schwere, hölzerne Kameras mit relativ gewichtigen Glasplatten zu munitionieren, um dann ein Foto aufnehmen zu können. Aber es war keine Geheimwissenschaft. Wer Finger hatte, die zu ungelenk waren, um ordentliche Zeichnungen aufs Papier zu bringen, war immer noch geschickt genug, die Trennscheibe zwischen Objektiv und Fotoplatte hochzuziehen oder später den Gummiballon drücken, der den Auslöser betätigte.
Lewis Carrol ist der Autor von einem der schönsten und versponnensten Kinderbücher der Weltliteratur: "Alice im Wunderland". Nicht versponnen genug: Der Mathematikprofessor und Spezialist für euklidische Zahlentheorie gönnte sich eine Prise Eskapismus und amüsierte sich und seine Nachwelt mit einem legendären Nonsens-Gedicht: "Jabberwocky" − in der deutschen Übersetzung von Christian Enzensberger "Der Zipferlake":
Verdaustig war's, und glaße Wieben
rotterten gorkicht im Gemank.
Gar elump war der Pluckerwank,
und die gabben Schweisel frieben.
rotterten gorkicht im Gemank.
Gar elump war der Pluckerwank,
und die gabben Schweisel frieben.
»Hab acht vorm Zipferlak, mein Kind!
Sein Maul ist beiß, sein Griff ist bohr.
Vorm Fliegelflagel sieh dich vor,
dem mampfen Schnatterrind.«
Sein Maul ist beiß, sein Griff ist bohr.
Vorm Fliegelflagel sieh dich vor,
dem mampfen Schnatterrind.«
Er zückt' sein scharfgebifftes Schwert,
den Feind zu futzen ohne Saum,
und lehnt' sich an den Dudelbaum
und stand da lang in sich gekehrt.
den Feind zu futzen ohne Saum,
und lehnt' sich an den Dudelbaum
und stand da lang in sich gekehrt.
Lewis Carrol, Jabberwocky, In der deutschen Übersetzung von Christian Enzensberger "Der Zipferlake"
In den 1850er-Jahren war die fotografische Apparatur so weit entwickelt, dass sie auch dem technisch begabten Laien zur Verfügung stand. Lewis Carrol erwarb so ein Gerät, nach und nach wurden seine Ausstattung und sein Atelier immer professioneller.
Caroll fotografierte Schriftstellerkollegen und Freunde, aber sein Lieblingsmotiv wurde Alice Liddell, ein kleines Mädchen, das ihn dazu inspirierte, die Geschichte von "Alice im Wunderland" aufzuschreiben.
Schon die erste, noch private Fassung hatte Carrol mit Zeichnungen versehen, ihm stand also von vornherein eine Verbindung von Bild und Text vor Augen. In den publizierten Fassungen wurden die Illustrationen von einem professionellen Zeichner ausgeführt, aber sie waren von Anfang an fester Bestandteil des erzählerischen Konzepts gewesen.
Während Carrol seinem Beruf als Mathematik-Dozent und seiner immer erfolgreicheren Karriere als Schriftsteller nachging, wuchs auch sein Interesse an der Fotografie. Und an kleinen Mädchen, die er gern auch nackt fotografierte. In der Wissenschaft gibt es einen Streit darüber, ob er damit einer privaten unguten Vorliebe nachging oder einer allgemeinen victorianischen Freude an unschuldigen Feen und Engelchen − der Streit ist noch nicht beigelegt.
Heute würden solche von Künstlerhand nachkolorierten Bildchen unter das Edathy-Verdikt fallen und von Kämpferisch-Wohlmeinenden in die Tonne getreten. Aber vielleicht waren die Fotos niedlicher Mädchen nur die Vorbereitung auf den literarischen Schöpfungsakt − dann bekäme man nur beides zusammen: das kleine, nackte Mädchen und die zauberhafte "Alice im Wunderland". Der Streit ist eröffnet.
"Dann steht dieser plundrige, kleine Kodak auf"
Ein weiteres Beispiel für die frühe Verbindung von Literatur und Fotografie ist Mark Twain, der Moralist, der die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn schilderte. In seiner Arbeit hatte er eigentlich nur so viel mit der Fotografie zu tun, als er sich seiner attraktiven Erscheinung sehr bewusst war und daher gern fotografieren ließ.
Die Politik änderte sein Verhalten: 1885 hatte die Berliner Kongo-Konferenz die Region Kongo an den belgischen König Leopold zur Verwaltung übertragen. Leopold betrachtete das Land als seinen Privatbesitz und beutete es mit unglaublicher Brutalität aus. Folter und Verstümmelung, um die Menschen zur Arbeit zu zwingen, waren an der Tagesordnung. Amerikanische Missionsgesellschaften statteten daraufhin ihre Missionare mit einfachen Kodak-Fotoapparaten aus, mit denen diese Verbrechen dokumentiert wurden. Die "Kongo-Reformgesellschaft" bat 1904 Mark Twain für ihre Kampagne gegen den belgischen Despoten um einen Text und so entstand "König Leopolds Selbstgespräch". Mark Twain lässt in diesem Selbstgespräch den blutigen König hasserfüllt auf die moderne Technik geifern:
"Ja, in den guten, alten Zeiten lief alles harmonisch und glatt ab, und man blickte zu mir auf als dem Wohltäter eines geknechteten und freundlosen Volkes. Dann kam ganz plötzlich der große Krach! Das heißt, der unbestechliche KODAK − und die ganze Harmonie ging zum Teufel. Zehntausend Kanzeln und zehntausend Druckerpressen legen ständig ein gut Wort für mich ein...Dann steht dieser plundrige, kleine Kodak auf, den ein Kind in der Tasche umhertragen kann, sagt kein einziges Wort und lässt sie verstummen."
Mark Twain, Zitiert aus Thomas Ayck, Mark Twain, Rororo bildmonographien
Rowohlt Verlag. o.Ü.
Ein historisches Ereignis: Der technische Fortschritt hatte aus jedem beliebigen Amateur einen wertvollen Zeitzeugen gemacht, der die Mächtigen angreifen konnte. Ein ähnlicher Quantensprung in der Bilddokumentation ereignete sich erst wieder durch die billigen elektronischen Video- und allgegenwärtigen Handykameras.
Mark Twain, selbst ein Fan des technischen Fortschritts und zugleich tiefverzweifelter Pessimist wegen des moralischen Niedergangs der menschlichen Rasse, nutzte die Fotografie, um das ins Buch zu bringen, was ihm die satirische Sprache nicht geben konnte. Das Foto galt als ein unmanipulierbar geltendes Dokument, das seinem fiktionalen Text − nämlich dem Selbstgespräch des wutschnaufenden Königs − die unumstößliche Wahrhaftigkeit zulieferte, die Mark Twain für seine Kampagne benötigte.
Wobei nicht zur Sprache kommt, dass die Fotos von verstümmelten kongolesischen Kindern nur deswegen als unbezweifelbares Beweismittel galten, weil hinter ihnen die moralische Integrität der Missionare stand, die diese Aufnahmen mit der simplem Kodak-Box geschossen hatten.
Thomas von Steinaecker: "(lacht) Da sprechen Sie einen Knackpunkt meiner disputatio an, ich hatte die ganze Dissertation eher historisch angelegt ..."
... sagt Thomas von Steinaecker: "Schriftsteller, Filmemacher, Journalist, Rezensent."

Der Schriftsteller Thomas von Steinaecker© dpa / picture alliance / Arno Burgi
Thomas von Steinaecker hat seine Dissertation über drei Autoren geschrieben, in deren Werk Fotografie und Literatur zusammen spielen: Rolf Dieter Brinkmann, W.G. Sebald und Alexander Kluge. Mit einem historischen Rückblick:
"Also gerade im Surrealismus die Verdoppelung der Welt, das ist ja das Grundthema des Surrealismus, dass man die Wirklichkeit verlängert oder verfremdet in eine andere Dimension, die dann einen neuen Blick gestattet auf unsere Welt, und genau deswegen war ja die Fotografie für die Surrealisten so spannend, weil genau das eigentlich das Medium bewerkstelligt − also Surrealismus auf der einen Seite und eine eher politisch orientierte Bewegung bei Brecht und Tucholsky, wo der dokumentarische Wert der Fotografie im Mittelpunkt steht, also Dokumentation der Weimarer Republik und bei Brecht dann das Dritte Reich vor allem, der Zweite Weltkrieg und Kapitalismuskritik."
Rolf Dieter Brinkmann vor allem − sein Buch "Rom Blicke" ist ein großformatiges Konvolut, das im Rahmen eines Stipendiums in der Villa Massimo 1972/73 entstand.
Steinaecker: "Das Konzept der Fotos ist von Anfang an eigentlich vorhanden, wenn ich mich richtig erinnere, beginnt es mit dieser Collage aus sehr unterschiedlichen Materialien, dieser Fahrkarte von Köln nach Rom und dann kommt ein Textausschnitt, der glaub ich sinngemäß heißt Tritt ein oder Jetzt geht es los oder Tritt an, eine Postkarte vom Bahnhof in Rom und verschiedenen anderen Bildern."
"... kurz darauf kam das Geld/: wieder Umschwung und den Proviant fertig machen, Brötchen, Eier kochen, packen, duschen und anziehen/...auch wieder undeutliche Schreckvorstellungen von Zugunglücken, als ich dann in meinem leeren Zimmer untätig saß und mich umsah/:...während der Fahrt, ein neuer Ansturm der Bodenlosigkeit, keinen Ort zu haben und Erinnerungen an das Hin- und Hergereise seit Vechta, eine grauenhafte Unsicherheit, die ich begreifen lernte/: also wohin jetzt? dachte ich."
Rolf Dieter Brinkmann, Rom, Blicke, Rowohlt
Steinaecker: "Das Ganze ist noch sehr unzusammengefügt, aber man merkt schon, dass er ein klares Gespür für diese Art der Collage hat... und dann geht es eben los mit dieser Bahnfahrt von Köln nach Rom, die für mich einer der Höhepunkte des Buches ist, also man hat das Gefühl, jemand fährt zum ersten Mal Zug, der typische Mensch der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fährt zum ersten Mal Zug und die Eindrücke kommen vollkommen ungefiltert ..."
"Und dann kam die wirklich total überraschende Umstimmung: glänzendes, wolkenloses Blau, Sonne, massive Felswände in einer Entfernung, eine leichte Luft − das totale Gegenteil der Landschaft eine Viertelstunde vorher − braune, felsige Wände, einige abfallende grauweiße Flächen weit an den zurückliegenden Bergspitzen, gelbes Laubgeflirre... und ich habe dagestanden und immerzu geschaut und Fotos gemacht."
Rolf Dieter Brinkmann, Rom, Blicke, Rowohlt
Steinaecker: "... und dann gibt es zwei Seiten, wo auf jeder Seite vielleicht acht, vielleicht zehn Fotos von ihm selbst geschossen sind, die nur so Fahrteindrücke abbilden wie jeder sie kennt, wenn man auf der Fahrt auf den Auslöser drückt, ist das Bild meistens verschwommen und das, was man eigentlich aufnehmen wollte, ist schon längst weitergerauscht."
Ebenso wie das permanente Notieren von Beobachtungen ist das Sammeln von optischen Eindrücken eine Manie Brinkmanns. Die Tatsache, etwas aufgenommen zu haben, erscheint wichtiger als das verwischte oder unscharfe Ergebnis der Bemühungen. Später wird Brinkmann diese Aufnahme- und Registrierungssucht ausweiten, indem er mit einem tragbaren Kassettenrecorder seine Erlebnisse eins zu eins auf Band diktiert.
In "Rom, Blicke" gehören zum Text auch selbst aufgenommene Fotografien, Postkarten, Fahrkarten. Auch aus Zeitungen und Zeitschriften entnommene Fotos gehören dazu, hier folgt Brinkmann ganz offenkundig Bertold Brechts "Kriegsfibel" in der Fotos aus Publikationen entnommen und von Brecht politisch-ideologisch eingeordnet wurden.
Es scheint, als habe Brinkmann sich der Welt, an der er sich als Mensch und Schriftsteller permanent gerieben hat, in all ihren Details versichern wollen. Als habe er sie in seinem Buch inventarisieren wollen, bildlich und verbal. Wobei gewisse Leitmotive immer wieder auftauchen - im Text der Verweis auf den von der Kirche hingerichteten Giordano Bruno, bei den Bildern sind es die mehrfach auftauchenden Fotos von Starfighter-Kampfflugzeugen und Bewaffneten, die ihre Waffen in die Kamera, also auf den Betrachter, richten. Die Splitter der Welt ordnen sich zu Strukturen.
Steinaecker: "Bei Brinkmann fand ich immer, dass er einerseits einen unglaublichen Hass auf die Welt hat, die eben zerfällt und zersplittert vor den Augen, genau das ist ja ein Realitätsschwund, den er da schildert, also ihm kommt die Welt eigentlich abhanden, aber was in manchen Glücksmomenten - eben auch durch die Fotos - aufscheint, ist so ein Moment der intensiven Wahrnehmung, die durch die Fotos hergestellt werden, zum Beispiel eine Blume in der Sonne, die Motive sind relativ beliebig, aber es ist eben der Moment, wo er vollkommen klar ist und vollkommen bei sich und in der Welt ist... Fotos, die etwas sehr Poetisches und sehr Lyrisches haben und wo er durch den Akt des Fotografierens zu einem wahren Menschen wird."
Der Doktorand hat mit seiner wissenschaftlichen Arbeit auch weiter reichende Interessen verbunden.
Steinaecker: "Mich als Schriftsteller hat zum Beispiel sehr interessiert, ob jemand wie Brinkmann, Kluge und Sebald, ob die tatsächlich ein festes Konzept haben, sich vorher überlegt haben: Wo bringe ich die Fotos rein? Gibt es da eine klare Struktur, einen Strukturplan, oder ist das ganze assoziativ? So dass ich angefangen hab, die Fotos tatsächlich zu zählen, welche Motive sind auf den Fotos abgebildet, wie oft kommen diese Motive vor... es war tatsächlich für mich als Schriftsteller als Vorarbeit für spätere mögliche Romane gedacht."
Dazu - wie man immer sagt: Später mehr.
Momente, Details, Assoziationssplitter
Franziska Mecklenburg: "Ich denke, es war ein menschliches Interesse aneinander, auch an dem Werk des anderen, an der Arbeitsweise des anderen, wahrscheinlich auch ganz medienunabhängig, die sie zusammengeführt haben ..."
"Montag, den 4.Februar 1980
- Als was soll ich Sie anmelden? Sind sie verheiratet?
- Sagen Sie: Ein Ethnologenehepaar. Oder besser: Eine Fotografin und ein Schriftsteller. Aber trotzdem Doppelzimmer."
Hubert Fichte, Forschungsbericht, Die Geschichte der Empfindsamkeit, S.Fischer
Franziska Mecklenburg: "... und dann sind sie zusammen gereist und hat Hubert Fichte Leonore Mau zu ihren Lebensthemen geführt, das kann man so sagen, die afroamerikanischen Religionen, die synkretistischen Religionen, das ist dann für Leonore Mau das gewesen, wo sie in ihrer Fotografie auch zu ihrem eigenen Stil gefunden hat."
... sagt Franziska Mecklenburg, Fotohistorikerin. Der Roman "Forschungsbericht" führt für zehn Tage nach Belize. Der Schriftsteller Hubert Fichte und seine Lebensgefährtin, die Fotografin Leonore Mau, die in diesem wie auch in anderen Romanen von Hubert Fichte als Jäcki und Irma auftauchen, sind in Belize, um Untersuchungen über die karibischen Mischreligionen zusammenzutragen. Fichte, also Jäcki, der sich als Reporter des Unmittelbaren im Geiste Herodots versteht, trägt als Schriftsteller seine Eindrücke zusammen, Leonore Mau alias Irma als Fotografin. Beide sind einander ähnlich in der Arbeitsweise, sie sammeln zeitliche Momente, materielle Details, Assoziationssplitter.
Die kleine Greisin winkte Jäcki und Irma in den Altarraum.
Der Eingangstür gegenüber.
Himmelsrichtungen
Interessieren mich nicht.
Lapsus.
Kann ich nicht ändern.
Als würde staub durch eine Ritze geblasen.
Flirrt.
Streifen Licht.
Blendet.
Heilige glimmen auf.
Johnsons Babypuder.
Lazarus mit dem Hündchen.
Und so weiter.
Der ewige bikontinentale Altar.
Was ist daran nun besonders karibisch?
Doch, das Bild von Benjamin Nicholas.
Ich wußte es, der Maler malt für den Tempel.
Kaum zu erkennen. Wieder Neapelgelb, Frau-Angelico-Blau und Kakao.
Eine Frau.
Das Porträt der Priesterin, der Buje.Ich bin mit dem Maler verabredet. Ich muss gleich los.
Wo ist die Buje, fragt Jäcki die kleine Greisin.
Sie sieht bigott an die Decke und zuckt die Achseln. Sie zuckt gar nicht die Achseln Sie zuckt die Schultern. Nein.
Himmelsrichtungen
Interessieren mich nicht.
Lapsus.
Kann ich nicht ändern.
Als würde staub durch eine Ritze geblasen.
Flirrt.
Streifen Licht.
Blendet.
Heilige glimmen auf.
Johnsons Babypuder.
Lazarus mit dem Hündchen.
Und so weiter.
Der ewige bikontinentale Altar.
Was ist daran nun besonders karibisch?
Doch, das Bild von Benjamin Nicholas.
Ich wußte es, der Maler malt für den Tempel.
Kaum zu erkennen. Wieder Neapelgelb, Frau-Angelico-Blau und Kakao.
Eine Frau.
Das Porträt der Priesterin, der Buje.Ich bin mit dem Maler verabredet. Ich muss gleich los.
Wo ist die Buje, fragt Jäcki die kleine Greisin.
Sie sieht bigott an die Decke und zuckt die Achseln. Sie zuckt gar nicht die Achseln Sie zuckt die Schultern. Nein.
Die Texte lesen sich, je nach Betrachtungsweise, wie eine Aufzählung oder eine Litanei, in der die einzelnen Anrufungen allein schon durch ihre Aneinanderreihung auf etwas Größeres - Höheres - Bedeutenderes verweisen sollen. Fichtes Arbeiten wurden als "Ethnopoesie" bezeichnet.
Am Strand von Belize trifft Jäcki, der Wunsch-Herodot, auf einen Holzfäller mit Wollmütze. Es entsteht Jahrhunderte und Räume übergreifende Erkenntnis:
Herodot staunt, dass sie hier Wollmützen tragen. Eben noch nahm er die Wollmützen der Libyer in seine Kartei auf. Und eine Minute später ist es schon das Wollmützenfoto von F.C. Gundlach für den Quellekatalog.
(Hubert Fichte, Forschungsbericht, Die Geschichte der Empfindsamkeit, S.Fischer)
F.C. Gundlach war in den 1970er- und -80er Jahren der führende Modefotograf in der Bundesrepublik. Was Fichte damals nicht ahnen konnte: Für die F.C. Gundlach-Stiftung betreut heute Franziska Mecklenburg den Nachlass der 2013 verstorbenen Fotografin Leonore Mau:
"Also ich hab die Bilder vorliegen und kann genau sagen, diese Stelle, wo er den "Ananasmann" am Strand von Rio de Janeiro beschreibt, dazu gibt es ein Bild. Und ich denke, dass er sich auch daran erinnert hat, dass er sich Notizen gemacht hat, dass er das als Bild erinnert hat, wie sie dort mit der Kamera stand, wie sie zusammen vielleicht sogar besprochen haben, das zu fotografieren und dann hat er das auch als Bild in Erinnerung und schreibt es auch sehr bildlich dann in dem Roman. Also nicht durchgängig, aber es gibt die Situationen, die eins-zu-eins in den Bildern wiederzufinden sind."
Die Medien durchmischen sich in den Personen der Künstler. Beide tauschen sich über ihre Wahrnehmungen aus, bevor jeder für sich in seinem Metier die Arbeit aufnimmt, aus der dann, als Text und Foto, eigenständige Ergebnisse entstehen. Fichte spielte auch, gleichsam als Fingerübung und ohne die Absicht, die Ergebnisse zu publizieren, mit Collagen, indem er Papierabzüge von Fotos von Leonore Mau zerschnitt und neu montierte.
Franziska Mecklenburg: "Also er hat in ihrem Arbeitsbereich gewildert, er hat diese Collagen gemacht, was eben eine Vermischung auch der Medien ist, also seiner Herangehensweise, seiner sprachlichen analytischen Herangehensweise, sie war nicht übergriffig auf sein Werk, seine Schreibweise, dennoch hat sie ihn natürlich stark beeinflusst. ... gibt es sehr viele Szenen, wo er Bilder beschreibt, die sie gemacht hat."
Das Gesicht eines Mannes. Er lächelt, er trocknet das Gesicht ab, er trinkt aus einer Tasse, beißt in ein Brot. Dann das Bild einer schlafenden Frau im Bett mit ihrem Kind.
Hubert Fichte liest den Text zu dem Fotofilm "Der Tag eines unständigen Hafenarbeiters". Die Fotos sind von Leonore Mau. Es ist einer von vier Fotofilmen in der Länge von 10 bis 13 Minuten, die sie Ende der 1960er-Jahre für den Norddeutschen Rundfunk gemacht haben - bis heute eine eher vergessene Strecke in ihrer gemeinsamen Arbeit, die sogar in Werkverzeichnissen gern übersehen wird. Der Text von Fichte wird bebildert mit Fotos, zum Beispiel dem Schild einer Bushaltestelle:
Die Arbeit an einem Film hebt die Kollaboration zwischen dem Schriftsteller und der Fotografin auf eine neue künstlerische Ebene. Der Fotofilm, die abgefilmten Fotos kombiniert mit einem Text und Geräuschen oder sogar eingeschnittenen Fernsehsequenzen, war eine Kunstform, der man damals noch größere Chancen eingeräumt hat. Anders als bei einem entsteht die Bildspannung daraus, das ein stehendes Bild, ein Foto, aufgenommen wird von einer sich über das Bild bewegenden Kamera. Das Endprodukt ist nicht ganz so leicht zu konsumieren wie ein konventioneller Film, weshalb dieses künstlerische Verfahren nie populär wurde.
Gerd Roscher: "Oft war es doch so, dass es sehr autonom abgelaufen ist, also dieser Fotofilm, den sie in Hamburg gemacht haben über den unstetigen Hafenarbeiter, da war Fichte krank zuhause und sie ist losgezogen und hat die Fotoarbeiten gemacht ..."
Gerd Roscher hat 40 Jahre lang als Dozent an der Kunsthochschule Hamburg den Bereich Dokumentarfilm betreut und kannte Leonore Mau seit vielen Jahren:
"... und Fichte hat dann die sortiert, hat dann zum Teil sein Signum mit drauf geschrieben wie: Die gefallen mir, die gehören da mit hinein -"
Der Fotofilm ist ein eigenständiges Medium, weil hier die Handlung vom Text voran getrieben wird, während die statischen Fotos die Handlung verzögern und Raum geben für die Fantasie des Zuhörers / Zuschauers.
Roscher: "Dann kommt sie zurück mit den Fotos, entwickelt sie, legt sie auf den Boden und dann wird es hin und her sortiert aber an der Stelle glaube ich hat sie auch ein Stückchen die Arbeit abgetreten und hat gesagt, jetzt ist der Schriftsteller gefragt, der das zuordnet."
Gerd Roscher: "Das Faktografische, die Fakten ernst nehmen, genau nehmen, auch ihre Widerborstigkeit, ihre Nichtstimmigkeit ernst nehmen und nicht sofort zuzurichten, das gehört in den literarischen Aufbruch, den Fichte vertritt, und da hat dann die Fotografie mit ihrem schon auf das Äußere Bezogenen eine große Bedeutung. Aber in der Konstellation, denn die Fotografie an sich bedarf auch der Interpretation der Zuordnung der Montage, der Collage, oder eben wie in diesem Idealfall auch textlicher Bereicherung."
Hubert Fichte und Leonore Mau haben in vier Fotofilmen auf einzigartige Weise Texte und Fotos miteinander kombiniert. Man kann Fotofilme als eine Collage verstehen, in der Bild und Text in ihren emotionalen und erzählerischen Möglichkeiten erweitert werden durch das Zusammenspiel mit der jeweils anderen Kunst. So entwickeln diese Filme eine ganz eigene Faszination.
Dass dieses Genre anscheinend ausgestorben ist, wird man wohl als eine Fehlentwicklung der kulturellen Evolution bedauern müssen.
Es geht noch! extremer.
Im Maul des Krokodils
Es gibt eine Collage von Peter Beard, die - alles wie in eine Nussschale zusammengeschoben - seine Interessen und seine Kunst zusammen zeigt.
Im Zentrum des Bildes liegt der amerikanische Fotograf Peter Beard, ein sehr schöner, sportlich-schlanker Mann, nur mit einem Lendentuch bekleidet, auf dem Boden. Seine Beine stecken bis hinauf zum Unterleib im weit aufgesperrten Rachen eines Krokodils. Während das Krokodil den Eindruck erweckt, es würde Wirbel für Wirbel den ganz Mann verschlingen, schreibt dieser am Boden liegend in einem dicken Tagebuch. Handschriftlich steht auf dem Bild:
"Ich werde schreiben, wann immer es mir möglich ist. Mit besten Grüßen Peter Beard, Lake Rudolf, Kenia"
Den Rahmen für dieses Bild-Sujet "Mann im Krokodilsmaul" bilden dreißig bis vierzig kleinformatige Fotos im Briefmarkenformat oder noch kleiner. Sie zeigen afrikanische Menschen und Landschaften, Dokumentaraufnahmen oder auch Inszenierungen mit Fotomodellen. Dazu - wie so oft in seinem Werk - ein Porträt der alten, fast ausgemergelt erscheinenden Schriftstellerin Tania Blixen. Die obere Hälfte des Bildes ist überwischt mit wässiger roter Farbe, wie eine Spur von Blut.
Zum Jäger und Abenteurer Beard passt, dass es während dieser Aufnahme ein fast dramatisches Malheur gegeben hat: Beard steckte im Rachen des toten Krokodils, als in einem letzten unwillkürlichen Zucken sich einige Muskel des Tiers verkrampften. Beinahe wäre der schreibende Fotograf verletzt worden.
Peter Beard entstammt einer sehr reichen Familie der amerikanischen Ostküste. Einer seiner Vorfahren hatte mit einer Eisenbahnlinie quer durch die Vereinigten Staaten ein Vermögen aufgebaut. Beard trödelte vom Luxus verwöhnt durch die Welt und versuchte dann, ein Studium in Harvard durchzuziehen, gab aber auf. Mit etwas mehr als 20 Jahren ging er nach Afrika, lernte in Kenia die Schriftstellerin Tanja Blixen kennen und kaufte in ihrer Nachbarschaft selbst eine Farm. Beard wurde Zeuge des epochalen, nicht umkehrbaren Wandels eines Landes und einer Gesellschaft.
"End of the game" war in den 1960er Jahren der Titel des ersten großen Fotobandes von Peter Beard. Der Titel ist doppeldeutig: Die Bilder zeigen den Untergang der Tierwelt, des "game" und damit zugleich das Ende des Spiels: Diese Tiere waren auch die bevorzugten Objekte der Großwildjäger: Löwen, Büffel und - in den Augen von Peter Beard - vor allem Elefanten.
In einem Film von 2013 von Derek Peck erzählt Beard von Afrika:
"Die meisten Fotos habe ich von Elefanten gemacht. Das hier zeigt eine Herde von 2 bis 300 Elefanten, die wie ein Staubsauger alles auffressen, was auf dem Weg liegt. 35.000 von ihnen sind verendet. Ich war dort, illegal, nur ich habe die Fotos von ihren Leichen. Diese Themen, mit denen wir umgehen müssen - wie das Land erstickt wird, wie die Vielfalt der Natur erstickt wird, die Ausrottung der Arten - das ist unfassbar."
In den 1960er-Jahren beobachtete Beard, wie mehr als 30.000 Elefanten starben, getötet durch falsche oder mangelnde Ernährung. Fast alle waren vorgeschädigt durch stressbedingten Herzinfarkt. Die zunehmende Bevölkerung und die technische Entwicklung Afrikas hatte den Elefanten den Lebensraum genommen. Auf kleinstem Raum zusammengedrängt droht ihnen nun die Ausrottung durch Stress und Mangel an Ressourcen. Für Beard ist der Elefant gleichsam das Wappentier einer perversen Entwicklung.
Fotos von sterbenden Elefanten machten aus Beard einen berühmten und gefragten Bildermacher. Er fotografierte Titelseiten und Modestrecken und erschien auch selbst auf Bildern, fotografiert etwa von Andy Warhol. Wo Peter Beard auftaucht, schrieb einmal ein Journalist, sprießen die schönen Mädchen aus dem Boden wie Pilze nach einem warmen Regen. 2009 fotografierte er den legendären Pirelli-Kalender, die Kulisse natürlich Afrika, das Thema schöne Frauen, wilde Tiere und schlanke Mädchen, eine unschlagbare Kombination für jeden Fotografen. Beard war in der kommerziellen Fotografie ganz oben angekommen.
Beards Kunst aber sind seine Collagen und seine Tagebücher. Großformatige Fotos, zum Beispiel von einem Elefanten in einer dramatischen Geste, oder auch aus der Vogelperspektive die Aufnahme von toten Tieren - und auf den Rändern des Bildes Texte namhafter Autoren - Leonardo da Vinci, der Maler Francis Bacon, immer wieder die Schriftstellerin Tanja Blixen. Diese Kombination ist ein Grundmuster, in dieser überschaubaren Form ist die Botschaft noch leicht zu verstehen:
"Ich liebe es, auf Fotos zu schreiben - Tertullian, Leonardo da Vinci - Leute, die nicht anders waren als wir, sie alle sagten dasselbe: Und wir tun das Gegenteil davon. Sie wussten, die einzige Kreatur, die all diese Schönheiten genießen kann, betritt die Bühne und zerstört mit tödlicher Sicherheit genau das, was nur sie allein wertschätzen kann."
Beard ist jedoch ein manischer Schreiber, Notierer, Aufzeichner, Inventarist und so treibt er die Collage als Genre radikal bis an ihre Grenzen. Und darüber hinaus. Eine Tagebuchdoppelseite von 1978 zeigt eine Aufnahme von Beard, sitzend in Poloshirt und gestreifter Hose mit kahlgeschorenen Kopf. Er ist aus einem kenianischen Gefängnis entlassen worden nach der Anklage, einen Wilddieb auf seiner Farm misshandelt zu haben. Darüber eine weitere Schwarz-Weiß-Aufnahme, kleiner: ein wenig unscharf Tiere, vielleicht Warzenschweine, dahinter scharf fokussiert zwei Giraffen vor einer dichten Wand aus Büschen und Bäumen - Afrika.
Darüber zwei Aufnahmen, noch kleiner - Beard fotografiert ein afrikanisches Model. Federn sind eingeklebt, das Label einer kenianischen Biersorte, ein Witzfoto von einem Warzenschwein mit einer Denkblase über dem Kopf, das Schwein träumt von einem Apfel.
"Ich mag Dinge, die man nicht kontrollieren kann. ...Ich mag Puzzle: Man fügt Dinge zusammen, die das Leben bereichert haben, an die man sich erinnern möchte. Eine Zigarettenpackung, ein Gedicht, es gibt so vieles, was man fotografieren kann, die Gefühle, die Unfälle. Ich habe das immer für Magie gehalten. Fotos können magisch sein, wenn bei der Aufnahme etwas aus dem Ruder gelaufen ist."
Über den bild-freien Raum ergießt sich das Tagebuch vom 26. August bis 3. September: Eine Schwemme von Handschriften in unterschiedlichen Typografien, Größen, Farben. Man braucht eine Lupe, um die Zeilen lesen zu können, die Aufzeichnungen sind gedrängt, gequetscht, zusammengestaucht, um auch noch den letzten Raum, den die Fotos und anderen Gegenstände übrig gelassen haben, auszufüllen.
Was steht zwischen den Bildern? Am Sonntag, den 27. August kamen eine Betty Archer und ein Harry mit einer Botschaft von einer Person namens Lusa - man kann es nicht entziffern. Dann:
"Aufgestanden an einem nebeligen Morgen. Um das Studio herum war es klar. Frühstück mit FitzJohn. Eier und Schinken. Fenster sauber, Auto sauber..."
... und so geht es weiter. Banale Momente, die in der Summe genommen einen Tag konstruieren. Rätselhafte Texte, verknappt bis zur Unverständlichkeit. Banale Buchstaben in schwarz und rot, dazwischen hinzustrichelte Grafiken, so als sei nicht der Inhalt des Geschriebenen wichtig, sondern nur der bildhafte Eindruck in der Komposition. Beard hat in seiner Kunst die Schrift immer extremer auf ihre grafisches Grundgerüst reduziert und den Bildern angeglichen, wohl kaum einer ist dabei so entschieden vorgegangen wie er.
Peter Beards Bilder werden entweder in kiloschweren Bänden publiziert - man könnte sie neben die großformatigen Typoskripte von Arno Schmidt auf ein sehr stabiles Regal wuchten - oder in Ausstellungen präsentiert in nahezu wandfüllenden Formaten. Seine Collagen zeigen eine Welt, die in winzig kleine Partikel zerschreddert wurde, um nun in einem sehr ich-dominierten Schöpfer-Akt neu zusammengesetzt zu werden.
Die Partikel aus Bild und Text gruppieren sich um zwei zentrale Bild-Motive, die die Herzensthemen des Künstlers sind: Elefanten gleich Natur und Models gleich Schönheit.
Im Regelfall dominieren die Fotos das Zentrum und den Rahmen des Bildes. Sie sind Dokumentation, Abbildungen einer oft gefährdet erscheinenden Wirklichkeit, aber auch pièce de resistance, der Gegenpol zu den Bildern des Untergangs: die wilde, dynamische Schönheit einer angreifenden Elefantenkuh oder der selbstbewusste Körperstolz eines schwarzen Models.
Eine zerfallende Welt in einer bittersüßen Stimmung neu zusammengesetzt, so hat Beard mit den Elementen Schrift und Bild die Möglichkeiten einer Seite, eines Bildes so weit ausgeschöpft, dass ein Darüber-hinaus nicht mehr möglich erscheint. Im Film hockt Beard mit Schere und Klebstoff und daumengroßen Ausschnitten vor einer Collage von sicherlich zwei mal zwei Metern.
Beard: "Das ist wie eine Metapher: Mir ist auf der Pappe der Platz ausgegangen. Und jetzt quillt alles über den Rand. Genauso sind wir: Wir treiben alles über den Rand. Es ist unser Klimawandel, es sind unsere Emissionen, es ist unser Problem. Und unsere Selbst-Entschuldigungen sind große Scheiße."
Die kleine Lücke zwischen Bild und Text
"Ein Bild ist, dass Warhol ein Polaroid von dir schießt. Vielleicht bist du berühmt, vielleicht bist du nicht berühmt, aber dann doch, denn der Warhol, der berühmt ist, hat dich mit seiner Polaroid geknipst, das Bild weiß das eine wie das andere."
(Zsófia Bán, Als nur die Tiere lebten, Aus dem Ungarischen von Terézia Mora, Suhrkamp Verlag)
In einem sehr preiswerten Hotel in der Berliner Innenstadt, wo das Personal den authentischen knackigen Berliner Grundton pflegt, sitzt zierlich in einer Sofaeck Zsofia Bán.
Bán ist in Rio de Janeiro geboren, in Brasilien und Ungarn aufgewachsen und lebt in Budapest. Sie ist Wissenschaftlerin und Künstlerin. Ihre Kurzgeschichten, die wie Erzählungen, Essays oder Denksportaufgaben erscheinen, erscheinen leicht, sind aber herausfordernder Mehrschichtigkeit. Zum Beispiel die "Kurze Geschichte der Fotografie":
"Ein Bild ist, dass der Mann im Mond heruntergekommen ist und man nun eine Menge Sachen machen muss, über die man immer gesagt hat, das geschieht erst, wenn der Mann im Mond herunterkommt. Man muss aufpassen, was man sagt."
(Zsófia Bán, Als nur die Tiere lebten, Aus dem Ungarischen von Terézia Mora, Suhrkamp Verlag)
Bild und Sprache - beide Elemente werden in ihren Texten verwandt, die Bilder als abgedruckte Fotos oder auch transformiert in Sprache, um über das schreiben zu können, was hinter den Bildern steckt.
Bán: "Ich bin überzeugt davon, dass sie in einer idealen Situation einander ergänzen bis auf die Lücke, die es gibt zwischen dem, was ein Bild beschreiben kann und dem, was ein Text beschreiben kann. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Sie kommen nicht immer zusammen, ihre Finger berühren einander nicht wie auf Michelangelos berühmten Fresko. Da gibt es immer eine kleine Lücke zwischen ihnen und was mich interessiert, ist, was uns diese Lücke sagt oder was sie bedeutet. Was kann das sein, was man nie berühren kann, weder durch ein Bild noch durch einen Text? Das ist für mich der aufregende Punkt."
Man könnte das Bild aus Michelangelos Fresko weiter bearbeiten: Nicht nur, dass die Finger einander nicht berühren, gelegentlich beginnen sie auch ein Fingerhakeln, bei dem sie ihre Kräfte messen: Bild oder Wort, wer kann sich durchsetzen. Man kann diese Frage an verschiedenen Autoren diskutieren: W.G. Sebald zum Beispiel.
Bán: "Sebald zum Beispiel, der meiner Meinung nach in vielerlei Hinsicht sehr dicht an Péter Nádas ist, er nutzt Bilder in seinen Texten, aber nicht um die Aussage des Textes zu illustrieren, sondern um auf eine sehr interessante Art die Aussage des Textes zu destabilisieren, und ebenso umgekehrt, um die Aussage des Bildes zu destabilisieren - er ist ein sehr vertrackter Autor, indem er das Vertrauen des Lesers in die Wahrheit des Bildes nimmt und damit Spiele spielt."
Ein Bild ist, dass jemand ein ganzes Buch über Bilder schriebt, aber in Wahrheit schreibt er es über seine Mutter, über ein kleines Bild, das es von seiner Mutter gibt, als sie noch ein Mädchen war, dieses Bild ist aber im Buch nicht zu sehen, denn der Leser würde sowieso nicht das im Bild sehen, was er, der Jung, der Sohn der Mutter, darauf sieht, davon handel das Buch. Auch das ist ein Bild.
(Zsófia Bán, Als nur die Tiere lebten, Aus dem Ungarischen von Terézia Mora, Suhrkamp Verlag)
Bild und Wort stehen gleichberechtigt nebeneinander wie auf einer Internet-Seite, wo der Leser ebenfalls vom Text zum Bild und weiter zu einem Video springt, das mit dem Text verlinkt ist. Was zunächst als Textpaket erscheint, ist ein Wirklichkeit ein Warenlager unterschiedlichsten Medien und Informationen. Dies ist der technische Alltag und er wird, meint Zsofia Bán, die Lesegewohnheiten der Zukunft prägen:
"Ich bin mir sicher, das wird sehr bald geschehen. Die Menschen gewöhnen sich mehr und mehr daran, Hypertexts, Texte in assoziativer Anordnung oder Literatur auf digitalen Trägern zu lesen. Und das eröffnet eine unglaubliche Fülle an Möglichkeiten, bei denen man sich mit allem verbinden kann, was man möchte. Ich bin sicher, das wird so kommen und es ist eine unglaubliche Chance für die Literatur.
Ein Bild ist, dass hier der Hund begraben liegt."
(Zsófia Bán, Als nur die Tiere lebten, Aus dem Ungarischen von Terézia Mora, Suhrkamp Verlag)
Und damit steht Zsofia Bán auf und verlässt das Hotel mit dem ruppigen Personal.
Liberale Plattform für beide Künste
STILL ist der Name einer neuen Zeitschrift. 800 nummerierte Exemplare hat die zweite Ausgabe, im Untertitel nennt es sich "Magazin für junge Literatur & Fotografie". Die Gründungsidee der beiden Herausgeber beschreibt Nike Marquardt:
"Wir würden einfach gern ein neues Produkt schaffen, das beide Kunstformen - na ja keine Brücken schlägt, weil es eben zu gewollt wäre, sondern beide neben einander präsentiert, etwas auf die Beine zu stellen, was es in der Form noch nicht gab und was und sehr viel Spaß macht, weil wir persönlich interessiert daran sind."
In der kleinen Wohnung im Berliner Stadtteil Wedding entsteht die Zeitschrift zum geringsten Teil. Die Macher, also die Herausgeber und die noch im Wachsen begriffene Redaktion, verteilen sich auf New York, Berlin, Köln und weitere Städte, die wichtigsten Redaktionsinstrumente sind der Computer und das Internet. Zu Philosophie der Zeitschrift gehört, dass sie eine liberale Plattform sein will für Literatur und Fotografie, ohne dass die beiden Künste etwa durch ein Oberthema aufeinander bezogen werden.
Marquard: "Eine direkte Verbindung vermeiden wir bewusst... und haben dementsprechend auch kein Thema übergeordnet, dass es verbinden würde, aber der Zugang ist der, dass wir einfach in diesen Bereichen vernetzt sind und in der Szene bewandert sind und viele Autoren und viele Fotografen kennen - unser Zugang vielleicht auch der, dass Fotografie eine sehr zeitgenössische Kunstform ist und diese Pop-Kultur innerhalb der Kunst, das ist das reizvolle an diesen beiden Kunstformen, ja."
Der persönliche Enthusiasmus und die Leidenschaft der Macher agieren vor einem großen Horizont, die Zeitschrift sucht die Kunst global:
"Wir starten öffentlich weltweite Einsendeaufrufe, es kommen auch immer mehr, von New York bis Georgien haben wir aus aller Welt Einsendungen, vor allem im Fotobereich, dann wird das alles gesichtet, das ist ziemlich viel Arbeit im Vorfeld..."
... und wird danach nicht weniger, wenn die endgültige Auswahl auf Gedichten, Erzählungen, Theatertexten und Fotografien aus unterschiedlichen Genres zusammengestellt werden. Die Macherinnen und Macher sind um die 30 Jahre als und eigentlich wäre es diese Generation, die ausschließlich digital kommunizieren müsste - glaubt man den medialen Zukunftsforschern. Aber Nike Marquard und ihre Kollegen sehen das anders, sie drucken auf Papier:
Vielleicht kommt demnächst auch noch eine parallele Online-Version, müssen wir mal gucken, aber wir wollen auf jeden Fall nicht abgehen vom Druck, weil es schon noch mal was anderes ist, ob man was in der Hand hält, wirklich haptisch fühlt oder ob man es nur auf dem Bildschirm sieht, es gewinnt dadurch einfach mehr Wertigkeit und von daher werden wir nach wie vor den Anspruch haben, zumindest auch im Print zu erscheinen, auch wenn es manchmal finanziell ein bisschen schwierig ist.
Mit anderen Worten: Es fehlen Sponsoren. Wenn also jemand zuhört, der Geld übrig hat: Das Magazin heißt: STILL.
Steinaecker: "Ich hab dann tatsächlich selber vier Romane gebraucht, bis ich mich dann an der Thema gewagt habe ..."
Thomas von Steinaecker, Schriftsteller, hatte sich ausführlich mit dem Zusammenspiel von Literatur und Fotografie gefasst, bevor er sich künstlerisch an diese Kombination heranwagte:
"... die Vorbilder waren in gewisser Weise einfach auch furchteinflößend oder ehrfurchtgebietend, bis ich mir sagen konnte, dass ich mir da selber ein eigenes Foto-Konzept entwickelt habe und es fortspinnen kann."
"Das Jahr, in dem ich aufhörte mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen" heißt der Roman von 2012. Die Versicherungsvermittlerin Renate Meißner wird von Frankfurt nach München versetzt, nachdem ihre Affäre mit ihrem Vorgesetzten in Frankfurt schief gelaufen ist. Die Geschichte, die sie erzählt, setzt am 1.Oktober 2008 ein, in dem Jahr, als die Bankenkrise alle Sicherheiten wegwischte.
Von Steinaecker erzählt in einer Mischung von Text und Fotografie, mit Fotos, die gelegentlich als einzelne Bilder in den Text einmontiert sind oder auch als längere Bildstrecken ganze Seiten in Anspruch nehmen:
"Das Schwierige aus der Sicht des Schriftstellers ist ja, dass es wahnsinnig schnell beliebig wirkt... wann und wo ich die Fotos einfüge, und da ein stringentes, zwingendes Konzept zu finden, dass ich sage, an dieser Stelle kommt jetzt das Foto und nicht eine Seite später und warum wird dieses Motiv wiedergegeben auf dem Foto und warum nicht das andere, ja? Und da ein Konzept zu finden, das war unglaublich schwierig."
Erstaunlich war die Resonanz, die der Roman auslöste - die professionelle Kritik hat über weite Strecken so reagiert, als gäbe es die Bilder im Text gar nicht. Es gäbe es nur eine Buchstaben-Erzählung. Die Bild-Text-Kombination war wohl doch zu überraschend - wenngleich aus der Biografie des Autors, aus dem Thema seiner Dissertation, erklärbar:
"Aber zum Beispiel mein Roman beginnt nicht mit Text, sondern mit einem Foto, das ist ein Nachtbild und man sieht so hell erleuchtete Vierecke. Wenn man da näher hinschaut, sind es hell erleuchtete Fenster von einem Büro. Da wird sozusagen ein geometrisches Muster gelegt, es ist ganz offensichtlich Nacht."
"Draußen herrschte eine von den Straßenlaternen und den Lichtern in den umliegenden Gebäuden ungesund orange eingefärbte Dämmerung, durch die Flocken wirbelten. Auf der anderen Seite des Mittleren Rings bemerkte ich eine Trauergemeinde. Doch dann steuerten die vermeintlich Trauernden nicht auf die Kapelle zu, sondern auf das Business-Tower-Areal einige Straßen weiter. Sie waren auf dem Weg zur Arbeit wie ich."
(Thomas von Steinaecker, Das Jahr, in dem ich aufhörte mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen, S.Fischer)
Die Versicherungsvermittlerin durchlebt eine lange Phase voller beruflicher und persönlicher Unsicherheit, die sie mit großem, gelegentlich unfreiwilligen Witz schildert, und findet sich am Ende in Samarkand in einer Pension wieder, wo sie beginnt, die Geschichte zu schreiben, von der der Leser eben die letzten Zeilen liest.
Steinaecker: "Das Buch endet mit einem Bild von Schnee, also einem weißen Bild, ein weißes Quadrat, so dass die Entwicklung von Fotos vom ersten bis zum letzen Foto ist eine Reise der Nacht in den Tag und den ganzen Assoziationen, die damit zusammen hängen."
"Unter mir, vor meinem Fenster, erstreckt sich ein zugeschneites Feld. Ich glaube, ich werde jetzt erst einmal für heute den Stift beiseitelegen, mich warm einmummeln, wie meine Mutter das immer nannte, die Treppe hinuntersteigen und über die Straße gehen, in den Wad hinein. Schon in ein paar Minuten werde ich Schritt für Schritt meine Spuren auf dem Feld hinterlassen haben. Ja, dort kann man mit geschlossenen Augen sitzen - und glauben, der Frühling stehe vor der Tür."
Thomas von Steinaecker, Das Jahr, in dem ich aufhörte mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen, S.Fischer
Steinaecker: "Auf der Fotoebene wird eine Metaebene zum Text aufgespannt, die sich aber natürlich nur erschließt, wenn man die beiden Fotos so dekodiert, wie ich es gerade getan habe, was aber für viele Leser - glaub ich - eine Schwierigkeit darstellt, weil die erst mal darauf achten, warum wird jetzt dieses Büro bebildert, was dann eine Seite später so geschildert wird und warum ist am Schluss ein Bild von Schnee, also die bringen gar nicht die erste mit der letzten Seite in Verbindung."
Vielleicht ist es doch noch eine Spezialkompetenz, Bild und Text zusammen zu bringen...
Steinaecker: "Die Reaktionen auf den Roman haben mit immer wieder gezeigt, es gibt komischerweise immer wieder Leute, die scheinen ein Verhältnis zur Fotografie und auch kein Problem zu haben, wenn das in Romanen auftaucht, aber merkwürdigerweise die Mehrheit der Leute, der Leser, ist noch immer irritiert, wenn im Roman Fotos auftauchen, was ja irgendwie im 21. Jahrhundert seltsam ist, weil wir in einer Bilderwelt leben."
Eine ganze Generation der heute Mitte-20 bis Mitte-30-Jährigen ist aufgewachsen mit dem anwachsenden Springflut von Bildern: In Zeitschriften, Fernsehprogrammen, Internetportalen, in Comics, Mangas, Grafic Novels und Bildergeschichten, in der Street-Art und Wandmalereien - wo immer man hinschaut, man sieht gestaltete Bilder. Online-Zeitungen bieten viel längere Fotostrecken als die gedruckten Ausgaben. Die Fusion von Text und Bild ist alltäglich geworden, im Journalismus sowieso, aber auch zunehmend in der Kunst.
Steinaecker: "Ich sag das jetzt überspitzt aber, für mich beinhaltet das Medium Buch theoretisch letztlich alle Medien und ist nicht auf Buchstaben und Text beschränkt."
Fotos, kleine Videos, Musik auf SD-Cards oder auf Barcodes, integriert in ein Buch - exotische Erweiterungen von heute werden in kurzer Zeit schon Standard werden, warum soll es eine Begrenzung geben? Die Autoren sind Talente nicht nur in einem Metier, warum also sich beschränken, wo doch der Leser auch ein Talent ist nicht nur in einem Metier!
Die Grundfrage wird lauten: Was gewinnt die Literatur durch die Multimedialität der künftigen Erzählung? Werden diese Erzählungen spannender, sinnenfreudiger, erkenntnisreicher? Unterhalten sie uns besser, machen sie uns schlauer? Macht uns das Schlendern von einem Medium in ein anderes in ein und derselben Erzählung geistig beweglicher? Schärft es unsere Wahrnehmung?