Von besonderen Menschen
Eine besondere Vorliebe für menschliche Verschiedenartigkeit hat der Neurologe Oliver Sacks. Sein Buch "Der einarmige Pianist" erzählt von Kranken, die auf besondere Weise auf Musik ansprechen. Sacks zollt seinen Patienten Respekt und offenbart eine Haltung, die in einer Zeit zunehmenden Perfektions- und Uniformitätsdrucks ihresgleichen sucht.
Musik sagt nichts, funktioniert nicht in Begriffen und man braucht sie nicht zum Leben. Sie ist nichts weiter als klingende Luft.
Trotzdem sprechen die meisten Menschen auf Musik an. Auf besondere Weise kranke Menschen, wie Oliver Sacks es in seinem neuen Buch "Der einarmige Pianist" beschreibt. Wobei wir uns vorstellen müssen, dass der amerikanische Neurologe an dieser Stelle sanft, aber bestimmt protestieren würde.
"Krank" ist für ihn ein viel zu negativ behafteter Begriff, noch dazu mit eingeschränkter Aussagekraft. Denn der Status krank ist nur eine Seite der Medaille. Neben dem Defekt existiert auch fast immer ein Gewinn, zumindest die Chance auf einen Gewinn.
Oliver Sacks: "Ich mag immer weniger Begriffe wie normal, unnormal, Standard, abweichend. Die Schönheit der Chemie ist die Beständigkeit. Ein Metall ist immer gleich. Jedes Atom ist dasselbe. Die Schönheit der Biologie ist das Gegenteil: ihre Vielfalt, ihre Veränderungen. Mit dem Dichter Walt Whitman sage ich - aber als Neurologe - ich feiere die Vielfalt. Farbblindheit oder Taubheit ist nicht nur Krankheit oder Beeinträchtigung, sondern sie können auch die Möglichkeit für ein anderes Leben eröffnen."
Auch in seinem neuen Buch über Musik und Gehirn "Der einarmige Pianist" schreibt der 75-Jährige, der gerade eine Professur an der Columbia University angenommen hat, über Menschen, die sich an jeden Klang aus über 1000 Opern erinnern, aber mit einem IQ von 60 kaum selbständig leben können; Menschen, die sich zu Musikbesessenen wandeln, nachdem ihr Gehirn vom Blitz getroffen wurde; Menschen, die von innerlich tönenden Symphonien gepeinigt werden. Er schreibt über Anfallsleidende, Tourette-Patienten, Blinde, Amusische, Alzheimer- und Demenzkranke.
Und über den einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein, Spross einer wohlhabenden Wiener Familie. Da er im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren hatte, seine Pianisten-Karriere aber nicht aufgeben wollte, ließ er sich von berühmten Komponisten Stücke für die linke Hand schreiben. Hier spielt der ebenfalls einarmige Pianist Leon Fleisher Auszüge aus Ravels berühmtem Konzert in D-dur für die linke Hand.
Sacks’ Fallgeschichten wirken meist amerikanisch leicht, undramatisch, geschrieben mit einer Haltung des freudigen Erstaunens über menschliche Vielfalt. Aber der Autor hat durchaus auch registriert, dass die Gesellschaft seine Vorliebe für menschliche Verschiedenartigkeit nicht unbedingt teilt:
"Ja, es sieht aus, als würde die Pädagogik heute einen anderen Weg gehen; als hätten die Pädagogen heute einen mechanischen Menschenbegriff: Immer soll der Beste seiner Art ermittelt werden. Weise Lehrer waren sich immer der großen Unterschiede zwischen den Menschen bewusst und dass ein Schüler die Chance erhalten muss, sich autonom zu entwickeln, eine Chance, seinen eigenen Weg zu gehen.
Ich glaube, die Gefahr besteht tatsächlich, dass die Menschen versuchen, sich mittels chemischer oder genetischer Manipulation zu standardisieren. Das wäre dann die Alptraumvision der schönen neuen Welt. Ich glaube, wir sollten uns der verführerischen Gefahr dessen bewusst sein."
Für viele Patienten des Neurologen Oliver Sacks ist Musik der einzige Kanal, über den sie mit anderen kommunizieren können. Für einige ist Musik die Rettung; für andere die Brücke zurück ins Leben, das sie vorher geführt haben.
Mit seinem Buch "Der einarmige Pianist" hat Oliver Sacks auch ein Buch über seine große Liebe, die Musik, geschrieben. In seiner New Yorker Praxis steht ein Flügel und er schreibt im Buch, dass er immerhin die Mazurken von Chopin ganz passabel spielen könne. Aber Musik ist nur eine private Leidenschaft. Sein Beruf ist ein anderer:
"Ich fühle mich genauso als Schriftsteller wie als Arzt, Ich sehe weiterhin meine Patienten. Und ich mag das sehr. Ich bin auch nicht, wie einige fälschlich annehmen, auf exotische Krankheiten spezialisiert. Leute mit Kopfschmerzen konsultieren mich genauso wie solche mit eingeklemmten Nerven. Mein Hauptberuf ist Arzt. Und ich hoffe, ich bin ein guter Nerven-Fachmann. Aber meine Patienten sind in gewisser Weise auch mein Material, um es mal ganz grob zu sagen. Material, dass ich mich aber bemühe, ausreichend zu würdigen, wenn ich darüber später schreibe.
Aber ich benutze auch anderes Material, meine Tagebücher - ich schreibe gerne über Ereignisse, über Orte, über Menschen, über Chemie und Botanik. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage wäre, einen Roman, ein Stück oder ein Gedicht zu schreiben. Ich bin eine Art Essayist und Geschichtenerzähler. Aber meine Texte handeln von wirklichen Geschichten. Ich liebe es zu schreiben. Und ich fühle mich nicht richtig lebendig, nicht richtig ich selbst, wenn ich keinen Stift in der Hand habe."
Wie Sacks großer Erfolg "Awakenings", einer später verfilmten Geschichte über die Opfer der Schlafkrankheit oder der Titel "Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte", gesammelte Fallgeschichten über Menschen, die mit einem Mal aus der Normalität fielen, ist auch "Der einarmige Pianist" ein Buch, dessen größter Verdienst die Rehabilitation des unperfekten, des fehlerhaften Menschen ist.
Oliver Sacks zollt seinen besonderen Patienten Respekt. Er will sie nicht anpassen. Er will höchstens ihr Los erleichtern. Diese Haltung sucht in einer Zeit zunehmenden Perfektions- und damit Uniformitätsdrucks ihresgleichen.
Oliver Sacks: Der einarmige Pianist - Über Musik und das Gehirn
Rowohlt Verlag. Reinbeck
Trotzdem sprechen die meisten Menschen auf Musik an. Auf besondere Weise kranke Menschen, wie Oliver Sacks es in seinem neuen Buch "Der einarmige Pianist" beschreibt. Wobei wir uns vorstellen müssen, dass der amerikanische Neurologe an dieser Stelle sanft, aber bestimmt protestieren würde.
"Krank" ist für ihn ein viel zu negativ behafteter Begriff, noch dazu mit eingeschränkter Aussagekraft. Denn der Status krank ist nur eine Seite der Medaille. Neben dem Defekt existiert auch fast immer ein Gewinn, zumindest die Chance auf einen Gewinn.
Oliver Sacks: "Ich mag immer weniger Begriffe wie normal, unnormal, Standard, abweichend. Die Schönheit der Chemie ist die Beständigkeit. Ein Metall ist immer gleich. Jedes Atom ist dasselbe. Die Schönheit der Biologie ist das Gegenteil: ihre Vielfalt, ihre Veränderungen. Mit dem Dichter Walt Whitman sage ich - aber als Neurologe - ich feiere die Vielfalt. Farbblindheit oder Taubheit ist nicht nur Krankheit oder Beeinträchtigung, sondern sie können auch die Möglichkeit für ein anderes Leben eröffnen."
Auch in seinem neuen Buch über Musik und Gehirn "Der einarmige Pianist" schreibt der 75-Jährige, der gerade eine Professur an der Columbia University angenommen hat, über Menschen, die sich an jeden Klang aus über 1000 Opern erinnern, aber mit einem IQ von 60 kaum selbständig leben können; Menschen, die sich zu Musikbesessenen wandeln, nachdem ihr Gehirn vom Blitz getroffen wurde; Menschen, die von innerlich tönenden Symphonien gepeinigt werden. Er schreibt über Anfallsleidende, Tourette-Patienten, Blinde, Amusische, Alzheimer- und Demenzkranke.
Und über den einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein, Spross einer wohlhabenden Wiener Familie. Da er im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren hatte, seine Pianisten-Karriere aber nicht aufgeben wollte, ließ er sich von berühmten Komponisten Stücke für die linke Hand schreiben. Hier spielt der ebenfalls einarmige Pianist Leon Fleisher Auszüge aus Ravels berühmtem Konzert in D-dur für die linke Hand.
Sacks’ Fallgeschichten wirken meist amerikanisch leicht, undramatisch, geschrieben mit einer Haltung des freudigen Erstaunens über menschliche Vielfalt. Aber der Autor hat durchaus auch registriert, dass die Gesellschaft seine Vorliebe für menschliche Verschiedenartigkeit nicht unbedingt teilt:
"Ja, es sieht aus, als würde die Pädagogik heute einen anderen Weg gehen; als hätten die Pädagogen heute einen mechanischen Menschenbegriff: Immer soll der Beste seiner Art ermittelt werden. Weise Lehrer waren sich immer der großen Unterschiede zwischen den Menschen bewusst und dass ein Schüler die Chance erhalten muss, sich autonom zu entwickeln, eine Chance, seinen eigenen Weg zu gehen.
Ich glaube, die Gefahr besteht tatsächlich, dass die Menschen versuchen, sich mittels chemischer oder genetischer Manipulation zu standardisieren. Das wäre dann die Alptraumvision der schönen neuen Welt. Ich glaube, wir sollten uns der verführerischen Gefahr dessen bewusst sein."
Für viele Patienten des Neurologen Oliver Sacks ist Musik der einzige Kanal, über den sie mit anderen kommunizieren können. Für einige ist Musik die Rettung; für andere die Brücke zurück ins Leben, das sie vorher geführt haben.
Mit seinem Buch "Der einarmige Pianist" hat Oliver Sacks auch ein Buch über seine große Liebe, die Musik, geschrieben. In seiner New Yorker Praxis steht ein Flügel und er schreibt im Buch, dass er immerhin die Mazurken von Chopin ganz passabel spielen könne. Aber Musik ist nur eine private Leidenschaft. Sein Beruf ist ein anderer:
"Ich fühle mich genauso als Schriftsteller wie als Arzt, Ich sehe weiterhin meine Patienten. Und ich mag das sehr. Ich bin auch nicht, wie einige fälschlich annehmen, auf exotische Krankheiten spezialisiert. Leute mit Kopfschmerzen konsultieren mich genauso wie solche mit eingeklemmten Nerven. Mein Hauptberuf ist Arzt. Und ich hoffe, ich bin ein guter Nerven-Fachmann. Aber meine Patienten sind in gewisser Weise auch mein Material, um es mal ganz grob zu sagen. Material, dass ich mich aber bemühe, ausreichend zu würdigen, wenn ich darüber später schreibe.
Aber ich benutze auch anderes Material, meine Tagebücher - ich schreibe gerne über Ereignisse, über Orte, über Menschen, über Chemie und Botanik. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage wäre, einen Roman, ein Stück oder ein Gedicht zu schreiben. Ich bin eine Art Essayist und Geschichtenerzähler. Aber meine Texte handeln von wirklichen Geschichten. Ich liebe es zu schreiben. Und ich fühle mich nicht richtig lebendig, nicht richtig ich selbst, wenn ich keinen Stift in der Hand habe."
Wie Sacks großer Erfolg "Awakenings", einer später verfilmten Geschichte über die Opfer der Schlafkrankheit oder der Titel "Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte", gesammelte Fallgeschichten über Menschen, die mit einem Mal aus der Normalität fielen, ist auch "Der einarmige Pianist" ein Buch, dessen größter Verdienst die Rehabilitation des unperfekten, des fehlerhaften Menschen ist.
Oliver Sacks zollt seinen besonderen Patienten Respekt. Er will sie nicht anpassen. Er will höchstens ihr Los erleichtern. Diese Haltung sucht in einer Zeit zunehmenden Perfektions- und damit Uniformitätsdrucks ihresgleichen.
Oliver Sacks: Der einarmige Pianist - Über Musik und das Gehirn
Rowohlt Verlag. Reinbeck
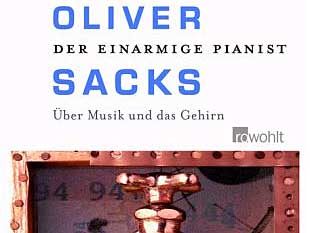
Oliver Sachs: Der einarmige Pianist - Über Musik und das Gehirn© Rowohlt Verlag
