Verschüttete Bildungsideale
Was liegt näher, als in einer Zeit wie der unseren, in der alle von Bildung und Bildungsproblemen reden, an die Aufklärung zu erinnern? An eine Epoche also, für die Bildung alles war. Der Erziehungshistoriker Jürgen Overhoff, der an der Universität Hamburg lehrt, tut es in diesem Buch.
Dessen Titel "Vom Glück, lernen zu dürfen", vor allem aber der Untertitel "Für eine zweckfreie Bildung" klingt ein wenig, als müsse der Leser mit einem jener Manifeste rechnen, wie sie derzeit zu Dutzenden erscheinen, in denen ein ganz neues Bildungsverständnis gefordert wird, und dass ein Ruck durch die deutschen Schulen gehen müsse. Aber zum Glück enthalten die gut 250 Seiten etwas ganz Anderes, nämlich historische Porträts von Aufklärern und ihren Gedanken zur Erziehung, aus denen so etwas wie ein Gesamtbild jenes pädagogischen Jahrhunderts entsteht.
"Wohl ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass in der uns bekannten Geschichte der Menschheit kaum eine Epoche so sehr von der Bedeutung des Lernens erfüllt war wie das Zeitalter der Aufklärung."
Und weil es zugleich das Zeitalter des aufstrebenden Wirtschaftsbürgertums war, passt die Erinnerung daran doppelt in eine Zeit wie die unsere, in der Bildung stets im Zusammenhang mit Wirtschaft gesehen wird: mit der Leistungsfähigkeit einer Bevölkerung, mit Wettbewerbsvorsprüngen durch Innovationen, mit der Ressource "Humankapital".
"Allerdings argumentierten die überzeugendsten und kompetentesten Verfechter eines gesteigerten gesellschaftlichen Lernwillens damals im Grunde völlig anders als die Mehrheit der heutigen Bildungspolitiker. Denn gerade den pädagogisch ambitioniertesten und einflussreichsten Aufklärern ging es zuerst und wesentlich darum, das Lernen als eine große Verheißung darzustellen."
Nicht also der Wohlstand war die Verheißung, die zu verwirklichen man Bildung einsetzen wollte. Sondern die Bildung war die Verheißung, von der man annahm, dass Wohlstand sie begünstigen würde.
Das beginnt schon mit dem Philosophen, Arzt und Ökonomen John Locke, der 1693 das vielleicht bedeutendste Buch vorlegte, das jemals über Erziehung geschrieben wurde, seine "Some thoughts concerning education" – Einige Gedanken die Erziehung betreffend. Denn Locke, der ein großer Verfechter von Freihandel und Geldwirtschaft war und der im Privateigentum die Grundlage aller Staatlichkeit sah, eben dieser Locke gibt auf die Frage, ob man Kinder auf die Wirtschaft hin erziehen solle, die Antwort: Nein, soll man nicht.
"… weder hält er es für erforderlich, Kinder vorzeitig für spezielle ökonomische Fragestellungen zu sensibilisieren, noch glaubt er, dass Eltern und Lehrer ihre Schützlinge unentwegt auf die Härten und Herausforderungen des späteren Berufslebens hinweisen sollen, wenn sie diese zu fleißigen und strebsamen Schülern erziehen wollen."
Was Locke entdeckt und was eine unverlierbare Errungenschaft des Nachdenkens über Schule sein sollte, ist: Die beste Motivation, sich aufs Lernen einzulassen, muss im Lernen selber, im Interesse an seinen Stoffen und in der Freude am Erkannthaben und Können bestehen.
Der Autor verfolgt dieses Thema durchs ganze 18. Jahrhundert. Er macht uns mit Lockes großem Popularisator, Joseph Addison, bekannt, einem Journalisten, für den die Zeitung ein Medium der Volkserziehung ist, weil die Leser durch sie die Freude am Beobachten lernen. Es folgen Kapitel über deutsche Gelehrte wie Reimarus, Bodmer und Gellert, die das englische Gedankengut auf dem Kontinent und vor allem: an den Universitäten verbreiten. Ihnen wie auch den beiden einflussreichsten Pädagogen jener Zeit, Benjamin Franklin und Jean Jacques Rousseau, ordnet Overhoff Fähigkeiten zu, die zu entwickeln die Absicht jener Pädagogen war: Einbildungskraft, Gemeinnützigkeit, Mitgefühl, Selbstdisziplin.
"Was der … Gang durch die Geschichte des 18. Jahrhunderts … aufgedeckt hat, ist die unübersehbare Tatsache, dass das aufklärerische Bestreben, Lernen als Glück erfahrbar zu machen, von Anfang an unauflöslich mit dem Kampf um die Verwirklichung einer freiheitlichen, menschenfreundlichen und demokratischen Bürgergesellschaft verknüpft war."
Dass die Erziehung zum Mitgefühl und die zur Selbstdisziplin, die Erziehung zur Wissbegierde und zum Gottvertrauen dabei nicht immer am selben Strang ziehen, und dass Benjamin Franklin nicht nur ein Apologet des Altruismus war, sondern auch ein ziemlicher Filou, das gerät ein bisschen in den Hintergrund. Overhoff stilisiert die Gedankenwelt des 18. Jahrhunderts stark, um sie als einheitlich darzustellen. Und er scheut sich, weil er diese Epoche mag, die Kosten ihrer Pädagogik zu erwähnen. Rousseaus "Emile" ist aber nicht nur ein Bildungsroman. Es ist leider auch ein Buch, das die These vertritt, die beste Erziehung müsse abseits der Gesellschaft erfolgen, durch Isolation der zu Erziehenden in einer Art reformpädagogischer Kontroll-Idylle.
Hier liegen auch Grenzen der Sympathie mit Ideen des 18. Jahrhunderts. Dass Overhoff sich nur für ihre erfreulichen und wegweisenden Aspekte interessiert ist aber legitim. Denn obwohl er ein erzählendes Buch geschrieben hat, geht es ihm nicht um historische Vollständigkeit oder um analytische Durchdringung der Werke von Rousseau, Kant oder Moses Mendelssohn. Worum es ihm geht, ist vielmehr der Hinweis auf eine Tradition, deren beste Argumente die meisten, die den gegenwärtigen Bildungsdiskurs prägen, als undurchdacht, längst überholt und insofern ungebildet dastehen lassen.
"Was heute von Bildungspolitikern, aber auch von Lehrern und Eltern immer häufiger betont wird, ist leider nicht das Glück, lernen zu dürfen, sondern die Pflicht, lernen zu müssen, um dem eigenen Land oder sich selbst unter allen Umständen einen Standortvorurteil oder Karrierevorsprung in der globalisierten Welt zu verschaffen."
Man kann es auch so formulieren: Overhoff erinnert an eine Tradition, für die Erziehung noch mit Freiheit zusammenhing, darum aber auch mit Anstrengung und Ausdauer. Das zeigt, dass man kein Anhänger einer reformpädagogischen Kritik des Leistungsprinzips in den Schulen sein muss, um die heutige Einstellung zu Bildungsfragen abzulehnen. Locke und Kant hätten sich darüber gewundert, was heute als Pädagogik angeboten wird.
Jürgen Overhoff: Vom Glück, lernen zu dürfen. Für eine zweckfreie Bildung
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2009
"Wohl ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass in der uns bekannten Geschichte der Menschheit kaum eine Epoche so sehr von der Bedeutung des Lernens erfüllt war wie das Zeitalter der Aufklärung."
Und weil es zugleich das Zeitalter des aufstrebenden Wirtschaftsbürgertums war, passt die Erinnerung daran doppelt in eine Zeit wie die unsere, in der Bildung stets im Zusammenhang mit Wirtschaft gesehen wird: mit der Leistungsfähigkeit einer Bevölkerung, mit Wettbewerbsvorsprüngen durch Innovationen, mit der Ressource "Humankapital".
"Allerdings argumentierten die überzeugendsten und kompetentesten Verfechter eines gesteigerten gesellschaftlichen Lernwillens damals im Grunde völlig anders als die Mehrheit der heutigen Bildungspolitiker. Denn gerade den pädagogisch ambitioniertesten und einflussreichsten Aufklärern ging es zuerst und wesentlich darum, das Lernen als eine große Verheißung darzustellen."
Nicht also der Wohlstand war die Verheißung, die zu verwirklichen man Bildung einsetzen wollte. Sondern die Bildung war die Verheißung, von der man annahm, dass Wohlstand sie begünstigen würde.
Das beginnt schon mit dem Philosophen, Arzt und Ökonomen John Locke, der 1693 das vielleicht bedeutendste Buch vorlegte, das jemals über Erziehung geschrieben wurde, seine "Some thoughts concerning education" – Einige Gedanken die Erziehung betreffend. Denn Locke, der ein großer Verfechter von Freihandel und Geldwirtschaft war und der im Privateigentum die Grundlage aller Staatlichkeit sah, eben dieser Locke gibt auf die Frage, ob man Kinder auf die Wirtschaft hin erziehen solle, die Antwort: Nein, soll man nicht.
"… weder hält er es für erforderlich, Kinder vorzeitig für spezielle ökonomische Fragestellungen zu sensibilisieren, noch glaubt er, dass Eltern und Lehrer ihre Schützlinge unentwegt auf die Härten und Herausforderungen des späteren Berufslebens hinweisen sollen, wenn sie diese zu fleißigen und strebsamen Schülern erziehen wollen."
Was Locke entdeckt und was eine unverlierbare Errungenschaft des Nachdenkens über Schule sein sollte, ist: Die beste Motivation, sich aufs Lernen einzulassen, muss im Lernen selber, im Interesse an seinen Stoffen und in der Freude am Erkannthaben und Können bestehen.
Der Autor verfolgt dieses Thema durchs ganze 18. Jahrhundert. Er macht uns mit Lockes großem Popularisator, Joseph Addison, bekannt, einem Journalisten, für den die Zeitung ein Medium der Volkserziehung ist, weil die Leser durch sie die Freude am Beobachten lernen. Es folgen Kapitel über deutsche Gelehrte wie Reimarus, Bodmer und Gellert, die das englische Gedankengut auf dem Kontinent und vor allem: an den Universitäten verbreiten. Ihnen wie auch den beiden einflussreichsten Pädagogen jener Zeit, Benjamin Franklin und Jean Jacques Rousseau, ordnet Overhoff Fähigkeiten zu, die zu entwickeln die Absicht jener Pädagogen war: Einbildungskraft, Gemeinnützigkeit, Mitgefühl, Selbstdisziplin.
"Was der … Gang durch die Geschichte des 18. Jahrhunderts … aufgedeckt hat, ist die unübersehbare Tatsache, dass das aufklärerische Bestreben, Lernen als Glück erfahrbar zu machen, von Anfang an unauflöslich mit dem Kampf um die Verwirklichung einer freiheitlichen, menschenfreundlichen und demokratischen Bürgergesellschaft verknüpft war."
Dass die Erziehung zum Mitgefühl und die zur Selbstdisziplin, die Erziehung zur Wissbegierde und zum Gottvertrauen dabei nicht immer am selben Strang ziehen, und dass Benjamin Franklin nicht nur ein Apologet des Altruismus war, sondern auch ein ziemlicher Filou, das gerät ein bisschen in den Hintergrund. Overhoff stilisiert die Gedankenwelt des 18. Jahrhunderts stark, um sie als einheitlich darzustellen. Und er scheut sich, weil er diese Epoche mag, die Kosten ihrer Pädagogik zu erwähnen. Rousseaus "Emile" ist aber nicht nur ein Bildungsroman. Es ist leider auch ein Buch, das die These vertritt, die beste Erziehung müsse abseits der Gesellschaft erfolgen, durch Isolation der zu Erziehenden in einer Art reformpädagogischer Kontroll-Idylle.
Hier liegen auch Grenzen der Sympathie mit Ideen des 18. Jahrhunderts. Dass Overhoff sich nur für ihre erfreulichen und wegweisenden Aspekte interessiert ist aber legitim. Denn obwohl er ein erzählendes Buch geschrieben hat, geht es ihm nicht um historische Vollständigkeit oder um analytische Durchdringung der Werke von Rousseau, Kant oder Moses Mendelssohn. Worum es ihm geht, ist vielmehr der Hinweis auf eine Tradition, deren beste Argumente die meisten, die den gegenwärtigen Bildungsdiskurs prägen, als undurchdacht, längst überholt und insofern ungebildet dastehen lassen.
"Was heute von Bildungspolitikern, aber auch von Lehrern und Eltern immer häufiger betont wird, ist leider nicht das Glück, lernen zu dürfen, sondern die Pflicht, lernen zu müssen, um dem eigenen Land oder sich selbst unter allen Umständen einen Standortvorurteil oder Karrierevorsprung in der globalisierten Welt zu verschaffen."
Man kann es auch so formulieren: Overhoff erinnert an eine Tradition, für die Erziehung noch mit Freiheit zusammenhing, darum aber auch mit Anstrengung und Ausdauer. Das zeigt, dass man kein Anhänger einer reformpädagogischen Kritik des Leistungsprinzips in den Schulen sein muss, um die heutige Einstellung zu Bildungsfragen abzulehnen. Locke und Kant hätten sich darüber gewundert, was heute als Pädagogik angeboten wird.
Jürgen Overhoff: Vom Glück, lernen zu dürfen. Für eine zweckfreie Bildung
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2009
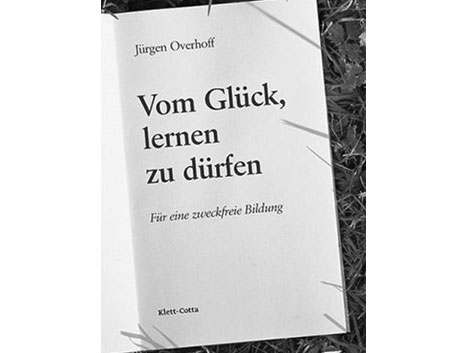
Jürgen Overhoff: "Vom Glück, lernen zu dürfen"© Klett-Cotta
