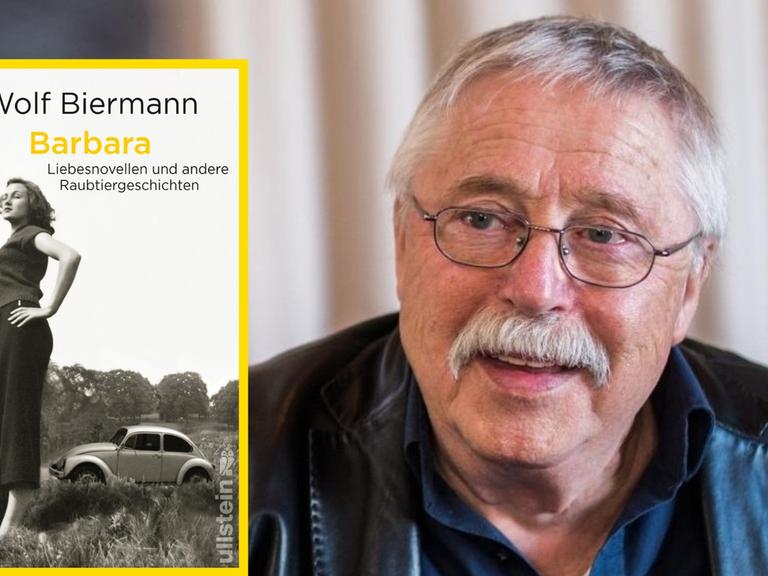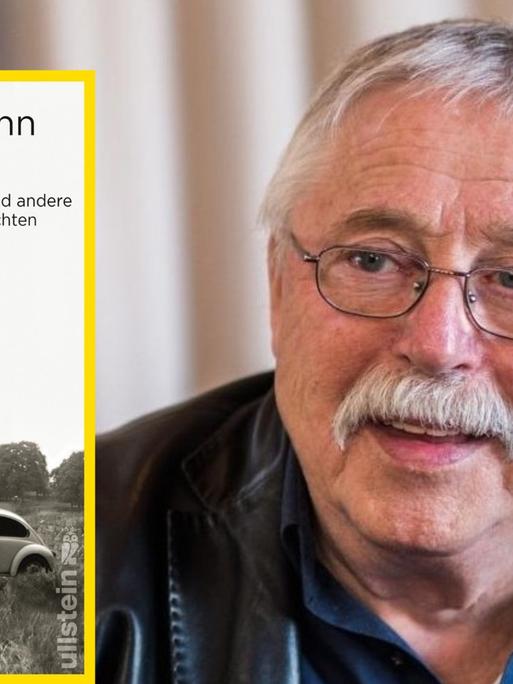"Sie ist der Engel, der über einem ist"
11:51 Minuten

Die Autorin Ursula März hat "Tante Martl" zur Hauptfigur ihres neuen Buchs gemacht. In ihrem ersten Roman erzählt März mit Empathie von ihrer Patentante, eine Geschichte über die Generation vor der Emanzipation, vor der weiblichen Freiheit.
Andrea Gerk: Tante Martl ist zwar nicht besonders schön, aber sehr selbstständig, als Lehrerin verdient sie ihr eigenes Geld. Sie hat ein Auto und fährt allein in Urlaub, was in den 50er-, 60er-Jahren der BRD nicht unbedingt der Normalfall war.
Ursula März, "Lesart"-Hörern auch als Literaturkritikerin bekannt, hat ihre Tante Martl zur Hauptfigur ihres neuen Buchs gemacht. Es ist ihr erster Roman. Frau März, was kommt Ihnen denn für ein Bild oder für ein Geruch oder ein Ton in den Kopf, wenn Sie an Tante Martl denken?
"Wir haben sehr viel telefoniert"
März: Unbedingt Letzteres, ein Ton, was auch damit zu tun hat, dass wir sehr, sehr, sehr viel telefoniert haben – wie man das oft mit älteren Verwandten macht. Sie hatte eine besondere Art, ihre Telefonate einzuleiten, aber noch wichtiger, würde ich sagen, sie sprach starken pfälzischen Dialekt. Ich will jetzt nichts nachmachen, aber ich beherrsche ihn …
Gerk: Sie können das?
März: Isch kann das schon, de pfälzisch Dialekt …
Gerk: Ich hab das immer so im Ohr beim Lesen.
März: Ich hab auch Mittelfränkisch drauf, sie auch?
Gerk: Freilich.
März: Freilich, genau – Berlinern kann ich nicht. Also gut, Tante Martl hat starken Dialekt gesprochen, pfälzischen Dialekt, und wir haben sehr viel telefoniert – ein-, zweimal die Woche mindestens –, und bei ihrem Telefonat begann sie immer am Anfang zu stöhnen. Das will ich jetzt nicht vormachen, weil das wäre mir ein bisschen zu denunziatorisch.
Aber nach diesem Stöhnen kam dann ein lautes Atmen und dann kam mein Name, und dann kam die Erzählung oder die Sache, um die es ging. Als sie älter wurde, hat sie dann manchmal nach dem Stöhnen vergessen, was sie eigentlich erzählen wollte. Das waren schwierige Telefonate, weil ich wusste, jetzt soll ich eigentlich schon antworten, aber ich wusste nicht auf was.
Gerk: Sie ist Ihre Patentante gewesen, Sie machen da in dem Buch auch gar keinen Hehl draus, dass Sie das sind, die Erzählerin. Sie erzählen auch, dass Sie in Klagenfurt als Jurorin waren, also man erkennt das sofort. Wie ist das entstanden oder wann – diese Idee, über die Tante zu schreiben?
Das Porträt einer Nebenfigur
März: Natürlich hat es damit zu tun, dass die Frau nicht mehr lebt. Auch alle anderen, außer meinem Bruder, der erwähnt wird, andere Familienmitglieder, aber aus dieser Generation meiner Tante – die hatte zwei Schwestern, eine davon war meine Mutter – und auch den Ehemännern lebt niemand mehr. Für mich persönlich war das die ultimative Voraussetzung, überhaupt darüber schreiben zu können.
Ich finde aber, es ist auch generell in der Literatur schon eine, in Anführungsstrichen, "ethische Frage", wie man mit lebenden Personen umgeht, wenn man über sie schreibt. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob sich jemand erkannt fühlt oder nicht. Also, das war die erste Voraussetzung, und dann hab ich eigentlich vollkommen anders angefangen.
Ich hab mit einer Schlussepisode angefangen, nämlich diese Tante Martl tritt schließlich in einer Fernsehsendung auf, die es nicht gibt, zumindest nicht genau so, wie sie in meinem Buch heißt – da heißt sie "Gold und Glitter", die findet man nicht in der Fernsehzeitschrift.
Damit fing ich an, das war eine Erfindung. Und dann hab ich immer mehr gemerkt, dass irgendwas an dem Erfinden hier nicht so ganz stimmt. Und dass ich ein Bedürfnis hatte, über sie zu schreiben, sozusagen auch das Porträt einer Nebenfigur.
Sie war auch – das sagt ja eigentlich schon der Begriff "Tante", sie war schon eine Nebenfigur des Lebens. Tanten sind immer weibliche Wesen, die an einer Familie quasi dranhängen, aber keine eigene haben.
Gerk: Jetzt müssen wir mal erzählen, warum sie überhaupt zu so einer Nebenfigur wurde, nach der ersten Seufzergeschichte fangen Sie ja damit an, dass sie ein Familientrauma mit sich rumschleppte.
März: Ja, es gibt für ihre Tanten-Biografie sozusagen eine Urszene: Sie wurde 1925 an einem Juni-Sonntag geboren, und zwar – und das ist das Fatale – als drittes Mädchen von drei Mädchen. Schon das zweite Mädchen, das war Rosa, meine Mutter, sollte unbedingt ein Junge werden. Vor allem ihr Vater wollte unbedingt einen Jungen, und zwar mit einer Unbedingtheit, die man sich heute kaum mehr vorstellen kann oder von der man glaubt, die gäbe es in der indischen Gesellschaft, aber nicht in Deutschland in den 20er-Jahren. Aber so war es.
Dieses dritte Mädchen war für ihn ein solches Ärgernis, dass er sich suggeriert hat, es wäre ein Junge – oder es versucht hat, sich zu suggerieren – und am Standesamt tatsächlich angegeben hat, es sei ein Junge. Und eine Woche lang lebte dieser Säugling mit einer männlichen Geburtsurkunde und einem männlichen Namen. Das war natürlich eine Episode, die in der Kleinstadt – pfälzische Kleinstadt, Zweibrücken – sehr bekannt war, immer weitergegeben wurde als sehr witzig. Aber für die Frau, die da herangewachsen ist, ist es nicht witzig.
Gerk: Er hat sie ja auch tatsächlich das spüren lassen, dass er ihr das Zeit seines Lebens übel genommen hat, das beschreiben Sie auch, finde ich, sehr berührend. Gleichzeitig war sie die Einzige, die ihn dann pflegen durfte. Das ist ja auch so eine ganz seltsame emotionale Verstrickung gewesen.
Sie ist immer in ihrem Elternhaus geblieben
März: Natürlich kommt dann auch sozusagen das Historische zum Biografischen dazu. Sie gehört ja sozusagen zur Flakhelfer-Generation, sie war am Ende des Krieges 20 Jahre alt, eigentlich "im besten Liebes- und Heiratsalter". Sie ist nicht die einzige Frau aus dieser Generation, die keinen Mann gefunden hat – wir wissen warum: weil viele Soldaten gefallen waren, aber auch, weil das Leben anders gespielt hat.
Und – sagen wir mal in Anführungsstrichen – ihre Weiblichkeit hatte einen schweren Treffer erhalten. Sie war nicht sehr weiblich identifiziert, und ihre beiden anderen Schwestern haben geheiratet und sie blieb zurück. Sie wurde dann sozusagen das Kind, das immer bei den Eltern bleibt.
Sie haben es ja vorhin richtig gesagt, sie war selbstständig, sie war Lehrerin, sie ist in Urlaub gefahren, sie hat schon in den 50er-Jahren einen Führerschein gemacht, aber – und das ist doch das sehr Signifikante und vielleicht auch Traurige, so empfinde ich es doch für dieses Leben – sie ist immer in ihrem Elternhaus wohnen geblieben.
Mein Großvater, also ihr Vater, hatte einen Schlaganfall erlitten in den 60er-Jahren, und sie hat ihn dann zu großen Teilen gepflegt, sie hatte die Verantwortung dann für beide Eltern, lebte im Haus – es gab zwei Wohnungen. 1975 war sie zum ersten Mal allein, ohne diese töchterliche Verantwortung, und da hätte sie ein neues Kapitel aufschlagen oder ausziehen können, aber sie ist im Elternhaus geblieben. Sie hat 38 Jahre allein in diesem Haus gelebt.
Gerk: Sie beschreiben das ganz toll, finde ich, diese Diskrepanz zwischen den zwei Schwestern, die ja zur damaligen Zeit als erfolgreich gesehen wurden. Die hatten eben geheiratet, die eine hatte auch Kinder, und die Tante Martl, ja, die war halt auch da. Aber wenn man das liest, wie Sie es beschreiben, ist sie ja eigentlich die viel Erfolgreichere gewesen.
März: Je nachdem. Ich weiß gar nicht …
Gerk: Erfolgreich ist vielleicht das falsche Wort.
Die Wahlmöglichkeiten waren klein
März: Ist nicht der falsche Begriff, aber sagen wir mal erfüllter oder so. Aber ich glaube, das Tragische an dieser Frauengeneration – das sind ja unsere Mütter, das ist die Generation vor der Emanzipation, also auch die vor der weiblichen Freiheit – ist, dass ihre Wahlmöglichkeiten so klein waren. Eine Frau wie Martl, die einem Beruf nachging, Volksschullehrerin war, die alles Existenzielle, Bürokratische selber erledigt hat und so weiter, war sehr viel mehr noch männlich konnotiert als heute, obwohl ich nicht weiß, ob es heute nicht auch noch so was gibt.
Und ihre Schwestern wiederum, die waren keineswegs weniger intelligent, keineswegs. Sie haben geheiratet, sie hatten nie einen Beruf ausgeübt, obwohl sie eine gute Schulausbildung hatten, aber sie waren Hausfrauen. Und es gab in ihrer Existenz – ich sag es jetzt mal in Anführungsstrichen – etwas Infantiles, was sich auch darin äußert, dass zum Beispiel weder die eine Schwester noch die andere jemals auf einer Bank war, um Geld abzuholen.
Das machten die Ehemänner. Oder sie wussten beim Auto nur, dass man vorne rechts einsteigt und sich vom Ehemann rumfahren lassen kann. Das hat Tante Martl alles alleine gemacht. Sie wussten, wenn’s hinten qualmt, dann ist irgendwas mit meinem Getriebe oder so.
Gerk: Aber das hat sie Ihnen offenbar auch mitgegeben, man spürt ja die ganze Zeit, dass Sie sich auch sehr nahe waren, oder?
Nicht nur eine individuelle Geschichte
März: Ich war dazwischen. Ich war dazwischen. Sie war meine Patentante. Und eine Patentante ist zumindest in dieser Zeit noch etwas sehr viel Wichtigeres als heute. Sie ist schon so irgendwie der Engel, der über einem ist und der einem auch charakterlich viel mitgibt – von Patentanten bekommt man auch das erste Geldkonto, das erste Fahrrad, die erste Uhr und so weiter –, die einen auch ein bisschen beschützt.
Und dadurch, dass diese zwei Schwestern, nämlich Tante Martl und meine Mutter Rosa, extreme Kontraste waren: die eine sehr schön und so weiter, aber später nur noch im Bett, nur noch krank, also so ein bisschen eine hysterische Kranke auch, und die andere ein bisschen garstig, ein bisschen ruppig, aber selbstständig. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Kind nicht damit geistig beschäftigt gewesen wäre zu überlegen, was jetzt für mich besser wäre und wie ich es mache.
Ich wollte weder wie Tante Martl werden, das war mir klar – da hat man auch sozusagen mit dem Männergeschlecht so gar nichts zu tun –, ich wollte aber auch nicht so kokett und wiederum übervorsichtig und immer kränklich wie meine Mutter werden, die immer sagte, "es zieht" oder so, dieses kränklichen Frauen. Ich hatte immer ein Problem, wie komme ich da durch, wie gibt es da einen Kompromiss. Und ich würde sagen, in diesem Punkt ist es nicht nur eine individuelle Geschichte, sondern sie hat auch etwas Exemplarisches.
Gerk: Auf jeden Fall.
März: Bis heute sucht das weibliche Geschlecht doch sozusagen einen Weg zwischen Öffentlichkeit, zwischen Erfolg und Femininität, also eine weibliche Kulturgeschichte ist bis heute, finde ich, doch irgendwie unerledigt.
Gerk: Die Tante Martl, am Anfang haben Sie das so schön gesagt, das ist quasi die personifizierte Nebenfigur Ihres eigenen Lebens gewesen. Was, denken Sie, hätte sie dazu gesagt, dass sie als Hauptfigur in einem Roman auftritt?
März: Ah, was schreibst du denn da, ich bin doch net in einem Roman, was denkst du denn, geh deiner Arbeit nach und lass das Geschreib. Ungefähr so. Aber sie hätte sich vielleicht doch gefreut, so hat sie geredet, aber man musste hinhören, dahinter – wenn ich dann sagte, ach Martl, ist doch schön, wenn ich mal ein Buch über … Ah jo, dann machsch halt.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.