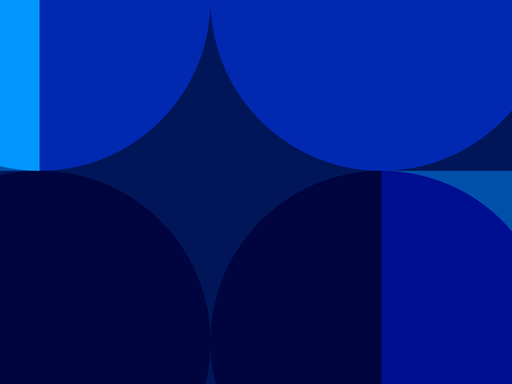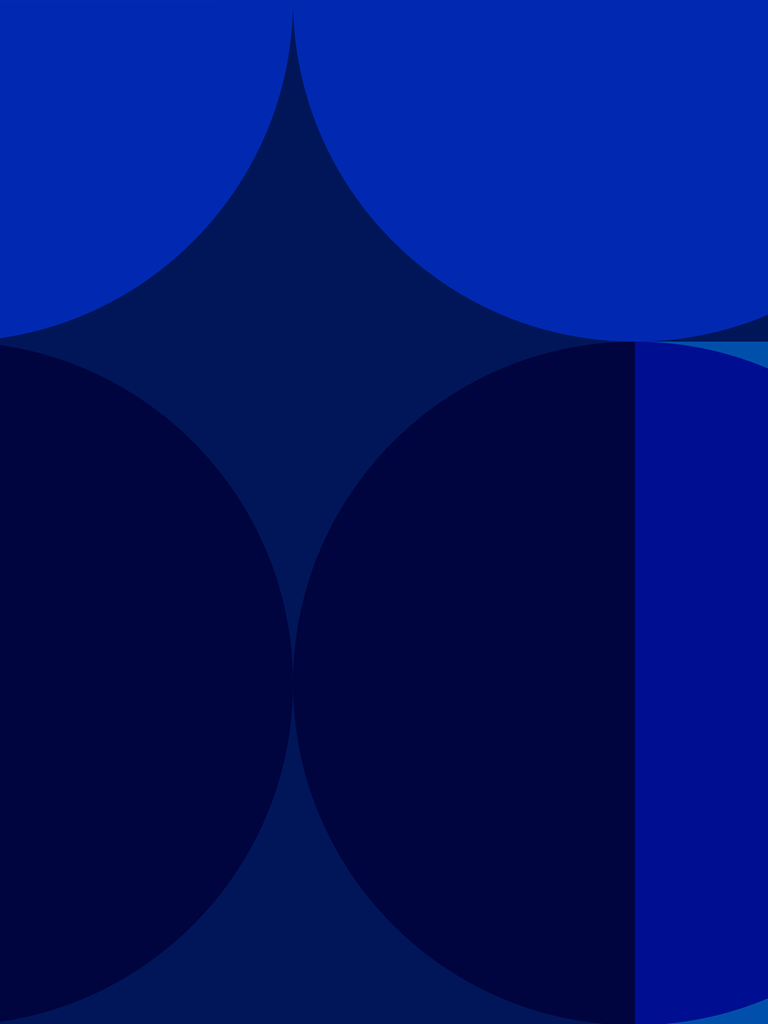80 Jahre UNESCO

Schloss Neuschwanstein wurde im Juli 2025 auf die Welterbeliste aufgenommen. Es zählte bereits vorher zu den meistbesuchten Tourismuszielen Deutschlands, jährlich kommen mehr als eine Million Menschen. © picture alliance / Zoonar / Ingrid Ruch
Der Welterbe-Titel hat an Wert verloren

Einst versprach ein UNESCO-Welterbetitel Prestige und Geld, doch der Wert schwindet. Die Organisation, deren ausgegebenes Ziel es ist, den Frieden zu sichern, steht zunehmend unter politischem Druck. Welche Folgen hat das und was könnte man ändern?
Vor 80 Jahren, am 16. November 1945, wurde die UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg gegründet. Damals versammelten sich Delegierte aus 37 Nationen in London, um eine gemeinsame Vision umzusetzen: Frieden durch Verständigung in Bildung, Wissenschaft und Kultur. Man wollte zukünftige Katastrophen verhindern und Kulturgüter auch in Kriegszeiten schützen.
Die Welterbekonvention, die heute eine zentrale Bedeutung in der UNESCO hat, kam erst am 16. November 1972 dazu. Das formulierte Ziel dieser Konvention war und ist es, Natur- und Kulturgüter von außergewöhnlichem universellem Wert als Teil des gemeinsamen Erbes der Menschheit für zukünftige Generationen zu erhalten. Doch das wird in der Praxis immer schwieriger.
Wie wird ein Welterbe-Titel vergeben und welche Kritik gibt es daran?
Der erste Schritt im Nominierungsverfahren ist die Einreichung sogenannter Tentativlisten, auf denen das jeweilige Land dem UNESCO-Welterbezentrum Vorschläge für zukünftige Nominierungen von Kultur- und Naturerbestätten macht. Bevor eine Stätte vom Komitee in Betracht gezogen wird, muss sie dann eine Evaluierung durch eine der Beraterorganisationen der UNESCO durchlaufen.
Über die endgültige Eintragung von Stätten in die Welterbeliste entscheidet jährlich das von der UNESCO eingerichtete zwischenstaatliche Welterbekomitee, dem Vertreter von 21 Vertragsstaaten der Welterbekonvention angehören.
Der politische Druck auf diese Gruppen habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, sagt der Ethnologe Christoph Brumann. Daher sei es heute „nicht mehr angemessen“, das Welterbesiegel als ein „objektives Gütesiegel“ zu betrachten, das nur nach „ganz ganz strenger Prüfung“ verliehen werde. Zum einen wäre an einigen Stellen erkennbar, dass die Beraterorganisationen nach jahrelanger Kritik an ihnen inzwischen sehr viel freundlichere Evaluierungen abgäben als früher, zum anderen entscheide das Komitee auch entgegen den Empfehlungen der Berater.
Welchen Wert hat der Welterbetitel heute noch?
„Ich glaube, es muss das Bewusstsein wieder gestärkt werden, was eigentlich die Bedeutung dieser Welterbestätten sind“, sagt Stephan Dömpke, Vorsitzender der NGO World Heritage Watch. Seine Organisation beobachtet die Arbeit der UNESCO und kritisiert sie auch öffentlich.
Dömpke sieht hier die Politik in der Pflicht, die die Welterbetitel nur noch unter monetären Aspekten bewerten würden. Landräte und Bürgermeister erhofften sich durch das Siegel beispielsweise mehr Tourismus. Dömpke betont aber die integrative Kraft des Titels. „Der Grundgedanke ist ja unglaublich schön, dass die ganze Weltgemeinschaft, das Erbe, egal wo es ist, als gemeinsames Erbe begreift und gemeinsam schützt.“
Die UNESCO selbst hat nicht die Macht, die zum Welterbe ernannten Kultur- und Naturstätten zu schützen. Diese Aufgabe obliegt den jeweiligen Nationalstaaten. Kommt es also hart auf hart – wie im Fall des Katharinenklosters in Ägypten, wo in direkter Nähe eine Touristenstadt errichtet wird – ist die UNESCO nicht mehr als ein zahnloser Tiger, der Titel „Welterbe“ nur noch symbolisch und ein praktisches Werbemittel. Deutschland sei in dieser Hinsicht übrigens auch nicht „der Weltmeister oder das Wunderkind“, betont Dömpke. „Sie machen, was sie wollen und schaffen Fakten.“

Das Katharinenkloster am Berg Sinai ist seit 2002 UNESCO-Welterbe. Die ägyptischen Regierung will offenbar das Areal um das Kloster touristisch weiter erschließen.© imago / imagebroker / Stefan Sutka
Wenig Repräsentanz von Ländern des Globalen Südens
Die von der UNESCO geführte Liste des Welterbes umfasst aktuell 1.248 Stätten in 170 Ländern, aber nur neun Prozent von ihnen liegen in Afrika. Dabei befinden sich dort fast ein Viertel der als gefährdet eingestuften Stätten. Der Kontinent spielt seit Gründung der UNESCO eigentlich eine wichtige Rolle. Das erste große Projekt der Organisation war die Rettung der Tempel von Abu Simbel in Ägypten. Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser bat damals die UNESCO und die Weltgemeinschaft um Hilfe, um diese Tempel vor der Versenkung im Assuan-Staudamm zu bewahren.
Im Juli 2025 nahm die UNESCO zwei Stätten in Kamerun und Malabi auf die Welterbeliste, die Diy-Gid-Biy-Landschaft in den Mandara-Bergen im äußersten Norden Kameruns und eine Bergkette im Süden von Malawi. Auf seiner 47. Tagung hat das UNESCO-Komitee mehr als zwei Dutzend neue kulturelle und natürliche Welterbestädten aus Afrika, Asien, Europa und Süd und Mittelamerika in seine Liste aufgenommen. Deutschland ist aktuell mit 55 Natur- und Kulturerbestätten vertreten.
Wer ist der neue UNESCO-Generaldirektor Khaled El-Enany?
Seit dem 15.11.2025 ist der Ägypter Khaled el-Enany offiziell neuer Generaldirektor der UNESCO. 1971 in Gizeh geboren, studierte er Ägyptologie in seinem Heimatland und promovierte später in Frankreich. El-Enany war Direktor des alten Ägyptischen Museums am Tahrir-Platz in Kairo und an der Gründung des Nationalmuseums für Ägyptische Zivilisation beteiligt. Von der Wissenschaft über die Museen führte ihn sein Weg in die Politik. Von 2016 bis 2022 war el-Enany Minister für Altertümer und Tourismus in Ägypten.
Kritiker werfen ihm vor, dabei die falschen Prioritäten gesetzt zu haben. Vor seiner Wahl zum Generaldirektor, warnte die Organisation World Heritage Watch die UNESCO in einem offenen Brief. Sie schrieb darin, el-Enany sei für die Zerstörung großer Teile der historischen Totenstadt von Kairo mitverantwortlich gewesen, ebenso wie für die „monströse Tourismusentwicklung“ rund um das Katharinenkloster auf der Halbinsel Sinai. Beide Stätten gehören zum UNESCO-Welterbe.
Der Brief wurde weltweit von mehr als 50 Nichtregierungsorganisationen, Einzelpersonen und Akademikern aus dem Kultur- und Naturschutzbereich unterzeichnet. Am 6. November wählte die UNESCO-Generalkonferenz el-Enany mit 172 von 174 abgegebenen Stimmen für vier Jahre in sein Amt. El-Enany ist der erste Generaldirektor der UNESCO aus einem arabischen Land.
nsh