Unbehaust überall
Der Schriftsteller Rolf Schneider hat in seinem Leben immer wieder Schikane erfahren müssen, nicht erst in der DDR, denn er ist 1932 geboren. In seiner Autobiografie vergleicht er die Systeme und misst sie auch an ihrem Umgang mit Kunst und Künstlern.
Wahrscheinlich fehlte nicht viel, und Rolf Schneider hätte seinen vielen literarischen Fähigkeiten noch die zur musikalischen Komposition hinzugefügt. Ein Theater- und Hörspielautor ist er ja schon. Das hat bereits viel mit Komponieren zu tun, zumal dann, wenn es sich bei den auftretenden Figuren um Musiker handelt. Auf die ihm häufig gestellte Frage, welche seiner Arbeiten er als die wichtigste ansehe, pflegt er zwar immer zu antworten, die gerade zuletzt geschriebene, aber hier, in seiner Biografie, vergisst er nicht, neben der letzten eine relativ frühe Arbeit zu erwähnen:
"Das meistgespielte meiner Bühnenstücke ist 'Sommer in Nohant', es erzählt die Liebesgeschichte von George Sand mit Frédéric Chopin."
Es war aber nicht der französische Pole, der auf ihn einen ersten unauslöschlichen Eindruck gemacht hat, es war ein ungarischer Komponist. Als Oberschüler in Wernigerode, wohin es die Familie nach dem Krieg verschlagen hatte, hörte Schneider zufällig im Radio eine Übertragung des Konzerts für Orchester von Béla Bartók:
"Ich lauschte atemlos. Nie zuvor und nie mehr danach hat mich die Begegnung mit einem Musikstück derart überwältigt. Fortan würde dieser Komponist mein musikalischer Abgott sein, und um seinetwillen vernachlässigte ich meine bisherigen Favoriten Peter Tschaikowski und Claude Débussy (man erkennt einen gewissen Hang zu spätromantischem Zuckerguss)."
Mit Zuckerguss hat Bartóks Musik, die zwischen Tonalität und Atonalität eine gewisse Schwebe hält, tatsächlich nichts zu tun. Der Oberschüler war davon derart hingerissen, danach dann besonders von Bartóks mikrokosmischen Klavierkompositionen, dass er seinen Enthusiasmus in einen kleinen Gedichtzyklus übertrug. – So weit der Komponist von Stücken für die Bühne und fürs Radio.
Den meisten wird Schneider mehr als Sachbuchautor, vor allem aber als Romancier bekannt sein. Wie er das alles unter einen Hut kriegt, ist dem Rezensenten ein Rätsel. Vermutlich ist unter allen seinen Fähigkeiten die für das Schreiben von Romanen die hervorstechendste. Auch da ist eine Vorliebe zu erkennen – eine für singend zu sprechende Texte.
"Robert Musils 'Drei Frauen' erhielt ich 1952 als Geschenk. Die Lektüre wurde für mich zu einer Initiation gleich in mehrfacher Hinsicht: Ich verfiel diesem Autor, und ich begann mich in das Milieu zu vertiefen, das ihn hervorgebracht hatte, die untergegangene k.u.k.-Monarchie. Bis dahin verliebt in den getragen-ironischen Prosaton Thomas Manns, begegnete ich hier einem Stilisten, der nicht minder kunstvoll zu formulieren verstand, der aber anders war, raffinierter, melodiöser, kühner, moderner."
Der gerade mal 20-Jährige war von Musil so verzaubert, dass er später über ihn promovierte. Sein Doktorvater aber, kein Geringerer als Hans Mayer, entwich in den Westen – kurz vor Ende der Promotion. Aber sie war nicht umsonst geschrieben: Sie erschien als Kommentarband zu einer dreibändigen Musil-Ausgabe im Ost-Berliner Verlag Volk und Welt.
Schneider ahmte das Beispiel Mayers nicht nach, obwohl er Grund genug dazu gehabt hätte. Als einer der prominenten ostdeutschen Schriftsteller, die 1976 gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns protestierten, musste er jede Menge Schikanen ertragen. Schon beim Lesen stockt einem der Atem, wenn er etwa bei einer Reise ins Tschechische die permanente Verfolgung durch einen roten Fiat beschreibt. Doch er blieb im Osten, selbst nachdem er 1979 vom Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen wurde. Das hängt mit einer für Musikliebhaber nicht gerade typischen Kaltblütigkeit zusammen, die bewundernswert ist:
"Die Institution Staatssicherheit gehörte zu den Vorzugsthemen vieler Gespräche in der DDR. Man wusste von Leuten, die unter der ständigen Observation ihres Lebens derartig litten, dass sie zusammenbrachen. Irgendwann nahm ich mir vor, die Existenz der Staatssicherheit unappetitlich, ihr Tun überflüssig und ihren Mythos lächerlich zu finden. Fortan verhielt ich mich, als ob sie nicht existierte, und wenn sie mich observieren wollte, sollte sie das tun."
Um solche Entscheidungen zu fällen, musste einer schon ruhig Blut haben. Und er musste ein von der unverfälschten sozialistischen Sache überzeugter Bürger sein. Er habe den Linkssozialismus in den Genen, heißt es an anderer Stelle. Der Trotz, es den Banausen in der DDR zu zeigen, kam dazu. Außerdem hielten ihn familiäre Bindungen zurück und, nicht zu vergessen, der Luxus, sich zwischen Ost und West recht frei bewegen zu dürfen. Der wurde freilich nur den Schriftstellern zugestanden, die es im Osten und im Westen zu Ruhm und Ansehen gebracht hatten. Schneider gehörte dazu. Der österreichische Regierungschef Bruno Kreisky, selber Musil-Liebhaber, lud Schneider kurzerhand zu sich ins Wiener Ballhaus ein.
Seitdem war Schneider in gewissem Grade aus dem Schneider und häufig im Nachbarland gefragt. Folgende Szene ist typisch für ihn. Ort: abendliche Diskussionsrunde beim zweiten Fernsehen des ORF. Anlass: ein runder Geburtstag des vorletzten österreichischen Kaisers. Gesprächsleitung: der Schriftsteller Gregor von Rezzori:
"Es ging um die merkwürdigen Nachwirkungen des toten Monarchen in dem einst von ihm regierten Land. Ich äußerte mein Unverständnis. Wie könne man einem Menschen, der den Ersten Weltkrieg begonnen und damit sein Imperium ruiniert habe, so viel Verehrung entgegenbringen? Gregor von Rezzori entgegnete mir: 'Sie können das nicht verstehen – das macht die Majestät.'"
Der Auftritt Rolf Schneiders, dem bei all seiner Liebe zu Bartók und Musil die k.u.k.-Welt eher fremd blieb, führte unter den österreichischen Zuschauern zu teils wütenden Reaktionen. Bei den deutschen Lesern dagegen wird er mit seinem Unverständnis auf viel Verständnis stoßen. Auch mit seiner Bezeichnung Honeckers als "Kaiser Franz Joseph der DDR". Uns ist der Unterschied zwischen einer Monarchie wie der habsburgischen und einer Diktatur wie der sozialistischen abhanden gekommen.
Hierzulande also bleibt der kompetente Kommentator Musils, der sich im Grunde überall als Unbehauster fühlte, weitgehend verschont, so wie es der Titel seiner lehrreichen, aber etwas spröden, da alles Private aussparenden Biografie verspricht. Verschont auch deshalb, weil er in liebenswerter Selbstironie seinem Buch unter anderem jenes Motto Musils voranstellt, das genau so auf den Autor selber zutreffen könnte:
"'Jeder erlebt die Symbole seiner Zeit. Bloß werden sie ihm erst später verständlich.'"
Rezensiert von Erik von Grawert-May
"Das meistgespielte meiner Bühnenstücke ist 'Sommer in Nohant', es erzählt die Liebesgeschichte von George Sand mit Frédéric Chopin."
Es war aber nicht der französische Pole, der auf ihn einen ersten unauslöschlichen Eindruck gemacht hat, es war ein ungarischer Komponist. Als Oberschüler in Wernigerode, wohin es die Familie nach dem Krieg verschlagen hatte, hörte Schneider zufällig im Radio eine Übertragung des Konzerts für Orchester von Béla Bartók:
"Ich lauschte atemlos. Nie zuvor und nie mehr danach hat mich die Begegnung mit einem Musikstück derart überwältigt. Fortan würde dieser Komponist mein musikalischer Abgott sein, und um seinetwillen vernachlässigte ich meine bisherigen Favoriten Peter Tschaikowski und Claude Débussy (man erkennt einen gewissen Hang zu spätromantischem Zuckerguss)."
Mit Zuckerguss hat Bartóks Musik, die zwischen Tonalität und Atonalität eine gewisse Schwebe hält, tatsächlich nichts zu tun. Der Oberschüler war davon derart hingerissen, danach dann besonders von Bartóks mikrokosmischen Klavierkompositionen, dass er seinen Enthusiasmus in einen kleinen Gedichtzyklus übertrug. – So weit der Komponist von Stücken für die Bühne und fürs Radio.
Den meisten wird Schneider mehr als Sachbuchautor, vor allem aber als Romancier bekannt sein. Wie er das alles unter einen Hut kriegt, ist dem Rezensenten ein Rätsel. Vermutlich ist unter allen seinen Fähigkeiten die für das Schreiben von Romanen die hervorstechendste. Auch da ist eine Vorliebe zu erkennen – eine für singend zu sprechende Texte.
"Robert Musils 'Drei Frauen' erhielt ich 1952 als Geschenk. Die Lektüre wurde für mich zu einer Initiation gleich in mehrfacher Hinsicht: Ich verfiel diesem Autor, und ich begann mich in das Milieu zu vertiefen, das ihn hervorgebracht hatte, die untergegangene k.u.k.-Monarchie. Bis dahin verliebt in den getragen-ironischen Prosaton Thomas Manns, begegnete ich hier einem Stilisten, der nicht minder kunstvoll zu formulieren verstand, der aber anders war, raffinierter, melodiöser, kühner, moderner."
Der gerade mal 20-Jährige war von Musil so verzaubert, dass er später über ihn promovierte. Sein Doktorvater aber, kein Geringerer als Hans Mayer, entwich in den Westen – kurz vor Ende der Promotion. Aber sie war nicht umsonst geschrieben: Sie erschien als Kommentarband zu einer dreibändigen Musil-Ausgabe im Ost-Berliner Verlag Volk und Welt.
Schneider ahmte das Beispiel Mayers nicht nach, obwohl er Grund genug dazu gehabt hätte. Als einer der prominenten ostdeutschen Schriftsteller, die 1976 gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns protestierten, musste er jede Menge Schikanen ertragen. Schon beim Lesen stockt einem der Atem, wenn er etwa bei einer Reise ins Tschechische die permanente Verfolgung durch einen roten Fiat beschreibt. Doch er blieb im Osten, selbst nachdem er 1979 vom Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen wurde. Das hängt mit einer für Musikliebhaber nicht gerade typischen Kaltblütigkeit zusammen, die bewundernswert ist:
"Die Institution Staatssicherheit gehörte zu den Vorzugsthemen vieler Gespräche in der DDR. Man wusste von Leuten, die unter der ständigen Observation ihres Lebens derartig litten, dass sie zusammenbrachen. Irgendwann nahm ich mir vor, die Existenz der Staatssicherheit unappetitlich, ihr Tun überflüssig und ihren Mythos lächerlich zu finden. Fortan verhielt ich mich, als ob sie nicht existierte, und wenn sie mich observieren wollte, sollte sie das tun."
Um solche Entscheidungen zu fällen, musste einer schon ruhig Blut haben. Und er musste ein von der unverfälschten sozialistischen Sache überzeugter Bürger sein. Er habe den Linkssozialismus in den Genen, heißt es an anderer Stelle. Der Trotz, es den Banausen in der DDR zu zeigen, kam dazu. Außerdem hielten ihn familiäre Bindungen zurück und, nicht zu vergessen, der Luxus, sich zwischen Ost und West recht frei bewegen zu dürfen. Der wurde freilich nur den Schriftstellern zugestanden, die es im Osten und im Westen zu Ruhm und Ansehen gebracht hatten. Schneider gehörte dazu. Der österreichische Regierungschef Bruno Kreisky, selber Musil-Liebhaber, lud Schneider kurzerhand zu sich ins Wiener Ballhaus ein.
Seitdem war Schneider in gewissem Grade aus dem Schneider und häufig im Nachbarland gefragt. Folgende Szene ist typisch für ihn. Ort: abendliche Diskussionsrunde beim zweiten Fernsehen des ORF. Anlass: ein runder Geburtstag des vorletzten österreichischen Kaisers. Gesprächsleitung: der Schriftsteller Gregor von Rezzori:
"Es ging um die merkwürdigen Nachwirkungen des toten Monarchen in dem einst von ihm regierten Land. Ich äußerte mein Unverständnis. Wie könne man einem Menschen, der den Ersten Weltkrieg begonnen und damit sein Imperium ruiniert habe, so viel Verehrung entgegenbringen? Gregor von Rezzori entgegnete mir: 'Sie können das nicht verstehen – das macht die Majestät.'"
Der Auftritt Rolf Schneiders, dem bei all seiner Liebe zu Bartók und Musil die k.u.k.-Welt eher fremd blieb, führte unter den österreichischen Zuschauern zu teils wütenden Reaktionen. Bei den deutschen Lesern dagegen wird er mit seinem Unverständnis auf viel Verständnis stoßen. Auch mit seiner Bezeichnung Honeckers als "Kaiser Franz Joseph der DDR". Uns ist der Unterschied zwischen einer Monarchie wie der habsburgischen und einer Diktatur wie der sozialistischen abhanden gekommen.
Hierzulande also bleibt der kompetente Kommentator Musils, der sich im Grunde überall als Unbehauster fühlte, weitgehend verschont, so wie es der Titel seiner lehrreichen, aber etwas spröden, da alles Private aussparenden Biografie verspricht. Verschont auch deshalb, weil er in liebenswerter Selbstironie seinem Buch unter anderem jenes Motto Musils voranstellt, das genau so auf den Autor selber zutreffen könnte:
"'Jeder erlebt die Symbole seiner Zeit. Bloß werden sie ihm erst später verständlich.'"
Rezensiert von Erik von Grawert-May
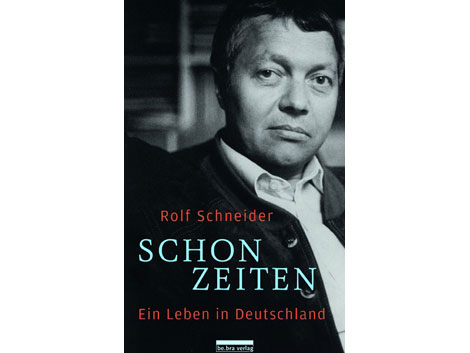
Cover Rolf Schneider: "Schonzeiten"© bebra Verlag
Rolf Schneider: Schonzeiten. Ein Leben in Deutschland
be.bra verlag, Berlin 2013
ISBN 978-3-89809-102-2
320 Seiten, 22 Euro
be.bra verlag, Berlin 2013
ISBN 978-3-89809-102-2
320 Seiten, 22 Euro
