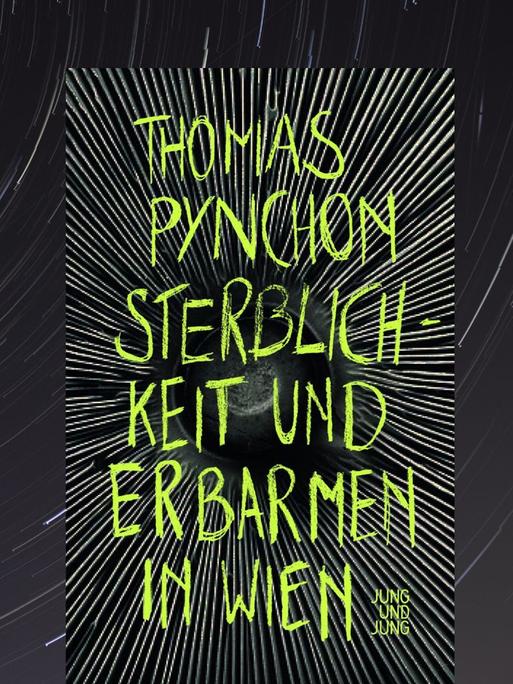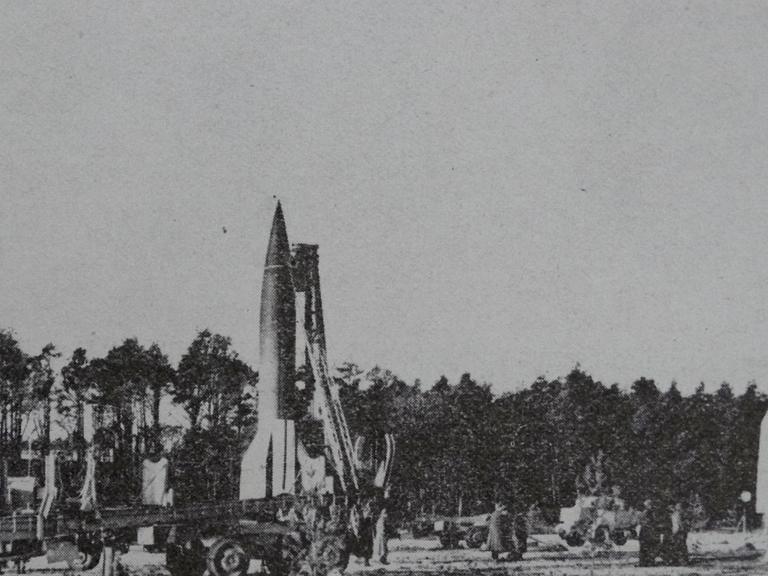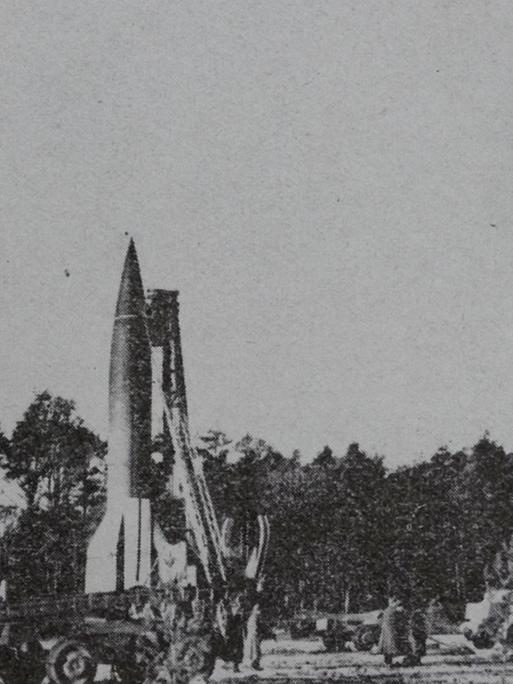Thomas Pynchon: "Sterblichkeit und Erbarmen in Wien"

© Jung und Jung
Auf Ordnung folgt Chaos
06:10 Minuten

Thomas Pynchon
Jürg Laederach
Sterblichkeit und Erbarmen in WienJung und Jung, Salzburg 202264 Seiten
15,00 Euro
In der Erzählung "Sterblichkeit und Erbarmen in Wien", die Thomas Pynchon als 22-Jähriger schrieb, gerät eine Party aus den Fugen. Gespickt mit Anspielungen auf Pop- und Hochkultur, Wissenschaft und Okkultismus, ist der Text ein Fest für Exegeten.
Das Saola ist ein vietnamesisches Waldrind, das kaum je gesichtet wurde. Es ist selten und scheu. Der mittlerweile 85-jährige Kultautor Thomas Pynchon ist so etwas wie das Saola der US-amerikanischen Literatur. Er weigert sich konsequent, im Medienzirkus aufzutreten, höchstens selbstparodierend als "Simpsons"-Figur mit Papiertüte über dem Kopf. Die Leser werden sich also auf sein Werk konzentrieren müssen.
Wahnsinn und Wunder
Dieses Werk hat es in sich. An postmodernen Mammutromanen wie "Die Enden der Parabel" (1973) oder "Gegen den Tag" (2006) beißen sich Literaturwissenschaftler noch heute die Zähne aus. Zumindest den Umfang betreffend ganz anders ist die Erzählung „Sterblichkeit und Erbarmen in Wien“, die Pynchon mit 22 Jahren schrieb und in ihrer deutschen Übersetzung nun nach fast 40 Jahren neu aufgelegt ist. Sie umfasst gerade einmal 43 Seiten und trägt doch die ganze Welt in sich. Es geht um Wahnsinn und Wunder, Beichte und Buße, den Tod, das letzte Gericht und eine zweifelhafte Erlösung.
Die Geschichte beginnt damit, dass ein junger Diplomat namens Siegel im Washington der 50er-Jahre auf eine Hipster-Privatparty geht. Dort trifft er auf einen mysteriösen Doppelgänger, der ihm die Rolle des Gastgebers aufnötigt und gleich wieder verschwindet.
Ein geheimnisvoller Gast
Dann trudeln die Gäste ein. Sie geben sich die Kante, brüllen Lieder, prahlen mit Halbwissen, erzählen sich Wer-mit-Wem-Geschichten und beichten Siegel einer nach dem anderen ihre Sünden. In einer Ecke steht ein dunkelhäutiger Indigene "in zerschlissener Tropenuniform" und verfolgt das immer dekadentere Treiben wortlos.
Allmählich wird dieser Irving Loon zur Projektionsfläche für stereotype Vorstellungen. Man munkelt, er leide an der Windigo-Psychose, einer angeblich von kanadischen Ojibwa-Indianern durch Hungern herbeigeführten Halluzination, die Menschen als schmackhafte Biber erscheinen lässt. Das geht so lange, bis Loon sich aus dem Gefängnis des exotisierenden Blicks befreit und die Verhältnisse mit Gewalt zurechtrückt.
Anspielungsreiche Literatur
Schon der junge Pynchon hat keine Globuli-Literatur geschrieben. Nichts wird verdünnt oder gestreckt. Fast jedes Wort ist mehrdeutig, jeder Teilsatz eröffnet einen neuen Bedeutungsraum. Wenn man auch nur eine Ahnung von dem immensen Bildungskosmos erhalten will, den der frühreife Allesverwerter Pynchon hier auf wenige schachtelsatzlastige Seiten komprimiert hat, tut man gut daran, aufblickend zu lesen und den zahllosen Motiven und Bezügen zwischen Pop- und Hochkultur, Wissenschaft und Okkultismus, Metaphysik und Politik nachzuspüren.
Außerdem liegen bereits in dieser frühen Erzählung Witz und Wahnwitz nah beieinander. Es gibt ganz pynchoneske Spiegelungen und Doppelungen. Ein Schweinefötus wird anstatt eines Mistelzweigs über der Küchentür festgenagelt und später von einem besoffenen Partygast mit Pistazienkernen beworfen. Der Indigene Loon wird als hinduistische Göttin Shiwa beschrieben, die in ihrer Doppelsymbolik für Zerstörung steht, aber auch für einen Neubeginn, so wie das Schwein einerseits mit irdischem Schmutz und andererseits mit der Auferstehung in Verbindung gebracht werden kann. Ein großes Fest für Textexegeten.
Ewige Wiederkehr
Am Ende, das eigentlich keines ist, lässt sich das beklemmende Gefühl nicht abschütteln, dass wir mit den Figuren in einem Zyklus gefangen sind, einem erbarmungslosen Wechselspiel zwischen Rationalismus und Irrationalismus. Auf Chaos folgt Ordnung folgt Chaos et cetera.
Es ist eine ewige Wiederkehr des Gleichen. Und für uns Lesende eine unendliche Sinnverschiebung, ein unendliches Grauen, aber auch, um ein anderes Genie der postmodernen Literatur zu zitieren, ein unendlicher Spaß.