Es sprach: Rosario Bona
Ton: Thomas Monnerjahn
Regie: Stefanie Lazai
Redaktion: Martin Hartwig
Ein Solarpark spaltet ein Dorf
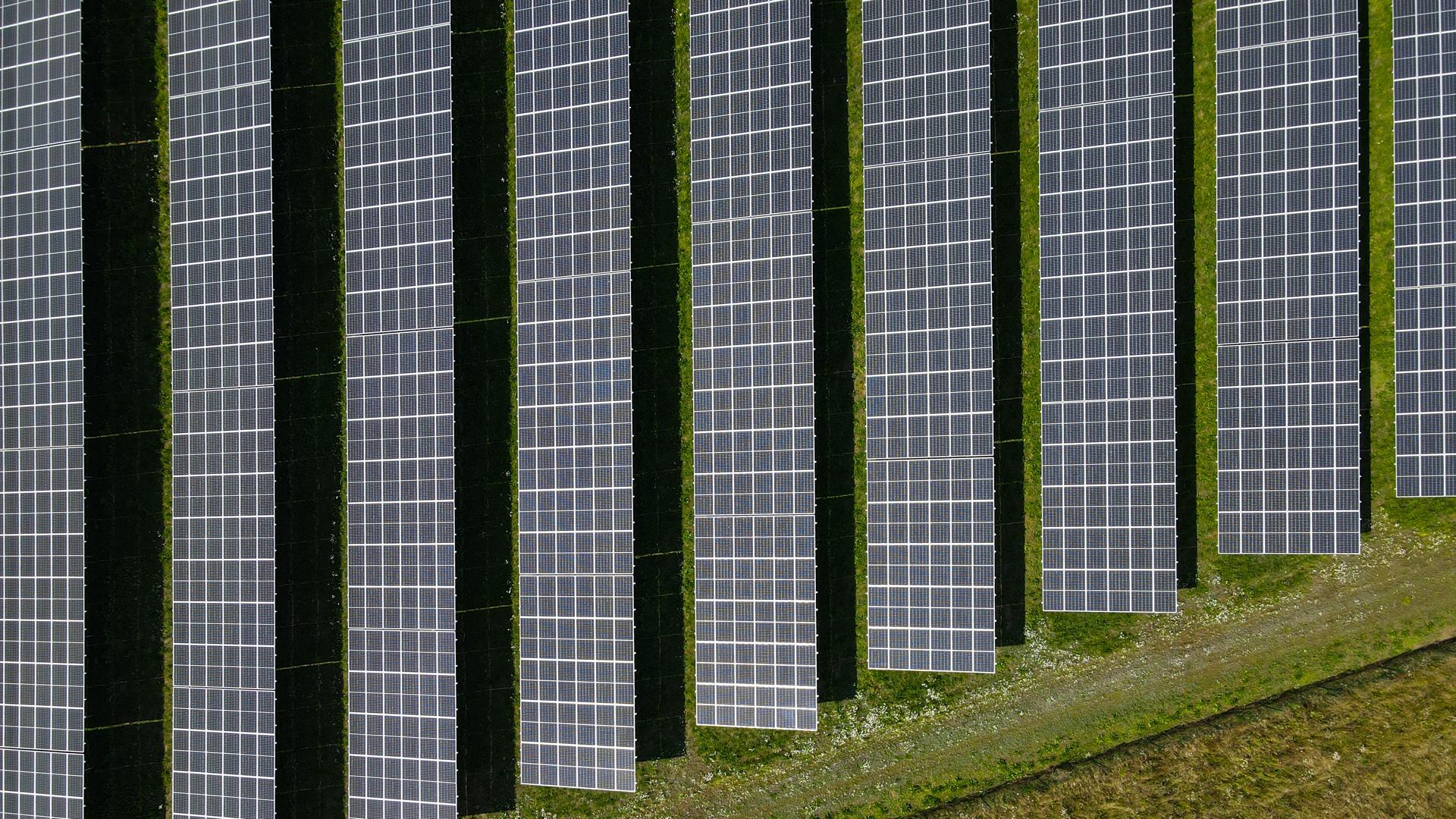
Solarpark im Landkreis Barnim: Nicht nur gegen Windanlagen regt sich Widerstand. © picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild
Kein eitel Sonnenschein
29:50 Minuten
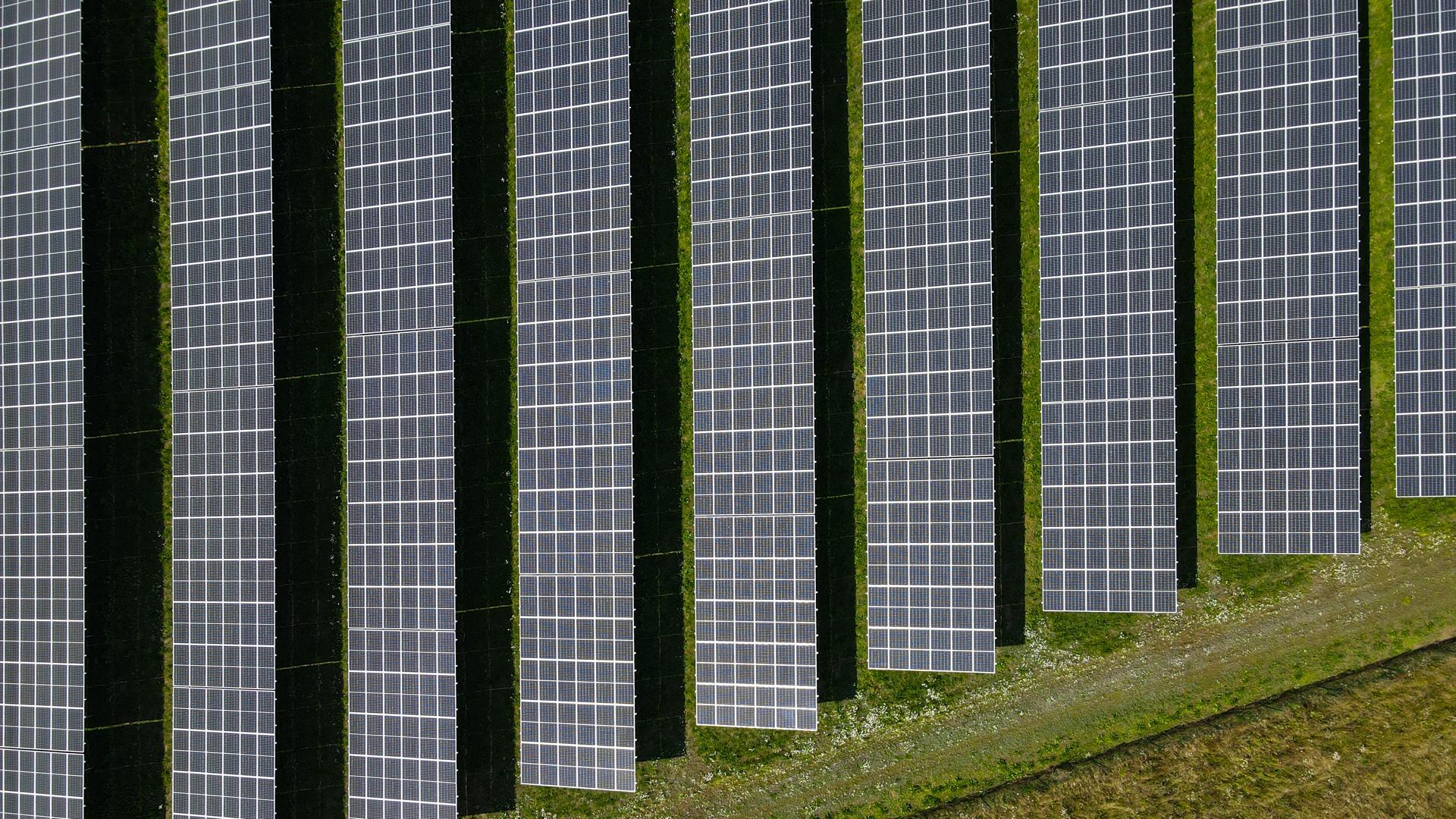
Wind- und Solarparks sollen die Energiewende voranbringen. Doch bei den Menschen vor Ort regt sich Widerstand, wie im kleinen Dorf Tempelfelde nahe Berlin. Seit dort ein riesiger Solarpark geplant ist, kochen die Emotionen hoch.
Ein Ponyhof in Tempelfelde, einem kleinen Dorf nördlich von Berlin: Juliane Uhlig und ihr Partner Steffen Baumann geben einigen Jugendlichen Reitunterricht. Die beiden sind mit Begeisterung bei der Sache. Mit dem Hof haben sie sich vor acht Jahren ihren Lebenstraum erfüllt, sagt Juliane.
"Alle Freunde, Bekannte, Familie haben uns für verrückt erklärt und haben gesagt: Ihr könnt doch nicht mit Mitte 40 nochmal so ein Riesenprojekt angehen. Ihr könnt doch nicht ganz von vorne wieder anfangen.“
Doch der Sog „von diesem Grundstück und von diesem Hof und von dieser Idee, mit den Kindern zu leben, mit den Pferden zu leben“ sei so groß gewesen, dass sie alle Warnungen in den Wind geschossen hätten, „und gesagt haben: Komm, wir gehen es doch an. Wir machen es. Wir kriegen das irgendwie hin.“
Und sie kriegten es hin. Auf ihrem „Tempelhof“ haben Juliane und Steffen mittlerweile 40 Islandponys. Rund ums Jahr bieten sie für Kinder und Jugendliche Reitunterricht, Wochenend- und Ferienfreizeiten an. Der Laden brummt.
Starkstromleitungen über dem Ponyhof
Nun, einige Jahre später, sehen sie diesen Traum bedroht: Der Gemeinderat will direkt angrenzend an Tempelfelde einen riesigen Solarpark bauen lassen. 200 Hektar Fläche stehen zur Rede. Das sind rund 280 Fußballfelder. Dabei stehen in unmittelbarer Umgebung des 400 Einwohner zählenden Dorfes bereits über 70 Windräder, ein weiterer Park mit fünf Windrädern, über 200 Meter hoch, wird demnächst in einem benachbarten Naturschutzgebiet gebaut.
Über den Hof von Juliane und Steffen führen bereits zwei Starkstromleitungen, eine dritte wird gerade gebaut. "Wir haben sozusagen mit Beschluss aus dem Amtsblatt erfahren, dass die Sache beschlossen wurde“, erzählt Juliane Baumann.
„Wir wurden nicht im Vorfeld informiert. Wir haben einige Gemeindevertreter, die bei uns hier eigentlich regelmäßig zu Gast sind, mit ihren Kindern, mit ihren Enkelkindern.“ Auch die hätten sie nicht angesprochen. „Es gab auch nach unserem Kenntnisstand keinen Aushang im Schaukasten. Also wir sind völlig überrascht"
Ein Lebenstraum platzt
Der Tempelhof steht auf einem schmalen rechteckigen Grundstück von fünf Hektar. Von drei Seiten würde der Solarpark das Gelände umschließen und lediglich eine schmale Seitenfläche frei lassen. Auch ein benachbarter Wildkatzenzoo würde von den Photovoltaik-Modulen weitgehend umzingelt werden.
"Wir wollten hier mit unseren Tieren leben. Wir wollten mit Kindern und den Tieren leben. Wir wollten Naturpädagogik machen.“ Dieser Lebenstraum platze jetzt gerade.
Überall in Deutschland trifft der Ausbau der erneuerbaren Energien auf Kritik und Widerstand von betroffenen Anwohnern. Die meisten Menschen sind zwar inzwischen davon überzeugt, dass eine Energiewende notwendig ist, um den Klimawandel aufzuhalten. Aber wo sollen die Anlagen gebaut werden – und in welcher Form? Anwohnern, die sich gegen Wind- und Solarparks zur Wehr setzen, wird häufig vorgeworfen, sie seien Nimbys: „Not in my backyard“, Energiewende gerne, aber bitte nicht vor meiner Tür.

Ein Windpark steht schon in Tempelfelde. Nun soll noch ein Solarpark gebaut werden.© picture alliance / dpa/ Paul Zinken
Das Phänomen gibt es natürlich. Zur Wahrheit gehört aber auch: Investoren und Planer von Windparks versprechen anliegenden Gemeinden und Bewohnern allzu häufig das Blaue vom Himmel, dass durch die Gewerbesteuer beträchtliche Summen in die klammen Gemeindekassen gespült würden.
In der Praxis zeigte sich dann schnell, dass aus verschiedensten Gründen dann doch keine oder nur sehr geringe Gewerbesteuer fließt. Das einzige, was den Bewohnern bleibt, sind die ewig drehenden Rotoren der Windräder.
Drohen mit den Solarparks dieselben Wildwest-Methoden? Seit vor einiger Zeit die Preise für Photovoltaikmodule in den Keller gefallen sind, fahnden Projektentwickler landauf, landab nach Orten für neue Solarparks. Je größer, desto besser.
Der Protest formiert sich
Vor allem im Nordosten der Republik – in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern – gibt es riesige Agrarflächen, die sich für Großanlagen eignen. Anders als bei Windparks, die überregional geplant werden, sind bei Solarparks die Kommunen zuständig. Das heißt, sie können entscheiden, ob, wo und wie groß gebaut wird.
"Wir haben jetzt fast 200 Unterschriften aus dem Dorf. Unterschriften, die dagegen sind, die den Solarpark hier so dicht am Ort nicht haben wollen“, sagt Juliane Uhlig. Sie will sich wehren und hat mit einigen Dorfbewohnern das „Barnimer Aktionsbündnis“ gegründet, um die Gemeinde davon zu überzeugen, die Planungen zu ändern.
Einer der Aktiven, Harald Höppner, hat vor einigen Jahren die Flüchtlingsrettungsorganisation Seawatch mitgegründet. Er ist erfahren im Umgang mit Behörden und mit Öffentlichkeitsarbeit. "Ich würde vorschlagen, dass wir eine Anfrage machen, ob man vielleicht die Turnhalle mieten kann“, schlägt Höppner vor. „Wir haben ja auch bald unsere Plakatwände. Da kann man groß dafür Werbung machen."
Juliane Uhlig und Harald Höppner sind nicht gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien, ganz im Gegenteil. Sie kritisieren aber, dass die Gemeindevertretung und die Projektentwickler an einem Ort, der schon sehr viel zur Energiewende beiträgt, zusätzlich noch einen der größten Solarparks Deutschlands bauen wollen. Zudem sollen die Module bis auf 100, 150 Meter ans Dorf reichen.
"Wir wohnen hier auf einem Dorf mit 300, 400 Einwohnern. Hier fährt am Sonntag kein Bus, am Samstag auch nicht. Wir haben keine Radwege. Wir haben keine Kinos. Wir haben keine weiteren kulturellen Einrichtungen“, führt Höppner führt aus.
„Das einzige, was wir hier noch haben, ist Freiraum und Kulturlandschaft. Deswegen engagieren wir uns auch dafür, dass das nicht komplett zerstört wird. Sonst gibt es gar keinen Grund mehr, hier auf dem Land zu leben, wenn wir umzingelt von Energieproduktion sind."
Lukrativ für den Landwirt
März 2020: Juliane Uhlig und Steffen Baumann hängen im Dorf Plakate auf und verteilen Flyer für eine Informationsveranstaltung. Damit wollen sie die Bewohner mobilisieren. Im Dorfzentrum treffen sie zufällig Jürgen Giese. Der Landwirt hat das Solarprojekt maßgeblich initiiert. Er ist im Gemeinderat – und er besitzt große Flächen in Tempelfelde. Ein großer Teil der Photovoltaik-Module würde auf seinem Land stehen, was ihn zu einem der Hauptprofiteure des Parks machen würde.
Rund 1500 und 3000 Euro Pacht bieten Solarfirmen Landeigentümern an, pro Hektar und Jahr. Der Gewinn aus konventioneller Landwirtschaft ist in Brandenburg erheblich niedriger. Pro Hektar vielleicht ein Zehntel der Summe. Wenig erstaunlich, wenn Eigentümer ihre Flächen bereitwillig für erneuerbare Energien zur Verfügung stellen.
"Hallo! Können wir euch auch einladen? Wir verteilen Flyer im Ort“, geht Uhlig auf den Landwirt zu. „Wir möchten gern nochmal mit den Gemeindevertretern ins Gespräch kommen, bezüglich des Solarparks. Am Donnerstag, vor der Gemeindevertretersitzung sammeln wir uns alle ein bisschen, und versuchen dann noch einmal ins Gespräch zu kommen"
Der Solarpark sei ja bisher nur ausgewiesen, entgegnet Giese. Wie und was gebaut werde, sei ja noch gar nicht beschlossen. „Ob der jetzt 200 Hektar groß wird oder 50 Hektar oder 30 Hektar oder zehn Hektar. Das weiß doch kein Mensch jetzt." Trotzdem seien sie „ein bisschen überrascht und überrumpelt worden durch die Veröffentlichung im Amtsblatt", wiederholt Uhlig.
"Da war vorher eine Einladung da.“
"Also bei uns nicht. Wir haben keine Einladung bekommen."
"Da war vorher eine Einladung da.“
"Also bei uns nicht. Wir haben keine Einladung bekommen."
Im Amtsblatt würden die Themen behandelt und aufgeschrieben, meint Giesen: „Nächste Sitzung ist das und das Thema. Da sollte man auch mal hinkommen. Das ist unsere Öffentlichkeitsarbeit.“ Ein Wort gibt das andere. Jürgen Giese wehrt sich. Schließlich stehe es jedem frei, zu den Gemeinderatssitzungen zu kommen. Aber es sei ja nie einer da, „oder ganz, ganz wenige“. Das werde sich nun ändern, meint Uhlig. "Wenn hier nicht das Dorf ausverkauft werden soll an die großen Energiekonzerne, dann müssen wir uns zusammensetzen."
Aber was für Alternativen gebe es, entgegnet Giese. „Strom aus Polen holen von Atomkraftwerken, die wir überhaupt nicht haben wollen?“
"Flächen zu bebauen, wo nicht die Anwohner so unmittelbar betroffen sind."
"Flächen zu bebauen, wo nicht die Anwohner so unmittelbar betroffen sind."
Die Erde vor dem Klimakollaps bewahren
Auch Simone Krauskopf, die Bürgermeisterin der Gemeinde Sydower Fließ, zu der Tempelfelde gehört, kritisiert, dass sich in der Vergangenheit kaum ein Bewohner für die lokale Politik interessiert habe, geschweige denn engagiert. Jetzt sei die Aufregung plötzlich groß.
Dabei sei noch gar nichts beschlossen, sondern lediglich ein erster Schritt gemacht. Überdies gehe es darum, die Welt vor dem Klimakollaps zu bewahren.
„Menschen, die dagegen sind, wirken auf mich wie zwei Möglichkeiten: Entweder sie ignorieren die Krankheit und verweigern die Therapie. Oder aber, sie erkennen die Krankheit an und verweigern die Therapie trotzdem.“ Das sei ein Riesenproblem. „Ich weiß nicht, was noch passieren muss, damit das Persönliche zurücktreten kann."

Auch Tiger Heike und Diego könnten durch den Solarpark gestört werden, fürchtet das Wildkatzen- und Artenschutzzentrum Barnim.© picture alliance / dpa / Patrick Pleul
Die Bürgermeisterin ist durchaus bereit, auf die Kritiker des Solarparks zuzugehen. "Der Tempelhof, der hat Sorge, dass die ihren Betrieb nicht mehr aufrechterhalten können.“ Und das Wildkatzenzentrum befürchte, dass die dort seltenen Arten unfruchtbar werden könnten.
„Auch das werden Gespräche, die jetzt in der Folge stattfinden werden. Nämlich: Wie genau wird beplant? Ist es vielleicht möglich, dass Erweiterungen sogar im Gelände der jeweiligen Betreiber möglich sind, in Absprache mit den Eigentümern? "
Die Fronten verhärten sich
Die folgenden Gespräche bringen aber keine Klärung. Im Gegenteil, die Fronten verhärten sich. Vor Kurzem hat der Gemeinderat dem Bau von Windrädern in einem angrenzenden Naturschutzgebiet zugestimmt. Eine Bürgerinitiative hatte im Beteiligungsverfahren zahlreiche Einwände dagegen vorgebracht, keiner wurde akzeptiert.
Die Akteure des „Barnimer Aktionsbündnis“ befürchten, dass es beim Solarpark genauso laufen könnte. Sie haben deshalb eigene, alternative Ideen entwickelt. Der Solarpark könnte zum Beispiel kleiner ausfallen oder auf Flächen gebaut werden, die weiter vom Dorf und vom Ponyhof entfernt sind.
Bei einer Infoveranstaltung auf der zentralen Dorfwiese stellt Matthias Kuhnt diese Ideen vor. "Wir lehnen das nicht komplett ab, eine solche Anlage“, betont er. „Wir möchten aber, dass das an einen Ort verschoben wird, wo die Bürger unserer Gemeinde möglichst wenig davon beeinträchtigt werden.“
Und da könne man sich dann schon einmal fragen: „Was war denn jetzt eigentlich der Grund für genau diese Flächenauswahl? Denn Tempelfelde hat ein großes Planungsgebiet. Es wären durchaus Flächen möglich gewesen, die weiter weg von der Wohnbebauung liegen. Am Ende kann man sich natürlich auch fragen, wer von den getroffenen Entscheidungen profitiert."
Anfeindungen nehmen zu
Rund 50 Bewohner sind zu der Veranstaltung gekommen. Das Großprojekt, das rund 100 Millionen Euro kosten soll, sorgt für Kontroversen. Die Bürgermeisterin und der Landwirt Jürgen Giese sind nicht auf der Veranstaltung. Der Landwirt, der finanziell wahrscheinlich am meisten vom Solarpark profitieren würde, wird inzwischen von einigen Dorfbewohnern angefeindet.
Einer befand, man solle ihn mit dem Dreschflegel aus dem Dorf jagen. Gegen die Bürgermeisterin wurde bei der Kommunalaufsicht eine Anzeige wegen Machtmissbrauch eingereicht. Kritikern des Solarparks wird im Gegenzug vorgeworfen, Betonköpfe zu sein und zur Atomlobby zu gehören.
Manche Journalisten vergleichen Tempelfelde schon mit Unterleuten, der fiktiven Brandenburger Gemeinde aus dem Roman von Juli Zeh. Bürgermeisterin Krauskopf findet den Vergleich unangebracht. „Da gab es einen korrupten Bürgermeister. Ich bin nicht ‚Unterleuten‘, und die Gemeindevertreter sind auch nicht ‚Unterleuten‘."
Im Laufe des Sommers wird ein Chatverlauf geleakt. Aus dem geht hervor, dass die Bürgerinitiative unter Druck gesetzt werden soll.
"Unsere Gemeindevertreter haben eine Chat-Gruppe, in der sie Dinge, die sie zu Gemeindevertretungssitzungen besprechen müssen, absprechen, also Termine, wann man sich wo trifft und so weiter“, erläutert Juliane Uhlig.
„Und in diesem Chat wurde sich darüber ausgetauscht, wie man denn die Mitglieder der Bürgerinitiative, gerade die sehr aktiven Mitglieder der Bürgerinitiative, ein bisschen mäßigen könnte, und wie man die so ein bisschen mundtot machen kann. Und eine der Ideen war, man könnte doch diesen sehr aktiven Bürgern der Bürgerinitiative das Bauamt auf den Hals hetzen."
Besonders betroffen sind Unternehmer, auf deren Gewerbeflächen man vielleicht irgendwelche Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben finden könnte. "Bei uns haben sie keine Vorortbegehung durchgeführt“, erzählt Juliane Uhlig. Aber bei drei anderen Mitgliedern der Bürgerinitiative hätten Vorortbegehungen stattgefunden, Stilllegung sei angedroht worden.
„Denn die Gemeindevertretung hat sich aktiv schriftlich ans Bauamt gewendet und gebeten, bei Person X, bei Person Y eine Überprüfung vorzunehmen. Darüber gibt es Beweismaterial, also schriftliche Ausdrucke der Emails. Denn unser Anwalt hat Akteneinsicht beantragt und hat also geguckt, durch wen sozusagen diese Überprüfungen initiiert wurden."
Viele Jahre sind die Bewohner von Tempelfelde miteinander ausgekommen – mit den kleineren oder größeren Unstimmigkeiten, wie es sie in jedem Dorf so gibt. Nun droht der Solarpark die Dorfgemeinschaft zu zerrütten.
Was sagen die Projektentwickler von Notus und Boreas dazu? Beide Unternehmen haben vor einigen Jahren bereits Windräder bei Tempelfelde gebaut und betreiben sie zum Teil. Die Planer kennen das Dorf, den Gemeinderat, die Bürgermeisterin. Wie kann es sein, dass sie mit vielen Landeigentümern gesprochen haben, ob sie ihre Flächen zur Verfügung stellen, aber nicht mit denen, die am meisten betroffen sind: den Betreibern des Ponyhofs sowie des benachbarten Wildtierzoos?
"Vor der Veröffentlichung im Amtsblatt gab es zwei Veranstaltungen im letzten Jahr, in der wir vor allen Gemeindevertretern das Projekt zum ersten Mal vorgestellt haben, ganz offiziell“, sagt André Bartz von Notus. Bürger seien wegen anderer Themen gekommen. Beispielsweise sei es um die Kita-Gebühren gegangen. „Mehr können wir dann an der Stelle auch nicht tun, als darauf hinweisen und an die Gemeinde herantreten und das dann mehrmals vorstellen."
Nachdem die Proteste der Anwohner aufflammten, gingen die Projektentwickler schließlich auf diese zu. Mit den Betreibern des Wildtierzoos kamen sie überein, dass die Photovoltaikmodule einen größeren Abstand zum Zoo haben sollen und dass eine Hecke zwischen Solarpark und Tiergehegen gebaut wird.
Juliane Uhlig und Steffen Baumann waren mit den Kompromissvorschlägen nicht zufrieden. Gemeinsam mit der Bürgerinitiative fordern sie weitergehende Änderungen. Projektentwickler André Bartz sieht das kritisch. "Was ich mir wünschen würde, im gesamtdeutschen Kontext, ist, dass wir von diesen kleinteiligen Befindlichkeiten weggehen und uns als Gesellschaft in Deutschland, wenn nicht sogar auf der Welt, als Bio-Organismus verstehen“, meint er.
„Wir können nicht immer auf alle Belange zugehen und sie berücksichtigen. Wenn wir das machen würden, hätten wir in Deutschland immer noch die Pferdekutsche. Es wird immer, immer, immer jemanden geben, der davon einen Nachteil hat."
Schlechte Erfahrungen mit Windparks
Die Bekämpfung des Klimawandels ist eine der größten Herausforderungen Deutschlands, ja der ganzen Welt. Es ist unbestritten, dass das ohne eine Energiewende nicht gelingen kann.
Ein Grund, dass dem Ausbau der regenerativen Energien inzwischen Widerstand entgegengebracht wird, sind die schlechten Erfahrungen, die viele Gemeinden gemacht haben. Bislang waren vor allem Windparks davon betroffen, berichtet Thomas Gottschalk. Er berät Kommunen bei der Planung von Solarprojekten.
"Die Leute fühlen sich total veräppelt von diesen Windkraftanlagen. Man hört immer wieder: Ja, aber wir zahlen die höchsten Strompreise hier in Brandenburg, weil die Durchleitungsgebühren so hoch sind“, erzählt er. „Weil: Wenn der Wind weht, aber der Strom nicht wegkann, dann wird die Anlage abgeschaltet. Die Kosten für diese Abschaltung zahlen die Bürger in Brandenburg, wo das Netz überlastet ist, und den Ausgleich zahlen muss an die Betreiber von den Windparks."
Im Jahr 2018 erhielten Brandenburgs Windkraftbetreiber über 40 Millionen Euro Ausgleichszahlungen für Windräder, die abgestellt werden mussten. Bundesweit waren es sogar fast 1,5 Milliarden Euro. Alles bezahlt von den Stromkunden.
"Und gleichzeitig wird wenig Gewerbesteuer bezahlt, wird ganz viel Mauschelei betrieben, wenn es darumkommt, Gewerbesteuer vor Ort abzudrücken. Und die Leute sagen: Hey, wir haben die visuelle Belastung, wir haben teilweise die Lärmbelastung, wir haben die finanzielle Belastung und wir haben keinen finanziellen Ausgleich. Energiewende war ein Reinfall. "
Bürger vor Ort müssen profitieren
Gottschalk setzt sich dafür ein, dass beim Ausbau der Sonnenenergie nicht die gleichen Fehler gemacht werden wie bei der Windkraft. Er ist davon überzeugt, dass die Energiewende nur gelingen kann, wenn die Bürger vor Ort mitgenommen werden. Das heißt, sie sollten auch finanziell von den Anlagen profitieren, und nicht nur die Investoren und Betreiber.
Nach langen Diskussionen hat die Bundesregierung 2021 endlich den Weg dafür freigemacht, dass Kommunen an den Gewinnen der Wind- und Solarparks beteiligt werden können. Davor war das juristisch fast nicht möglich.
"Ich finde es eine richtig tolle Situation“, so Gottschalk. „Da haben wir plötzlich die Chance, dass solche Landstriche, die wir hier oft in Brandenburg haben, die ja eher ärmlicher sind, wo es nicht besonders viel Gewerbeeinnahmen gibt, plötzlich die Möglichkeit haben, dass sie durch diese Energiewende einfach sehr viel Geld eingespielt wird. Es gibt hier eine Gemeinde in der Nachbarschaft, da wird eine sehr große Anlage geplant. Aber da wird es dann dazu kommen, dass die Gemeinde jedes Jahr 1,2 oder 1,3 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen haben wird. Bei einem kompletten Etat von acht Millionen Euro für die ganze Gemeinde plus 1,3 Millionen, das ist extrem viel Geld. "
Mehr Biodiversität im Solarpark
Nicht nur die finanzielle Beteiligung der Bürger ist wichtig. Häufig werden Solarparks kritisiert, weil sie die Natur beeinträchtigen, weil sie landwirtschaftliche Flächen rauben, oder weil sie unansehnlich sind. Doch um Solarparks lassen sich Hecken pflanzen. Die verstellen nicht nur den Blick auf die Module, sondern sie bieten auch Insekten und Vögeln Lebensraum, stellt Thomas Gottschalk heraus: "Ich bin neulich mal von einem Dorf ins nächste gelaufen. Über den Feldweg, rechts war 3,50 Meter Mais hoch, links war 3,50 Meter Mais hoch.“
Ein Solarpark sei dagegen ein Paradies für die Biodiversität, „wenn man ihn richtig baut. Da findet keine Versiegelung statt. Da werden paar Pfosten in die Erde reingerammt. Die kann man sehr schnell wieder zurückbauen. Gleichzeitig hat man den Vorteil, dass keine Pestizide mehr aufgetragen werden in so einem Solarpark, dass keine Düngung stattfindet. Wir haben also keine Belastung der Grundwasserschichten durch eine Überdüngung.
Das ist wie eine Kur für einen Boden, dass er eben nicht mehr intensiv genutzt wird durch konventionelle Landwirtschaft, sondern dass er ganz extensiv benutzt wird. Es baut sich eine Humusschicht auf über die Jahre, und es findet praktisch eine Entgiftung des Bodens statt."

Wo eine Solaranlage steht, können sich überdüngte Böden erholen, Wildblumen können wachsen.© picture alliance / dpa / Patrick Pleul
Einer Selbstverpflichtung des Bundesverbandes Neue Energien zu Folge sollten Solarparks vor allem auf Flächen mit intensiver Landwirtschaft oder auf nährstoffarmen Böden gebaut werden. Die Flächen sollten zudem so gestaltet werden, dass sie die Artenvielfalt von Flora und Fauna erhöhen. Dazu lassen sich zum Beispiel Streuobstwiesen, Gehölze, Hecken, Feuchtgebiete oder Nistkästen anlegen. Unter den Modulen können zum Beispiel Schafe oder Bienen gehalten werden.
Der Solarberater Thomas Gottschalk sollte ursprünglich auch die Gemeinde Tempelfelde beraten. Am Ende kam es aber nicht dazu. Die Gemeindeverwaltung hat kein Interesse mehr daran, wie Juliane Uhlig von der Bürgerinitiative beklagt.
"Wir aus der Bürgerinitiative haben auch angeboten, dass wir ihn privat bezahlen würden, damit er uns zusammenbringt: Die Gemeindevertretung, die Bürgerinitiative, dass wir zusammen an einen Tisch kommen, über das Projekt beraten, über Vor- und Nachteile."
Tatsächlich hat die Bürgermeistern den Berater angefragt. Bei einem Projekt dieser Größe würden die Consultingkosten aber eine sechsstellige Summe betragen. Normalerweise müssten sie die Projektplaner bezahlen. Ohne Druck von Seiten der Gemeinde wird aber kein Planer solche Kosten freiwillig übernehmen.
Und wie wird die Gemeinde Tempelfelde von dem Solarpark profitieren? Die Projektentwickler von Notus und Boreas betonen, dass die Planungen noch ganz am Anfang sind. Vieles sei noch Aushandlungssache. "Natürlich machen wir uns darüber Gedanken, wie wir sie beteiligen und in welcher Höhe.“ Das hänge allerdings stark davon ab, wie der Planungsprozess weitergehe.
„Vor allen Dingen natürlich, wie groß der Park wird. Das hat dann Auswirkung auf die finanzielle Beteiligung. Aber wir bekennen uns deutlich dazu, dass wir das machen wollen und auch machen werden“, sagt André Bartz.
Ein großes Projekt für eine kleine Gemeinde
Ende Oktober 2021 gerät das Planungsverfahren plötzlich ins Stocken. Der Gemeinderat will auf einer Sitzung einen städtebaulichen Vertrag verabschieden. Dieser soll die Zusammenarbeit zwischen Kommune und den Projektentwicklern abstecken. Unter anderem werden darin Fragen der Haftung und des Rückbaus der Anlage geklärt, und dass der Vertrag eine Laufzeit von 49 Jahren haben soll. Bei Veröffentlichung des Vertrags sind es nur noch wenige Tage bis zur Gemeindevertretersitzung.
Die Bürgerinitiative beauftragt in aller Hektik einen Anwalt, der den Vertragsentwurf begutachten soll. Sein Urteil ist – vernichtend. In der Stellungnahme heißt es:
"Der als Entwurf beigefügte städtebauliche Vertrag weist gleich an mehreren Stellen deutliche Mängel und Defizite auf, die mit rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken zulasten der Gemeinde behaftet sind. Wir können nicht empfehlen, den Vertrag in der vorliegenden Fassung zu verwenden.
Insgesamt deutet alles darauf hin, dass der Vertrag stark übereilt erstellt wurde, gegebenenfalls getragen von der Absicht, die Angelegenheit möglichst zügig zu einem Abschluss zu bringen. Allein die Dimension des PV-Projekts macht jedoch deutlich umfassende und präzisere Regelungen erforderlich. Der Vertrag entspricht auch nicht den üblicherweise in vergleichbaren Projekten anzutreffenden Mindestanforderungen beziehungsweise Standards."
Der Anwalt Jasper von Detten denkt, dass die Gemeindevertreter wahrscheinlich überfordert sind mit der Thematik. Aus seiner Sicht wäre es sinnvoll, wenn die Gemeinde externe und unabhängige Berater engagieren würde. Schließlich sei dies ein „relativ großes Projekt für eine relativ kleine Gemeinde. Das sind alles ehrenamtliche Vertreter. Von denen kann man nicht verlangen, dass das sozusagen alles Volljuristen sind und dann auch noch im Bereich des Städteplanungs- und Bebauungsplanungsrechts versiert. Wenn wir Projekte als Kanzlei begleiten würden, würden wir niemals auf die Idee kommen, Verträge dieser Art abzuschließen."
Entscheidung wird verschoben
In der Gemeinderatsitzung beantragen schließlich mehrere Mitglieder, die Verabschiedung des städtebaulichen Vertrags zu verschieben. Sie wollen mehr Zeit haben, um sich mit dem Vertrag und dem gesamten Projekt zu befassen. Nach einer emotional geführten Diskussion stimmen die Gemeindevertreter außerdem mit 7:1 Stimmen dafür, dass eine von der Bürgerinitiative gewünschte Bürgerbefragung stattfinden soll.
Die Bürgermeisterin Simone Krauskopf will die Bewohner durchaus am Prozesse beteiligen. Die geplante Bürgerbeteiligung sieht sie aber skeptisch. "Wenn von 500 Wahlberechtigten 100 hingehen und davon sind 80 gegen den Solarpark, dann kann ich mich als Gemeinde natürlich fragen: Ist das repräsentativ? Und eine Bürgerbefragung, das ist ein Meinungsbild, dem rein rechtlich die Gemeindevertretung nicht folgen muss. Dann kannst du sagen: Dieses Meinungsbild ist mir so wichtig, dann lassen wir das. Oder aber du sagst, das Meinungsbild ist doch nicht repräsentativ. Oder wir sehen die massiven Vorteile für die Gemeinde, auch rein monetär. Dann sagen wir: Für die Gemeinde ist es gut, wenn wir unseren Haushalt sanieren können mit den Einnahmen aus der Anlage."
Das „Barnimer Aktionsbündnis“ ist jedenfalls zufrieden. "Es ist genau da, wo wir hinwollten“, erläutert Harald Höppner. „Dass sich die Gemeinde intensiv mit den Entscheidungen beschäftigt, die Dokumente liest, kritische Fragen stellt. An dem Punkt sind wir jetzt angekommen. Da sind wir alle froh.“ Zumindest bis auf weiteres. Die Bürgerbefragung wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 ausgewertet sein. Dann wird sich zeigen, wie es weitergeht.






