Streit um Götter- und Menschenbilder
Friedrich Wilhelm Graf fragt in "Missbrauchte Götter" nach den Hintergründen des Streits um Götter- und Menschenbilder. Dabei geht es um die zivilisierende Wirkung der Religion genau wie um ihre zerstörerische Seite.
Es ist gut, dass dieses Buch endlich geschrieben ist. Und es ist gut, dass Friedrich Wilhelm Graf es geschrieben hat. Denn Graf ist nicht nur ein Theologe mit historischem Beschlag, er ist auch ein eifriger Bilderstürmer.
"Die suggestive Eigenmacht der Bilder liegt darin, sich gegenüber ihren Produzenten zu verselbständigen. Dann wird geglaubt, im Menschenbild selbst erschließe sich Normativität. Aber dies kann immer nur die Normativität sein, die der Menschenbildner in sein Bild eingezeichnet hat."
Dass die Diskussion über die Menschenwürde zu einem Menschenbilderstreit werden konnte, ist das Werk der Kirchen. Indem sie die Menschenwürde zur Aureole eines christlichen Menschenbildes erheben, verpflichten sie das Grundgesetz auf die kirchliche Lehre. So rührt der moderne Bilderstreit an Fragen des Dogmas, wie schon der Bilderstreit im Byzantinischen Reich. In jener Epoche schärft Graf seinen Griffel für den Sturm auf das Menschenbild des Grundgesetzes.
Christusbilder werden überhaupt erst möglich, als die kirchliche Zweinaturenlehre das alttestamentliche Bilderverbot außer Kraft setzt. Christus vereint in seiner Person die göttliche Natur und die menschliche. Das göttliche Wort wird nun sichtbar, einmal durch die Fleischwerdung im Menschen, dann durch das malerische Festhalten der Fleischwerdung in der Ikone.
Graf führt Johannes von Damaskus an, den Kirchenvater des byzantinischen Bilderstreits. Gewiss, der Maler kann die göttliche Natur Jesu Christi nicht visualisieren. Aber indem er den Heiland in seiner menschlichen Gestalt zeige, bringe er, aufgrund der manifesten Einheit beider Naturen, indirekt auch die göttliche zur Darstellung."
Die Kirche hat nun ein Christusbild und ein Menschenbild. Beide sind normativ in höchstem Maße. Denn durch die Nachahmung Christi soll der Mensch dem menschgewordenen Gott ähnlich werden. So sieht es die orthodoxe Theologie vor. Nach dem Sündenfall hat der Mensch zwar seine Ähnlichkeit mit Gott verloren, ist aber Gottes Ebenbild (Imago Dei) geblieben. Anders die protestantische Theologie. Hier setzt Graf an, um das moderne Menschenbild der Evangelischen Kirche zu zerkratzen:
"Gern argumentieren lutherische Spitzenfunktionäre wie der bayerische Landesbischof Johannes Friedrich oder Margot Käßmann, die Bischöfin der Hannoverschen Landeskirche, in aktuellen biopolitischen Kontroversen mit ‚der Ebenbildlichkeit‘ des Menschen, um einen ‚absoluten Würdeschutz‘ für totipotente embryonale Stammzellen zu begründen. Aber dieser gedankenlose Gebrauch der Imago Dei lässt nur einen erheblichen Mangel an theologischer Bildung und blanke Unkenntnis der eigenen Bekenntnisschriften erkennen."
Denn nach Luther hat der Mensch nach dem Sündenfall die Ebenbildlichkeit eingebüßt und kann sie auch durch Taufe nicht zurückgewinnen. Bleibt nur noch das katholische Menschenbild zu stürmen. Zunächst begibt sich Graf in die Geschichte des Begriffs. Fündig wird er bei Johann Gottfried Herder, für den ‚Menschenbild‘ gleichbedeutend ist mit Ebenbild Gottes. Politischer Kampfbegriff wird das Menschenbild aber erst später.
"Nach dem Ersten Weltkrieg dient der Begriff in allen politisch-kulturellen Milieus dazu, das definitive Ende der bürgerlich-liberalen Welt mit ihrem ‚autonomen Individuum‘ zu verkünden und ein neues, stärker ‚gemeinschaftsgebundes Konzept zu entwerfen."
Obwohl auch die Nationalsozialisten gern vom ‚Menschenbild’ sprechen, wird der Begriff nach 1945 am höchsten gehängt. Er dient nun den Kirchen dazu, Westdeutschland zum Christentum rückzubiegen:
"So wird die Aufklärung zum Beginn einer Verfallsgeschichte des ‚Menschenbildes‘ erklärt, die im Nationalsozialismus ihren bisherigen Tiefpunkt erreicht habe. Auf den Bühnen im großen Menschenbildtheater spielt der ‚prometheische Mensch‘ nun den brutalen Verbrecher, und der ‚abendländische‘, ‚christliche‘ Mensch besetzt die Rolle des Retters."
Prometheus, der Anmaßende, hat das christliche Menschenbild abgefackelt. Sein christlicher Bruder, der nachdenkliche Epimetheus, stellt ein neues auf, den Bürgern Westdeutschlands zum Vorbilde. Doch das Gottesgeschenk erweist sich als Büchse der Pandora. Über die Deutschen kommt statt des verhofften Liberalismus eine neue Bindung an die Gemeinschaft. Schuld daran sind die Menschenbildner des katholischen Naturrechts, allen voran der Soziallehrer und Jesuit Oswald von Nell-Breuning mit seinem ‚solidaristischen Menschenbild’.
Sogar das Bundesverfassungsgericht entscheidet im berühmten Investitionshilfe-Urteil 1954 mit Blick auf das "Menschenbild des Grundgesetzes". Seither wachen die Kirchen als "Diskurspolizisten" über die Menschenwürde. Zu Unrecht, findet Graf.
"Die beiden großen Kirchen im Lande haben ‚die Menschenwürde‘ weithin erst entdeckt, als sie im Rechtssystem der Bundesrepublik bereits zur ‚Grundnorm‘ avanciert war."
Daher fordert Graf die Kirchenleute dazu auf, "die primäre rechtliche Auslegungskompetenz" für die Menschenwürde den Verfassungsrechtlern zu überlassen. Sekundär dürften sie den höchsten Wert der Verfassung mit ihrem eigenen Dogma noch erhöhen. Hier wäre die Kirche besser beraten, eine Protestation vorzunehmen. Aus der Menschenwürde kann nur herausgelesen werden, was "die Väter und Mütter der Verfassung" in sie hineingeschrieben haben. Aber manch einer hat schon Gottes Wort in einem Menschenbild erblickt - wenn er wie Kirchenvater Johannes von Damaskus nur Augen dafür hatte.
Friedrich Wilhelm Graf: Missbrauchte Götter. Zum Menschenbilderstreit in der Moderne
C.H. Beck, München 2009
"Die suggestive Eigenmacht der Bilder liegt darin, sich gegenüber ihren Produzenten zu verselbständigen. Dann wird geglaubt, im Menschenbild selbst erschließe sich Normativität. Aber dies kann immer nur die Normativität sein, die der Menschenbildner in sein Bild eingezeichnet hat."
Dass die Diskussion über die Menschenwürde zu einem Menschenbilderstreit werden konnte, ist das Werk der Kirchen. Indem sie die Menschenwürde zur Aureole eines christlichen Menschenbildes erheben, verpflichten sie das Grundgesetz auf die kirchliche Lehre. So rührt der moderne Bilderstreit an Fragen des Dogmas, wie schon der Bilderstreit im Byzantinischen Reich. In jener Epoche schärft Graf seinen Griffel für den Sturm auf das Menschenbild des Grundgesetzes.
Christusbilder werden überhaupt erst möglich, als die kirchliche Zweinaturenlehre das alttestamentliche Bilderverbot außer Kraft setzt. Christus vereint in seiner Person die göttliche Natur und die menschliche. Das göttliche Wort wird nun sichtbar, einmal durch die Fleischwerdung im Menschen, dann durch das malerische Festhalten der Fleischwerdung in der Ikone.
Graf führt Johannes von Damaskus an, den Kirchenvater des byzantinischen Bilderstreits. Gewiss, der Maler kann die göttliche Natur Jesu Christi nicht visualisieren. Aber indem er den Heiland in seiner menschlichen Gestalt zeige, bringe er, aufgrund der manifesten Einheit beider Naturen, indirekt auch die göttliche zur Darstellung."
Die Kirche hat nun ein Christusbild und ein Menschenbild. Beide sind normativ in höchstem Maße. Denn durch die Nachahmung Christi soll der Mensch dem menschgewordenen Gott ähnlich werden. So sieht es die orthodoxe Theologie vor. Nach dem Sündenfall hat der Mensch zwar seine Ähnlichkeit mit Gott verloren, ist aber Gottes Ebenbild (Imago Dei) geblieben. Anders die protestantische Theologie. Hier setzt Graf an, um das moderne Menschenbild der Evangelischen Kirche zu zerkratzen:
"Gern argumentieren lutherische Spitzenfunktionäre wie der bayerische Landesbischof Johannes Friedrich oder Margot Käßmann, die Bischöfin der Hannoverschen Landeskirche, in aktuellen biopolitischen Kontroversen mit ‚der Ebenbildlichkeit‘ des Menschen, um einen ‚absoluten Würdeschutz‘ für totipotente embryonale Stammzellen zu begründen. Aber dieser gedankenlose Gebrauch der Imago Dei lässt nur einen erheblichen Mangel an theologischer Bildung und blanke Unkenntnis der eigenen Bekenntnisschriften erkennen."
Denn nach Luther hat der Mensch nach dem Sündenfall die Ebenbildlichkeit eingebüßt und kann sie auch durch Taufe nicht zurückgewinnen. Bleibt nur noch das katholische Menschenbild zu stürmen. Zunächst begibt sich Graf in die Geschichte des Begriffs. Fündig wird er bei Johann Gottfried Herder, für den ‚Menschenbild‘ gleichbedeutend ist mit Ebenbild Gottes. Politischer Kampfbegriff wird das Menschenbild aber erst später.
"Nach dem Ersten Weltkrieg dient der Begriff in allen politisch-kulturellen Milieus dazu, das definitive Ende der bürgerlich-liberalen Welt mit ihrem ‚autonomen Individuum‘ zu verkünden und ein neues, stärker ‚gemeinschaftsgebundes Konzept zu entwerfen."
Obwohl auch die Nationalsozialisten gern vom ‚Menschenbild’ sprechen, wird der Begriff nach 1945 am höchsten gehängt. Er dient nun den Kirchen dazu, Westdeutschland zum Christentum rückzubiegen:
"So wird die Aufklärung zum Beginn einer Verfallsgeschichte des ‚Menschenbildes‘ erklärt, die im Nationalsozialismus ihren bisherigen Tiefpunkt erreicht habe. Auf den Bühnen im großen Menschenbildtheater spielt der ‚prometheische Mensch‘ nun den brutalen Verbrecher, und der ‚abendländische‘, ‚christliche‘ Mensch besetzt die Rolle des Retters."
Prometheus, der Anmaßende, hat das christliche Menschenbild abgefackelt. Sein christlicher Bruder, der nachdenkliche Epimetheus, stellt ein neues auf, den Bürgern Westdeutschlands zum Vorbilde. Doch das Gottesgeschenk erweist sich als Büchse der Pandora. Über die Deutschen kommt statt des verhofften Liberalismus eine neue Bindung an die Gemeinschaft. Schuld daran sind die Menschenbildner des katholischen Naturrechts, allen voran der Soziallehrer und Jesuit Oswald von Nell-Breuning mit seinem ‚solidaristischen Menschenbild’.
Sogar das Bundesverfassungsgericht entscheidet im berühmten Investitionshilfe-Urteil 1954 mit Blick auf das "Menschenbild des Grundgesetzes". Seither wachen die Kirchen als "Diskurspolizisten" über die Menschenwürde. Zu Unrecht, findet Graf.
"Die beiden großen Kirchen im Lande haben ‚die Menschenwürde‘ weithin erst entdeckt, als sie im Rechtssystem der Bundesrepublik bereits zur ‚Grundnorm‘ avanciert war."
Daher fordert Graf die Kirchenleute dazu auf, "die primäre rechtliche Auslegungskompetenz" für die Menschenwürde den Verfassungsrechtlern zu überlassen. Sekundär dürften sie den höchsten Wert der Verfassung mit ihrem eigenen Dogma noch erhöhen. Hier wäre die Kirche besser beraten, eine Protestation vorzunehmen. Aus der Menschenwürde kann nur herausgelesen werden, was "die Väter und Mütter der Verfassung" in sie hineingeschrieben haben. Aber manch einer hat schon Gottes Wort in einem Menschenbild erblickt - wenn er wie Kirchenvater Johannes von Damaskus nur Augen dafür hatte.
Friedrich Wilhelm Graf: Missbrauchte Götter. Zum Menschenbilderstreit in der Moderne
C.H. Beck, München 2009
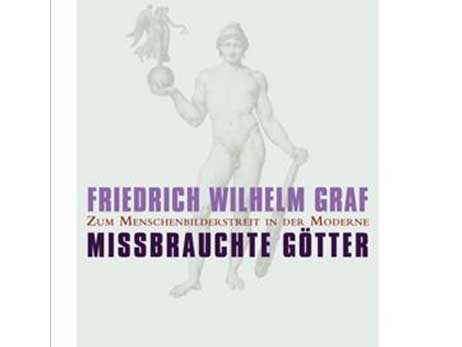
Cover: "Friedrich Wilhelm Graf: Missbrauchte Götter"© C. H. Beck
