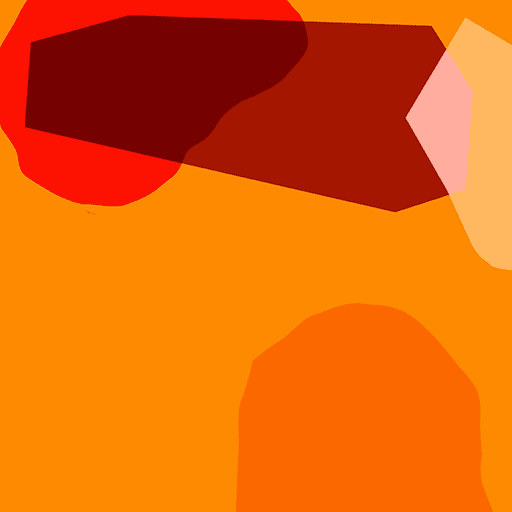Die Hölle auf Erden – Wie vom Krieg erzählen?

Die Kriegsberichterstattung benennt die Gräuel zwar, jedoch in Erzählkonventionen, die das Geschehen äußerlich beschreiben. Die Literatur muss das Unvorstellbare in Worte übersetzen, uns den nackten Krieg so schildern, dass wir begreifen, was hier eigentlich geschieht.
Was im Krieg geschieht, können wir uns nicht vorstellen. Es ist eine andere, fremde Wirklichkeit. Über den Krieg schreiben, heißt, das Unvorstellbare in Worte zu fassen, es damit, vielleicht, vorstellbar zu machen. In Deutschland gibt es kaum mehr Autoren, die den Krieg, über den sie schreiben, noch selbst erlebt haben. Autoren aus anderen Ländern dagegen schreiben direkt aus dem Krieg über den Krieg. Serhij Zhadan erzählt vom Krieg in der Ukraine, Khaled Khalifa vom Krieg in Syrien und Elvira Dones vom fast schon vergessenen Kosovo-Krieg. Ihre Romane erzählen von dem, was der Krieg mit den Menschen macht, sie erzählen, was die Kriegsberichterstattung nicht erzählen kann: Was es heißt, ausgeliefert zu sein, sich ständig vom Tod bedroht zu fühlen, in einer Welt zu leben, in der nichts mehr selbstverständlich ist.
All das ist nicht neu, im Gegenteil: Die Literatur erzählt vom Krieg, seit es sie gibt. In der "Ilias", einem der ältesten erhaltenen Texte, schreibt Homer über den trojanischen Krieg, der damals wohl mindestens fünfhundert Jahre zurücklag. Zehn Jahre soll dieser Krieg gedauert haben, Homer jedoch gibt in seinen 24 Gesängen nur einen Ausschnitt von 51 Tagen wieder. Die "Ilias" ist kein realistischer Bericht, sondern eine literarische Verdichtung.
Die Hauptfigur der "Ilias" ist Achill, "der mutige Renner", wie es heißt. Ein Held allerdings, der nicht zum Vorbild taugt. Sein legendärer Zorn kennt kein Maß. Die Schlachtszenen erinnern in ihrer Drastik an ein Splattermovie: Im Kampf kennt Achill keine Gnade, auch dann nicht, als sich ihm ein Kämpfer zu Füßen wirft.
Der Krieg ist eine Probe. Wie verhält sich maximale Kriegstüchtigkeit mit den weichen Tugenden, die nötig sind, um in der Gesellschaft miteinander auszukommen. Geht das oder geht das nicht?
Achill ist eine exemplarische Figur, denn der Krieg ist für Homer, in dessen Zeit ständig irgendwo Krieg geführt wurde, ein gedankliches Experiment.
Darin besteht auch die Aktualität. Es ist nicht eine Geschichte, die einen nichts angeht, es ist auch keine Geschichte, die irgendwie ein leuchtendes Vorbild vor Augen führt, sondern es ist eine Geschichte, in der problematische Verhaltensmöglichkeiten ausgetestet werden. Wie kann man sich unter diesen Bedingungen verhalten?
"Der Mensch ist im Krieg ganz bei sich"
Krieg ist ein Ausnahmezustand, ein Mittel zur Erkenntnis dessen, was der Mensch ist.
Ulrich Schmid, Professor für Slawistik an der Universität St. Gallen, spricht in seiner Tolstoj-Biografie von einem antiheroischen Ton, den Tolstoj in "Krieg und Frieden" anschlägt: "Tolstoj sagt, dass der Krieg den Menschen in seiner Eigentlichkeit zeigt. Der Mensch ist im Krieg ganz bei sich und wird nicht von den falschen Institutionen, von Staat, Medizin, Bildung und so weiter gestört. Der Mensch kann direkt beobachtet werden im Krieg, in der Grenzsituation des Kriegs."
Der Mensch ist im Krieg ganz bei sich, weil er in jedem Moment weiß, dass er sterben kann. In einer frühen Erzählung beschreibt Tolstoj das Sterben eines Soldaten:
Er raffte seine ganze Kraft zusammen und wollte schreien: "Nehmt mich mit!", aber stattdessen stöhnte er so laut, dass er vor seiner eigenen Stimme erschrak. Dann begannen rote Lichter vor seinen Augen zu tanzen, und es schien ihm, dass die Soldaten Steine auf ihn legten. Die Lichter tanzten immer seltener und seltener umher, die Steine, die man auf ihn legte, drückten ihn immer schwerer. Er machte eine Anstrengung, die Steine von sich zu wälzen, streckte sich aus und sah, hörte, dachte und fühlte nichts mehr. Er war auf der Stelle von einem Granatsplitter getroffen worden, der ihn mitten in die Brust getroffen hatte.
Tolstoj stellt sich das Sterben des Soldaten als ein Erdrücktwerden, als Grablegung vor. Als er tot ist, verlässt ihn nicht nur die Seele, sondern auch der Erzähler. Tolstoj wechselt zu einer unberührten, allwissenden Stimme, die die Todesursache – den Granatsplitter – nachträgt.
Als junger Mann war Tolstoj ein begeisterter Offizier, er identifizierte sich mit der russischen Armee. Doch dann veränderte sich seine Haltung: Der Autor von "Krieg und Frieden" sieht im Krieg nur noch ein sinnloses Morden. Das hat Folgen für die literarische Darstellung des Kriegs – "Krieg und Frieden" ist ein Anti-Kriegsroman.
Schmid: "Es gibt diese berühmte Szene, als Fürst Andrei Bolkonski verwundet am Boden liegt, und Napoleon kommt nach der Schlacht vorbei und sagt: Voilà, une belle mort. Und hier wird deutlich, dass Napoleon etwas macht, was für Tolstoj absolut unzulässig ist: Er ästhetisiert nämlich den Tod im Krieg."
Den Krieg ästhetisieren hieße: dem Unvorstellbaren den Schrecken nehmen, indem man es ins Schöne umdeutet und ihm damit Sinn verleiht.
"Das ist das große Dilemma der ganzen Kriegsliteratur. Auf der einen Seite versucht man natürlich, den Krieg in seiner Nacktheit zu präsentieren, aber auf der anderen Seite geht das gar nicht ohne sprachliche Konventionen, ohne stilistische Konventionen. Deswegen ist eigentlich jeder Schriftsteller früher oder später in dieser Zwangslage, dass er sich einerseits in ganz bestimmten Schreibtraditionen befindet, aber auf der anderen Seite diese Schreibtraditionen auch irgendwie ablehnen muss."
Heldenerzählung versus Anti-Kriegsliteratur
Die Kriegsberichterstattung benennt die Gräuel zwar, jedoch in Erzählkonventionen, die dem Geschehen äußerlich bleiben. Die Literatur muss das Unvorstellbare in Worte übersetzen, uns den nackten Krieg so schildern, dass wir begreifen, was hier eigentlich geschieht. Erzählen heißt deuten: Es gibt Kriegsliteratur, die den Krieg verherrlicht und ihn als etwas Heroisches darstellt, wie man es etwa Ernst Jünger vorgeworfen hat, und es gibt eine Literatur vom Krieg, die ihn in seiner ganzen Sinnlosigkeit zeigt wie Erich Maria Remarques "Im Westen nichts Neues". Die Anti-Kriegsliteratur bricht mit der Tradition der Heldenerzählung, etwa indem sie aus der Perspektive eines Anti-Helden erzählt.
"Der Krieg bringt seine eigenen Wörter hervor. Sie klingen scharf und kalt, sie bezeichnen nie kriegsferne Dinge, obwohl sie ins zivile Leben eindringen und tiefe Spuren hinterlassen."
So beschreibt der ukrainische Autor Serhij Zhadan die sprachlichen Folgen des Kriegs:
"Der Krieg ist wie Giftmüll im Fluss – er erreicht jeden, der in Flussnähe wohnt. Du musst auf die neuen Substantive und Verben reagieren, du gewöhnst dich an sie, sie werden dir vertraut. Plötzlich befinden sich unter deinen Bekannten Einberufene, Verwundete und Gefangene. Du gewöhnst dich daran, dass die Sprache um Wörter dieses schwarzen Vokabulars erweitert wird, um Dutzende neuer Wörter, von denen jedes einzelne nichts anderes als Tod bedeutet."
Serhij Zhadans Roman "Internat" handelt vom Krieg im Donbass, den der Autor seit Jahren aus nächster Nähe miterlebt. Allerdings nicht als Soldat wie einst Tolstoj den Kaukasus- und Krimkrieg, sondern als Zivilist.

Ein beschossenes Wohnhaus in Stanzija Luganskaja in der Ostukraine© Deutschlandradio / Sabine Adler
"Den Krieg selbst hat er kämpfend nicht erlebt, er ist aber sehr aktiv in der Konfliktzone, als Aktivist auch, er sammelt für Kinderheime, für Bedürftige dort. Er hat mit sehr, sehr vielen Soldaten, Helfern Freiwilligen gesprochen, und natürlich auch Zivilisten und daraus bezieht er sein Wissen darüber, wie es dort ist."
Sabine Stöhr hat, zusammen mit Juri Durkot, Zhadans Roman "Internat" übersetzt. Beide wurden dafür mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichnet. "Internat" erzählt von einer Reise durchs Kriegsgebiet: Früher hätte man für den Weg ans andere Ende der Stadt eine Stunde gebraucht, jetzt ist er fast unpassierbar geworden. Drei Tage benötigt Pascha, um seinen 13-jährigen Neffen Sascha aus dem Internat zu holen. Die vertraute Gegend hat sich in eine Zone verwandelt, in der man wie in einem Alptraum mit allem rechnen muss.
"Das Schreckliche lauert dabei eigentlich immer eher im Dunklen, im Nebel, hinter den Ecken."
Pascha bleibt stehen, schaut auf den verwüsteten Schlafsaal und hat nicht die Kraft, sich zu rühren. Pascha erkundet einen verlassenen Kindergarten. Er starrt nur geradeaus, ins schwarze Loch der Tür, die in den nächsten Raum führt und sagt zu sich selbst: Nicht reingehen, auf gar keinen Fall, um nichts in der Welt darfst du dort rein. Und bewegt sich langsam, wie ein Toter im Film, auf diese Tür zu. Er geht, tritt mit den Stiefeln auf die aufgerissenen Kissen, trampelt über die Laken, hinterlässt Fußabdrücke auf den umherliegenden Malbüchern, auf gar keinen Fall, sagt er, um nichts in der Welt, und geht weiter, steigt über kleine Steppdecken, scharfkantige Bauklötze, nicht reingehen, nicht reingehen, wiederholt er, streckt den Arm aus – und der Arm dringt in die Dunkelheit, bis zum Handgelenk, bis zum Ellenbogen, bis zur Schulter, auf gar keinen Fall, sagt er sich zum letzten Mal und wird von der Schwärze verschluckt. Taucht auf der anderen Seite wieder auf, im nächsten Raum, offenbar eine Vorratskammer neben der Kantine: an den Wänden leere Regale, in denen wohl früher die Konservendosen standen, auf dem Fensterbrett Stapel leerer Keksschachteln, auf dem Fußboden Salz verstreut.
"Indem er die Dinge nicht schrecklich und besonders blutig darstellt, sondern der Schrecken eben oft hinter den Dingen lauert, ist das aus meiner Sicht ganz besonders eindrucksvoll. Diese Atmosphäre, wie sich ein Mensch fühlt, in dieser schrecklichen Atmosphäre."
Pascha tastet sich von Raum zu Raum, er erschrickt, als er auf einen fiependen Gummi-Welpen tritt, und als er in der Ecke einen großen Kühlschrank sieht, denkt er an "ein gigantisches totes Herz". Der Kühlschrank ist still, denn im Krieg gibt es keinen Strom.
Dann packt Pascha den Griff – nicht aufmachen, um nichts in der Welt! – und zieht. Ein so unerträglicher, so schwerer und mörderischer Gestank schlägt ihm ins Gesicht, etwas so Zerhacktes, Zerfressenes und Verfaultes, so Geschlachtetes, Abgestochenes und Amputiertes, dass Pascha sich jäh krümmt, um sich nicht übergeben zu müssen, und dann Hals über Kopf zurückläuft. Aufgerissene Kissen, verrückte Betten, der schwarze Korridor, die toten Spielsachen, die offene Tür, die gusseisernen Heizkörper, der Mond hinter dem Fenster – unerträglich nah, so nah, dass es Pascha scheint, als käme der Gestank von ihm, dem Mond, dass dieser Mond über der zerbombten Stadt hängt und den Geruch eines aufgeschlitzten Leibes ausströmt.
"Die eigentliche Geschichte hinter den Fakten"
Die Sprache ist so unerbittlich genau wie in Homers "Ilias", doch sie zeigt uns nicht die sich ereignende Gewalt. Die Gewalt ist bereits geschehen, wenn wir den Schauplatz betreten.
"Er erzählt eben einen Teil dessen, was die nüchterne Kriegsberichterstattung nicht leisten kann. Es gibt ja zum Beispiel die Beobachtermission der OSZE, SMM, und die veröffentlicht jeden Tag Berichte über das, was sie gesehen hat. Das sind sehr interessante Berichte, mir kommt das Buch "Internat" vor wie die menschliche Geschichte, oder auch die eigentliche Geschichte hinter diesen Fakten, das ist das Wertvolle, und ich denke auch, dass Serhij Zhadan genau diesen Anspruch hatte, nämlich zu zeigen: Was bedeutet das Ganze für die Menschen, die dort leben, und auch zu zeigen, in welchen doch sehr vielfältigen Schattierungen die Menschen mit der Situation umgehen, in der sie sich da plötzlich befinden."
Der Roman "Internat" hat einen ungeheuren Drive. Man kann sich dem Sog der Angst kaum entziehen, die Pascha auf Schritt und Tritt gefangen hält. Wir erleben, was Pascha erlebt, der im zivilen Alltag Ukrainischlehrer war und der mit dem Krieg nichts zu tun haben will.
Zhadan erzählt vom Krieg in einer Sprache, in der alles symbolisch aufgeladen ist.
"Da steigt dunkler Rauch auf, und das ist wie die Schwänze von Drachen, und das ist ein Bild für die Seelen der Soldaten, die in den Kämpfen sterben und dann eben zum Himmel aufsteigen."
Das sind poetische Bilder, die die Landschaft verfremden, in der sich das Unvorstellbare ereignet. Kann man hier von Schönheit sprechen, ist es eine Art der Ästhetisierung?
"Ich weiß gar nicht, ob es Schönheit ist. Er ästhetisiert nicht, das würde ich sagen. Schön ist vielleicht die Sprache, oder sind die Bilder, die eben sehr poetisch sind, man fragt sich eher, wie kann mit so einfachen Worten und Bildern so ein poetischer und tiefgründiger Eindruck entstehen. Aber ich möchte schon festhalten, dass er eben gerade nicht ästhetisiert und keine Schönheit am Krieg selbst findet."
Der syrische Autor Khaled Khalifa ist dem Krieg, über den er schreibt, noch näher als Serhij Zhadan. Khaled Khalifa hat sich entschieden, in Damaskus zu bleiben, in einer Welt, in der selbst die banalsten Dinge vom Krieg durchtränkt sind.
"Früher habe ich in Damaskus im Café geschrieben. Ich brauchte zehn Minuten von zu Hause zu meinem Tisch im Café. Mein Tisch war bereit, mein Kaffee dampfte, alles war in Ordnung, jeden Tag saß ich dort sechs Stunden, denn das ist meine Arbeit. Wenn ich das heute machen möchte, werde ich zwei Stunden an Checkpoints aufgehalten. Zwei Stunden voller Sorge, ich weiß nicht, was mit mir am Checkpoint geschehen wird, denn am Checkpoint wartet auch der Geheimdienst."
Khaled Khalifa war in Deutschland auf Lesereise mit seinem Buch Der Tod ist ein mühseliges Geschäft – ein sarkastischer Titel, der in mehrfacher Hinsicht wörtlich zu nehmen ist. Denn im Krieg ist nicht nur das Sterben mühselig, sondern auch das, was danach kommt. Auf dem Sterbebett hat der Vater seinem Sohn Bulbul das Versprechen abgenommen, ihn in seinem Heimatdorf zu begraben, 250 Kilometer von Damaskus entfernt. Wie Zhadan in Internat schildert Khalifa eine alptraumhafte Reise, und wie bei Zhadan dauert sie drei symbolische Tage.
"Sie sahen aus, als hätten sie fünftausend Kilometer hinter sich, nicht zweihundertfünfzig, für die sie in normalen Zeiten zweieinhalb Stunden gebraucht hätten."
Bulbul und seine beiden Geschwister sind mit der Leiche im Dorf des Vaters eingetroffen, entgegen aller Wahrscheinlichkeit. Die Zeit der opulenten Begräbnisse ist allerdings vorbei.
Die Rituale bedeuten nichts mehr. Arme und Reiche, hohe Offiziere und niedrige Soldaten in der Regierungsarmee, Führer bewaffneter Brigaden, Kämpfer und einfache Tote, deren Identität niemand kennt, sie alle werden in mitleiderregend dürftigen Prozessionen zu Grabe getragen.
Auch Khaled Khalifa zeigt nur einen Ausschnitt aus dem Krieg, und dass es dabei um den Transport eines Toten geht, ist keineswegs ein Zufall.
"Es ist ein Problem in Syrien, in Homs, in Aleppo: Oft liegen Leichen auf der Straße, denn während der Bombardierung kann man die Toten nicht zum Friedhof bringen. Deshalb habe ich diese Geschichte geschrieben. Es ist eine kleine Geschichte, nicht über den Krieg als Ganzes, nur über diesen Fall, diese Familie, nur diese drei Personen in diesem Krieg."
Die Geschichte ist erfunden, doch ihr Auslöser ist autobiografisch, auf geradezu makabre Weise.
"Ich war im Krankenhaus mit einem Herzinfarkt, und ich dachte: Wenn ich jetzt sterbe, was geschieht dann? Meine Familie lebt nördlich von Aleppo, sie würden meine Leiche dort hinbringen wollen, aber das ist sehr schwierig. Ich war dem Tod nahe, und die Idee zu dem Roman kam mir in dem Moment, als ich an meine Schwestern, Brüder, Onkel und Freunde dachte. Zehn Minuten später hatte ich den Roman im Kopf. Noch viele Tage nach der Entlassung aus dem Krankenhaus habe ich daran gedacht – jeden Tag denke ich daran."
Noch im Krankenhaus begann Khaled Khalifa mit der Recherche. Er befragte seine Ärzte:
"Was geschieht mit einer Leiche nach einem Tag, nach drei Tagen? Wie verändert sich die Farbe, der Körper? Sie gaben mir Auskunft über die Farbe, darüber, wie sich unterschiedliche Temperaturen auswirken, im Sommer und im Winter, bei Regen. Für mich war es eine Entdeckung. Ich denke über die Toten nach."
(Auszug aus dem Manuskript der Sendung, dass Sie hier herunterladen können)