Soziale Ungleichheit
Paul Krugman schreibt in "Nach Bush" vor allem eine Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Vereinigten Staaten. Wortmächtig wirbt er für die Rückkehr zum "New Deal". Sein Hauptanliegen ist die wachsende wirtschaftliche und soziale Ungleichheit in den Vereinigten Staaten.
Paul Krugman zu lesen, lohnt immer. Krugman ist nicht nur ein bedeutender Wirtschaftswissenschaftler an der Harvard Universität, er arbeitet auch als ständiger Kolumnist der "New York Times" – er kann also schreiben – und ist ein kluger Kopf dazu. Vor allem seit den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon in Washington am 11. September 2001 hat sich Krugman einen Namen in der breiten Öffentlichkeit durch seine Attacken auf Präsident Bush und dessen Politik gemacht. Krugman griff Bush zu einer Zeit an, in der jede Kritik am Weißen Haus als Vaterlandsverrat galt, weil sich Amerika im Krieg begriff, und der Oberbefehlshaber in einer solchen Krise eben nicht angegriffen werden darf – so jedenfalls das damalige Verständnis.
Leider traut der Verlag dem Werk hierzulande offensichtlich wenig Zugkraft zu. Campus veränderte nämlich den Titel. Während Krugman seine Studie – wörtlich übersetzt – als "Das Gewissen eines Liberalen" auf den Markt brachte, machte Campus daraus: "Nach Bush. Das Ende der Konservativen und die Stunde der Demokraten". Darum geht es Krugman zwar auch, doch schreibt er vor allem eine Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Vereinigten Staaten. Wortmächtig wirbt Krugman für die Rückkehr zum "New Deal". Den Irak-Krieg, Afghanistan und den Einfluss der Neokonservativen auf die amerikanische Außenpolitik lässt der Autor außer Acht. Sein Hauptanliegen ist die wachsende wirtschaftliche und soziale Ungleichheit in den Vereinigten Staaten.
Folgt man Krugman, sind Mr. and Mrs. Sixpack – Amerikas Otto-Normal-Verbraucher – über die Jahre hinweg immer ärmer geworden. Schon unter Bill Clinton habe ein Großteil der Mittelklasse kaum noch Nutzen vom Wirtschaftsaufschwung nehmen können. Heute sei die Krise schmerzlich zu spüren. Die Furcht vor der Verelendung, vor dem Abstieg breite sich aus. Die Ursachen für die "Politik der Ungleichheit" sind für den Autor klar: Der Hass der Rechten auf den Wohlfahrtsstaat, ihr Groll gegen die Gewerkschaften und ihre Wut auf das Steuersystem. Seit den 60er Jahren habe sich im konservativen Lager eine Bewegung gebildet, die dem amerikanischen Wohlfahrtstaat, so, wie ihn Präsident Roosevelt mit seinem "New Deal" geschaffen hatte, erfolgreich den Kampf angesagt habe.
"Die Republikanische Partei zog es vor, sich um die Interessen der aufsteigenden Elite zu kümmern, vielleicht, weil die Elite ihre geringe Zahl wettmachte durch die Fähigkeit und Bereitschaft, große Wahlkampfspenden beizusteuern."
Nicht die Globalisierung, nicht die Konkurrenz aus Japan, China oder Indien haben also zur wachsenden Ungleichheit in der amerikanischen Gesellschaft geführt, so Krugman, sondern die Machtübernahme einer "harten Rechten", die einen "Klassenkampf von oben" betreibe. Glaubt man dem Autor, ist diese Rechte unter Ronald Reagan erstmals wahrzunehmen gewesen und hat mit Präsident George W. Bush den Höhepunkt der Macht erreicht. Ihre Herrschaft hält Krugman nun für beendet. In Amerika mache sich seit geraumer Zeit ein Klimawandel bemerkbar, der über kurz oder lang in die seligen Zeiten des "New Deal" zurückführen werde.
"In der modernen amerikanischen Geschichte gab es zwei große Bögen: einen wirtschaftlichen Bogen von großer Ungleichheit zu relativer Gleichheit und zurück und einen politischen Bogen von extremer Polarisierung zur Zusammenarbeit beider Parteien und wieder zurück."
Heute sehne sich die in Not geratene Mittelschicht stärker denn je nach den sozialen Errungenschaften der Roosevelt-Jahre. Zudem ist
"Amerika heute weniger weiß, und viele Weiße werden weniger rassistisch."
Das Misstrauen der weißen Mittelschicht gegen die Schwarzen und die farbigen Einwanderer sei im Wahlkampf kaum noch zu spüren und könne von den Republikanern nicht mehr genutzt werden. Darüber hinaus verbreite sich in Amerika allmählich der Wunsch nach einem sozialdemokratischen Programm. Dieser Wunsch werde wohl zu einem Wahlsieg der Demokraten führen. Deshalb wirbt der Autor fast aggressiv dafür, sich gerade im Wahlkampf offen zum "Liberalismus" zu bekennen, der bis heute in Amerika eher mit "Sozialismus" gleichgesetzt und daher verteufelt wird.
"Liberal sein heißt, in einem gewissen Sinne konservativ zu sein ¬ – es bedeutet, dass wir wieder zurückwollen zu der Mittelschichtgesellschaft, die wir einmal waren."
Liberal zu sein, bedeutet für Krugman zudem, von den Vorzügen einer relativ gleichen Gesellschaft überzeugt zu sein ….
"… getragen von Institutionen, die Extreme des Reichtums und der Armut begrenzen. Ich glaube an die Demokratie, die bürgerlichen Freiheiten und die Herrschaft des Rechts. Das macht mich zu einem Liberalen, und ich bin stolz darauf."
Ob die Mehrheit der Amerikaner diese Ansicht teilt, wird die Wahl zeigen. Fest steht, dass Krugman Recht hat: Die Stimmung in den USA hat sich gewandelt. Die Amerikaner sind fertig mit der Form des Konservatismus, für die George W. Bush steht. Das freilich heißt nicht, dass Senator John McCain keine Chancen auf einen Wahlsieg hat. Sollte er gewinnen, wird er sich abheben von Bushs Innenpolitik. Stärker noch als vor wenigen Jahren besinnen sich die Amerikaner wieder auf einen Staat, der eingreift, der regelt, der ordnet. Der nächste Präsident wird diesen Gesinnungswandel in Politik umsetzen.
Paul Krugman: Nach Bush - Das Ende der Neokonservativen und die Stunden der Demokraten
Aus dem Englischen von Friedrich Griese
Campus-Verlag, Frankfurt am Main 2008
Leider traut der Verlag dem Werk hierzulande offensichtlich wenig Zugkraft zu. Campus veränderte nämlich den Titel. Während Krugman seine Studie – wörtlich übersetzt – als "Das Gewissen eines Liberalen" auf den Markt brachte, machte Campus daraus: "Nach Bush. Das Ende der Konservativen und die Stunde der Demokraten". Darum geht es Krugman zwar auch, doch schreibt er vor allem eine Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Vereinigten Staaten. Wortmächtig wirbt Krugman für die Rückkehr zum "New Deal". Den Irak-Krieg, Afghanistan und den Einfluss der Neokonservativen auf die amerikanische Außenpolitik lässt der Autor außer Acht. Sein Hauptanliegen ist die wachsende wirtschaftliche und soziale Ungleichheit in den Vereinigten Staaten.
Folgt man Krugman, sind Mr. and Mrs. Sixpack – Amerikas Otto-Normal-Verbraucher – über die Jahre hinweg immer ärmer geworden. Schon unter Bill Clinton habe ein Großteil der Mittelklasse kaum noch Nutzen vom Wirtschaftsaufschwung nehmen können. Heute sei die Krise schmerzlich zu spüren. Die Furcht vor der Verelendung, vor dem Abstieg breite sich aus. Die Ursachen für die "Politik der Ungleichheit" sind für den Autor klar: Der Hass der Rechten auf den Wohlfahrtsstaat, ihr Groll gegen die Gewerkschaften und ihre Wut auf das Steuersystem. Seit den 60er Jahren habe sich im konservativen Lager eine Bewegung gebildet, die dem amerikanischen Wohlfahrtstaat, so, wie ihn Präsident Roosevelt mit seinem "New Deal" geschaffen hatte, erfolgreich den Kampf angesagt habe.
"Die Republikanische Partei zog es vor, sich um die Interessen der aufsteigenden Elite zu kümmern, vielleicht, weil die Elite ihre geringe Zahl wettmachte durch die Fähigkeit und Bereitschaft, große Wahlkampfspenden beizusteuern."
Nicht die Globalisierung, nicht die Konkurrenz aus Japan, China oder Indien haben also zur wachsenden Ungleichheit in der amerikanischen Gesellschaft geführt, so Krugman, sondern die Machtübernahme einer "harten Rechten", die einen "Klassenkampf von oben" betreibe. Glaubt man dem Autor, ist diese Rechte unter Ronald Reagan erstmals wahrzunehmen gewesen und hat mit Präsident George W. Bush den Höhepunkt der Macht erreicht. Ihre Herrschaft hält Krugman nun für beendet. In Amerika mache sich seit geraumer Zeit ein Klimawandel bemerkbar, der über kurz oder lang in die seligen Zeiten des "New Deal" zurückführen werde.
"In der modernen amerikanischen Geschichte gab es zwei große Bögen: einen wirtschaftlichen Bogen von großer Ungleichheit zu relativer Gleichheit und zurück und einen politischen Bogen von extremer Polarisierung zur Zusammenarbeit beider Parteien und wieder zurück."
Heute sehne sich die in Not geratene Mittelschicht stärker denn je nach den sozialen Errungenschaften der Roosevelt-Jahre. Zudem ist
"Amerika heute weniger weiß, und viele Weiße werden weniger rassistisch."
Das Misstrauen der weißen Mittelschicht gegen die Schwarzen und die farbigen Einwanderer sei im Wahlkampf kaum noch zu spüren und könne von den Republikanern nicht mehr genutzt werden. Darüber hinaus verbreite sich in Amerika allmählich der Wunsch nach einem sozialdemokratischen Programm. Dieser Wunsch werde wohl zu einem Wahlsieg der Demokraten führen. Deshalb wirbt der Autor fast aggressiv dafür, sich gerade im Wahlkampf offen zum "Liberalismus" zu bekennen, der bis heute in Amerika eher mit "Sozialismus" gleichgesetzt und daher verteufelt wird.
"Liberal sein heißt, in einem gewissen Sinne konservativ zu sein ¬ – es bedeutet, dass wir wieder zurückwollen zu der Mittelschichtgesellschaft, die wir einmal waren."
Liberal zu sein, bedeutet für Krugman zudem, von den Vorzügen einer relativ gleichen Gesellschaft überzeugt zu sein ….
"… getragen von Institutionen, die Extreme des Reichtums und der Armut begrenzen. Ich glaube an die Demokratie, die bürgerlichen Freiheiten und die Herrschaft des Rechts. Das macht mich zu einem Liberalen, und ich bin stolz darauf."
Ob die Mehrheit der Amerikaner diese Ansicht teilt, wird die Wahl zeigen. Fest steht, dass Krugman Recht hat: Die Stimmung in den USA hat sich gewandelt. Die Amerikaner sind fertig mit der Form des Konservatismus, für die George W. Bush steht. Das freilich heißt nicht, dass Senator John McCain keine Chancen auf einen Wahlsieg hat. Sollte er gewinnen, wird er sich abheben von Bushs Innenpolitik. Stärker noch als vor wenigen Jahren besinnen sich die Amerikaner wieder auf einen Staat, der eingreift, der regelt, der ordnet. Der nächste Präsident wird diesen Gesinnungswandel in Politik umsetzen.
Paul Krugman: Nach Bush - Das Ende der Neokonservativen und die Stunden der Demokraten
Aus dem Englischen von Friedrich Griese
Campus-Verlag, Frankfurt am Main 2008
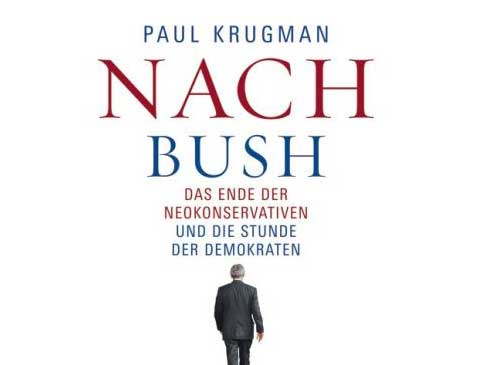
Paul Krugman: Nach Bush© Campus-Verlag
