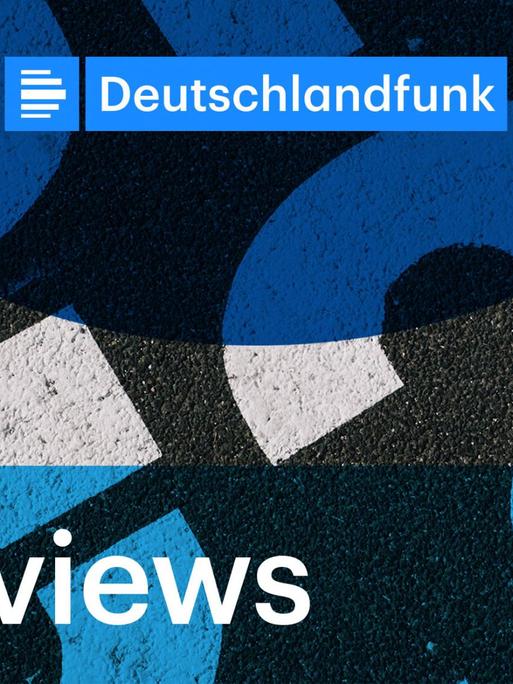So klappt's mit der Zweitstimme
Wie geht taktisches Wählen? Was hat es mit Überhangmandaten auf sich? Wie unterscheiden sich Erst- und Zweitstimme? Was Sie vor dem Gang zur Wahlurne wissen sollten - ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Sascha Huber.
Gabi Wuttke: Morgen sind Sie gefragt. Die Parteien warten auf Ihre Antwort, wer Deutschland künftig regieren soll. Wie immer vor einer Wahl gibt es Umfragen. Umfragen, die die Stimmung widerspiegeln sollen, Umfragen, deren Ergebnisse sich durchaus voneinander unterscheiden und über deren Sinn und Zweck mal wieder viel diskutiert wird. Merke: Auch Wissenschaft ist relativ.
Vor sechs Jahren wurde deshalb die Deutsche Gesellschaft für Wahlforschung gegründet. Das Ziel der 65 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: eine langfristige nationale Wahlstudie, um das Wählerverhalten kontinuierlich und einheitlich zu untersuchen, um sie dann mit denen in anderen europäischen Ländern vergleichen zu können. Zu den 65 Wahlforschern der DGfW gehört Sascha Huber. Einen schönen guten Morgen, Herr Huber!
Sascha Huber: Guten Morgen!
Wuttke: Die Parteien versuchen die Unentschiedenen zu mobilisieren. Viele Wähler überlegen noch, wie sie ihre Stimmen strategisch am besten verteilen. Hat die Untersuchung der letzten Bundestagswahl Einblick gewährt, was die Wähler in Deutschland unter "Strategie" eigentlich verstehen?
Huber: Der Großteil der Wähler, die ein strategisches Kalkül anlegen, ist darauf aus, die Regierungsbildung zu beeinflussen, also bestimmte Koalitionen zu ermöglichen oder zu verhindern.
Wuttke: Und was lässt sich daran ablesen? Man kann ja entweder überlegen, ich unterstütze die Wunschkoalition, die ich habe, oder aber ich überlege, eine Partei zu wählen, um die mögliche Koalition nicht zustande kommen zu lassen. Wie wählerisch, wie kompetent sind denn die deutschen Wähler da?
"Mit der Blutgrätsche ins Koalitionskalkül"
Huber: Sie sprechen es ja schon an, es gibt unterschiedlichste Kalküle, die die Wähler anlegen können, und die sind auch hochkomplex im deutschen Mehrparteiensystem. Es hängt ja nicht nur davon ab, was die aktuellen Prognosen machen, wie man die vielleicht tatsächlich auch kennt, inwieweit man sein strategisches Verhalten dann strategisch ausrichten muss, sondern es liegt auch daran, wie man einschätzt, welche Koalitionen sich denn nach der Wahl mit welcher Wahrscheinlichkeit bilden könnten. Das hängt also ganz besonders davon ab, inwieweit die Parteien auch klare Signale aussenden, welche Koalition sie gerne bilden würden.
Wuttke: Und es geht immer um Koalitionen, die sie gerne sähen, oder wählen manche Menschen auch so als Quereinsteiger, so schräg hinein mit einer Blutgrätsche, dass sie durchaus in Kauf nehmen, dass, um es mal etwas salopp zu sagen, sie im großen Ganzen ihre Stimme auch verplempern, und zwar absichtsvoll?
Huber: Wir haben schon auch einige Erkenntnisse dazu gehabt, insbesondere bei der Bundestagswahl 2005, dass manche sich die Große Koalition gewünscht haben, aber dann nicht eine der beiden Parteien gewählt haben, sondern die Linke. Das erscheint erst mal rational, denn die Koalition mit der Linken wurde ausgeschlossen von beiden Parteien, und wenn die Linke es geschafft hat im Bundestag, dann war die Wahrscheinlichkeit größer, dass auch eine tatsächlich Große Koalition sich daraus bildet. Ich bin mir nicht sicher, wie weit diese Befunde wirklich belastbar sind.
Wuttke: Aber was sagt denn die Wissenschaft? Ist wirklich allen klar, worüber Erst- und Zweitstimme entscheiden?
Huber: Nein! Ganz im Gegenteil. Da ist eine sehr große Verwirrung, die die Parteien zum Teil auch ausnutzen. Insbesondere die kleinen Parteien – also die FDP ist darin der Meister mit ihren Zweitstimmenkampagnen, die ein bisschen suggerieren, als ob die Zweitstimme weniger wichtiger sei und sie deswegen auch von einem Unionsanhänger an den kleinen Koalitionspartner, die FDP, ausgeliehen werden könnte.
Wuttke: Also klar und knapp von Ihnen: Wofür dient die Zweitstimme, wofür die Erststimme?
"Die Zweitstimme entscheidet"
Huber: Die Zweitstimme ist die alles entscheidende Stimme im Deutschen Bundestag, die darüber bestimmt, wie die Sitzverteilung aussieht. Das gilt umso mehr jetzt mit dem neuen Wahlrecht, in dem die Überhangsmandate vollständig ausgeglichen werden. Sie müssen sich also bei Ihrem Wahlakt vorstellen, dass die Zweitstimme potenziell Ihre einzige Stimme ist, um den Wahlausgang zu bestimmen. Die Erststimme hat darauf überhaupt keinen Einfluss. Die Erststimme dient nur dazu, zu bestimmen, welcher Direktkandidat in den Bundestag einzieht.
Wuttke: Sie haben gerade das Stichwort "Überhangmandate" genannt und das neue Wahlrecht. Vielleicht können Sie vor diesem Hintergrund noch mal erklären, warum die Union überhaupt gar kein Interesse an einer Zweitstimmenkampagne für die FDP hat.
Huber: Jede Stimme, die sie an Zweitstimmen nicht bekommt, schadet der CDU in ihrer Sitzstärke. Das war früher auch in fast allen Fällen so, aber zum Teil, in wenigen kleinen Fällen konnte es passieren, dass durch die Überhangmandate, sie dann auch gewonnen hat, wenn sie keine Zweitstimme bekommen hat. Aber das ist jetzt definitiv nicht mehr der Fall.
Wuttke: Sie haben gesagt, viele Wähler wissen nicht, was eigentlich der Unterschied und die Gewichtung von Erst- und Zweitstimmen sind – ist das Wahlrecht in Deutschland immer noch viel zu kompliziert?
"Das deutsche Wahlrecht ist zu kompliziert"
Huber: Ich denke, dass das Wahlrecht doch große Anforderungen an den Wähler stellt. Es sind zwei Stimmen, und es muss dem Wähler erst mal klar sein, dass diese Stimmen nicht irgendwie in der Kombination ausgewertet werden. Also auch wenn man Splitting betreibt, ist es nicht so, dass das eine Präferenz ausdrücken würde für eine bestimmte Koalition. Sondern die werden getrennt ausgerechnet, und nur die Zweitstimme entscheidet eben über den Stimmanteil der Parteien.
Was ich für Untersuchungen schon dazu gemacht habe, ist, dass ich unterschiedliche Studienexperimente durchgeführt habe, auch in Neuseeland und in Österreich, weil Neuseeland hat dasselbe Wahlsystem wie Deutschland, nur dort wurde Folgendes gemacht, dass diese verwirrende Benennung der Stimmen umgedreht wurde und dass einfach die Zweitstimme als Erstes abgefragt wird zunächst mal. Das scheint ja auch semantisch irgendwie normal zu sein, dass das Erste wichtiger sei. Und das ist genau das Verwirrende am deutschen Wahlsystem. Und die wurde dann benannt – also unsere Zweitstimme – als Party Vote, und die Wahlkreisstimme wurde entsprechend als Electorate Vote benannt. Das, zeigen zumindest meine Untersuchungen, führt dazu, dass die Leute weniger verwirrt sind und vielleicht auch weniger Fehler bei ihrer Stimmabgabe machen.
Wuttke: Also: Zweitstimme Partei, Erststimme Kandidat. Reformiert wurde ja auch das Briefwahlrecht. Mehr Menschen denn je, das liegt an eben dieser Reformierung, haben jetzt davon Gebrauch gemacht. Das heißt, die heiße Phase des Wahlkampfs ist für diese Briefwähler sowieso kalter Kaffee. Macht das den Ausgang der Wahl für Sie noch spannender?
Huber: Weiß ich nicht. Ich glaube, dass auf der anderen Seite natürlich sehr viele Wähler stehen – zumindest sagen sie uns das –, die sich sehr, sehr spät entscheiden. Ich denke, es gab schon immer Leute, für die relativ klar war von Anfang an des Wahlkampfes, welche Parteien sie wählen werden. Die wählen jetzt vermehrt mit Briefwahl. Ich glaube, es ist weniger der Grund, dass das Wahlrecht sich umgestellt hat, sondern der Grund liegt, glaube ich, vor allem darin, dass die Mobilität einfach zugenommen hat, viele nicht wissen, sind sie an diesem Sonntag überhaupt in ihrem Ort und so weiter.
Wuttke: Sagt Sascha Huber von der Uni Mannheim, Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung. Besten Dank, Herr Huber!
Huber: Danke!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Vor sechs Jahren wurde deshalb die Deutsche Gesellschaft für Wahlforschung gegründet. Das Ziel der 65 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: eine langfristige nationale Wahlstudie, um das Wählerverhalten kontinuierlich und einheitlich zu untersuchen, um sie dann mit denen in anderen europäischen Ländern vergleichen zu können. Zu den 65 Wahlforschern der DGfW gehört Sascha Huber. Einen schönen guten Morgen, Herr Huber!
Sascha Huber: Guten Morgen!
Wuttke: Die Parteien versuchen die Unentschiedenen zu mobilisieren. Viele Wähler überlegen noch, wie sie ihre Stimmen strategisch am besten verteilen. Hat die Untersuchung der letzten Bundestagswahl Einblick gewährt, was die Wähler in Deutschland unter "Strategie" eigentlich verstehen?
Huber: Der Großteil der Wähler, die ein strategisches Kalkül anlegen, ist darauf aus, die Regierungsbildung zu beeinflussen, also bestimmte Koalitionen zu ermöglichen oder zu verhindern.
Wuttke: Und was lässt sich daran ablesen? Man kann ja entweder überlegen, ich unterstütze die Wunschkoalition, die ich habe, oder aber ich überlege, eine Partei zu wählen, um die mögliche Koalition nicht zustande kommen zu lassen. Wie wählerisch, wie kompetent sind denn die deutschen Wähler da?
"Mit der Blutgrätsche ins Koalitionskalkül"
Huber: Sie sprechen es ja schon an, es gibt unterschiedlichste Kalküle, die die Wähler anlegen können, und die sind auch hochkomplex im deutschen Mehrparteiensystem. Es hängt ja nicht nur davon ab, was die aktuellen Prognosen machen, wie man die vielleicht tatsächlich auch kennt, inwieweit man sein strategisches Verhalten dann strategisch ausrichten muss, sondern es liegt auch daran, wie man einschätzt, welche Koalitionen sich denn nach der Wahl mit welcher Wahrscheinlichkeit bilden könnten. Das hängt also ganz besonders davon ab, inwieweit die Parteien auch klare Signale aussenden, welche Koalition sie gerne bilden würden.
Wuttke: Und es geht immer um Koalitionen, die sie gerne sähen, oder wählen manche Menschen auch so als Quereinsteiger, so schräg hinein mit einer Blutgrätsche, dass sie durchaus in Kauf nehmen, dass, um es mal etwas salopp zu sagen, sie im großen Ganzen ihre Stimme auch verplempern, und zwar absichtsvoll?
Huber: Wir haben schon auch einige Erkenntnisse dazu gehabt, insbesondere bei der Bundestagswahl 2005, dass manche sich die Große Koalition gewünscht haben, aber dann nicht eine der beiden Parteien gewählt haben, sondern die Linke. Das erscheint erst mal rational, denn die Koalition mit der Linken wurde ausgeschlossen von beiden Parteien, und wenn die Linke es geschafft hat im Bundestag, dann war die Wahrscheinlichkeit größer, dass auch eine tatsächlich Große Koalition sich daraus bildet. Ich bin mir nicht sicher, wie weit diese Befunde wirklich belastbar sind.
Wuttke: Aber was sagt denn die Wissenschaft? Ist wirklich allen klar, worüber Erst- und Zweitstimme entscheiden?
Huber: Nein! Ganz im Gegenteil. Da ist eine sehr große Verwirrung, die die Parteien zum Teil auch ausnutzen. Insbesondere die kleinen Parteien – also die FDP ist darin der Meister mit ihren Zweitstimmenkampagnen, die ein bisschen suggerieren, als ob die Zweitstimme weniger wichtiger sei und sie deswegen auch von einem Unionsanhänger an den kleinen Koalitionspartner, die FDP, ausgeliehen werden könnte.
Wuttke: Also klar und knapp von Ihnen: Wofür dient die Zweitstimme, wofür die Erststimme?
"Die Zweitstimme entscheidet"
Huber: Die Zweitstimme ist die alles entscheidende Stimme im Deutschen Bundestag, die darüber bestimmt, wie die Sitzverteilung aussieht. Das gilt umso mehr jetzt mit dem neuen Wahlrecht, in dem die Überhangsmandate vollständig ausgeglichen werden. Sie müssen sich also bei Ihrem Wahlakt vorstellen, dass die Zweitstimme potenziell Ihre einzige Stimme ist, um den Wahlausgang zu bestimmen. Die Erststimme hat darauf überhaupt keinen Einfluss. Die Erststimme dient nur dazu, zu bestimmen, welcher Direktkandidat in den Bundestag einzieht.
Wuttke: Sie haben gerade das Stichwort "Überhangmandate" genannt und das neue Wahlrecht. Vielleicht können Sie vor diesem Hintergrund noch mal erklären, warum die Union überhaupt gar kein Interesse an einer Zweitstimmenkampagne für die FDP hat.
Huber: Jede Stimme, die sie an Zweitstimmen nicht bekommt, schadet der CDU in ihrer Sitzstärke. Das war früher auch in fast allen Fällen so, aber zum Teil, in wenigen kleinen Fällen konnte es passieren, dass durch die Überhangmandate, sie dann auch gewonnen hat, wenn sie keine Zweitstimme bekommen hat. Aber das ist jetzt definitiv nicht mehr der Fall.
Wuttke: Sie haben gesagt, viele Wähler wissen nicht, was eigentlich der Unterschied und die Gewichtung von Erst- und Zweitstimmen sind – ist das Wahlrecht in Deutschland immer noch viel zu kompliziert?
"Das deutsche Wahlrecht ist zu kompliziert"
Huber: Ich denke, dass das Wahlrecht doch große Anforderungen an den Wähler stellt. Es sind zwei Stimmen, und es muss dem Wähler erst mal klar sein, dass diese Stimmen nicht irgendwie in der Kombination ausgewertet werden. Also auch wenn man Splitting betreibt, ist es nicht so, dass das eine Präferenz ausdrücken würde für eine bestimmte Koalition. Sondern die werden getrennt ausgerechnet, und nur die Zweitstimme entscheidet eben über den Stimmanteil der Parteien.
Was ich für Untersuchungen schon dazu gemacht habe, ist, dass ich unterschiedliche Studienexperimente durchgeführt habe, auch in Neuseeland und in Österreich, weil Neuseeland hat dasselbe Wahlsystem wie Deutschland, nur dort wurde Folgendes gemacht, dass diese verwirrende Benennung der Stimmen umgedreht wurde und dass einfach die Zweitstimme als Erstes abgefragt wird zunächst mal. Das scheint ja auch semantisch irgendwie normal zu sein, dass das Erste wichtiger sei. Und das ist genau das Verwirrende am deutschen Wahlsystem. Und die wurde dann benannt – also unsere Zweitstimme – als Party Vote, und die Wahlkreisstimme wurde entsprechend als Electorate Vote benannt. Das, zeigen zumindest meine Untersuchungen, führt dazu, dass die Leute weniger verwirrt sind und vielleicht auch weniger Fehler bei ihrer Stimmabgabe machen.
Wuttke: Also: Zweitstimme Partei, Erststimme Kandidat. Reformiert wurde ja auch das Briefwahlrecht. Mehr Menschen denn je, das liegt an eben dieser Reformierung, haben jetzt davon Gebrauch gemacht. Das heißt, die heiße Phase des Wahlkampfs ist für diese Briefwähler sowieso kalter Kaffee. Macht das den Ausgang der Wahl für Sie noch spannender?
Huber: Weiß ich nicht. Ich glaube, dass auf der anderen Seite natürlich sehr viele Wähler stehen – zumindest sagen sie uns das –, die sich sehr, sehr spät entscheiden. Ich denke, es gab schon immer Leute, für die relativ klar war von Anfang an des Wahlkampfes, welche Parteien sie wählen werden. Die wählen jetzt vermehrt mit Briefwahl. Ich glaube, es ist weniger der Grund, dass das Wahlrecht sich umgestellt hat, sondern der Grund liegt, glaube ich, vor allem darin, dass die Mobilität einfach zugenommen hat, viele nicht wissen, sind sie an diesem Sonntag überhaupt in ihrem Ort und so weiter.
Wuttke: Sagt Sascha Huber von der Uni Mannheim, Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung. Besten Dank, Herr Huber!
Huber: Danke!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.