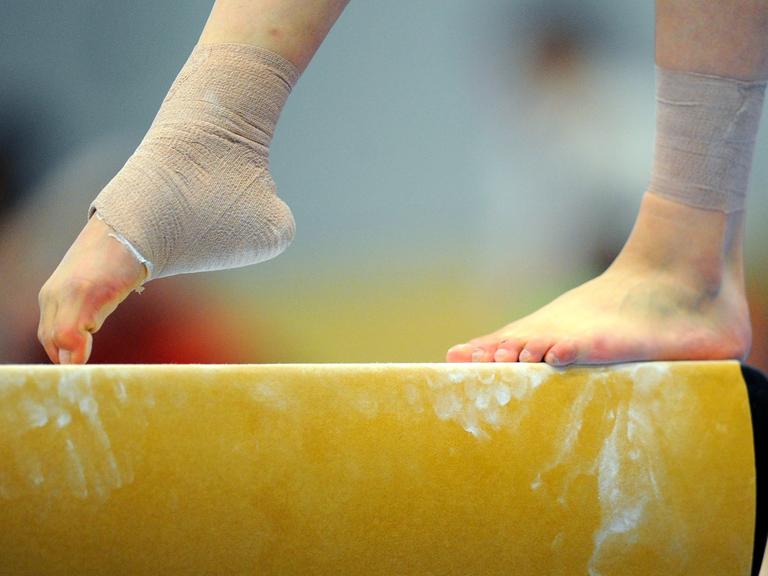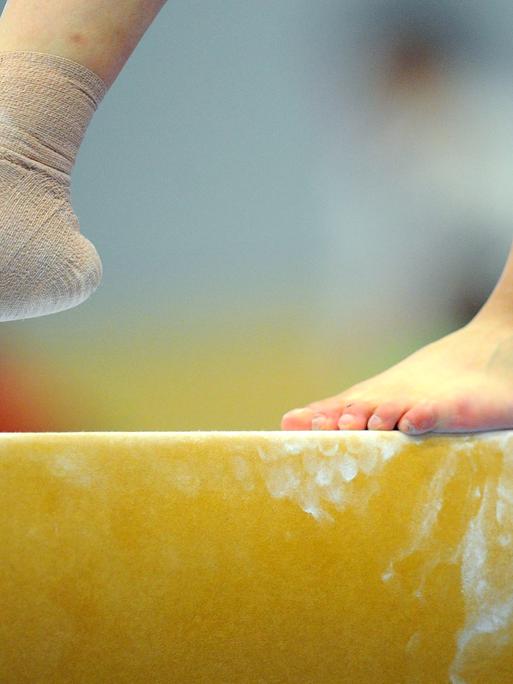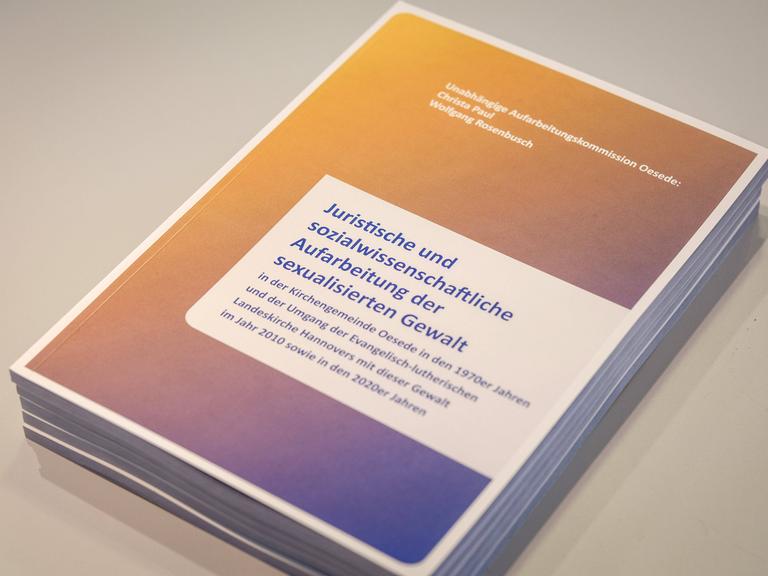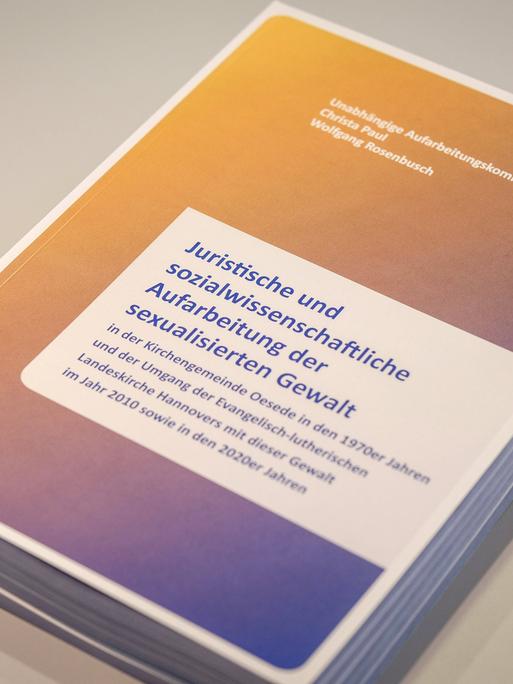Wie Glaube sexuell ausgenutzt wird

Wie viele Ordensfrauen sexuellem Missbrauch ausgesetzt sind, dazu gibt es keine Zahlen. Doch eine Studie wirft ein Schlaglicht auf das Thema – und offenbart, wie Gehorsam, Hingabe und andere "spirituelle Ideale" Missbrauch begünstigen können.
„Bis in die 1990er-Jahre wurde über Missbrauch an Ordensfrauen nur hinter vorgehaltener Hand und verschämt gesprochen. Dafür gibt es gute Gründe. Wer davon redete, musste mit Diskriminierung rechnen”, schreibt die Theologin Barbara Haslbeck. Auch heutzutage wird darüber kaum gesprochen, manchen Betroffenen nicht geglaubt – oder ihnen sogar die Schuld am Geschehen zugeschoben.
Wie viele Ordensfrauen hierzulande von Missbrauch betroffen sind, dazu gibt es keine belastbaren Daten. Die Daten- und Studienlage ist hierzulande dünn. Eine Studie aus den USA spricht davon, dass rund 30 Prozent der Nonnen sexuelle Übergriffe erlebt haben. Eine Zahl, die zumindest darauf hinweist, wie groß das Problem auch in Deutschland sein könnte.
In der öffentlichen Debatte geht es beim Thema Missbrauch in der Kirche meist vor allem um Minderjährige, vielfach männlich Betroffene. Nun ist aber eine Studie herausgekommen, die ein Schlaglicht auf ein bisher wenig beachtetes Thema wirft: den Missbrauch an Ordensfrauen. Die Theologin Barbara Haslbeck, die an der Universität Regensburg forscht, hat dafür mit 15 betroffenen Ordensfrauen aus dem deutschsprachigen Raum gesprochen und die Interviews wissenschaftlich ausgewertet. In der von der katholischen Fidel-Götz-Stiftung finanziell unterstützten Studie dokumentiert sie, wo und wie die Betroffenen die Übergriffe erlebt haben – und welche gravierenden psychologischen Folgen dies für sie hat.
Die Studie belegt außerdem eindeutig: Missbrauch von Ordensfrauen gibt es nicht nur – wie vielfach eingeräumt – in anderen Ländern, sondern auch hierzulande. Und sie offenbart eine „Dramaturgie“ des Missbrauchs: Die Tatmuster bei der Anbahnung, die Strategien und die Selbstdeutungen der vermeintlichen Täter und Täterinnen ähneln sich in frappierender Weise, sagt Haslbeck.
Eine „Dramaturgie” des Missbrauchs
Für die meisten Frauen beginnt der Missbrauch in der Anfangsphase der Zugehörigkeit zu ihrer Gemeinschaft. Dieser kommt nicht plötzlich. Vielmehr testen die in der Studie benannten Tatpersonen die Grenzen in kleinen Schritten aus. „Das beginnt damit, beim Spazierengehen mal die Hand auf die Schulter zu legen – oder in einem geistlichen Gespräch geht es dann um sexuelle Themen”, beschreibt Haslbeck das Vorgehen. Das Verhalten werde immer intimer, wirke auf die Frauen aber lange noch, als sei es Teil der geistlichen Begleitung.
„Es ist ganz normal, als junge Ordensfrau geistliche Begleitung zu haben, Gespräche zu führen – und da in Gesprächszimmern die Tür hinter sich zuzumachen, in einem ganz exklusiven Setting zu zweit allein zu sein, zu beichten, Eucharistie zu feiern. Alles das ist etwas, wo niemand anderer sagen würde: Da stimmt etwas nicht. Und so wird schleichend die eigene Wahrnehmung mehr und mehr außer Kraft gesetzt.”
Bei den in der Studie genannten mutmaßlichen Tätern handelt es sich meist um geistliche Begleitpersonen. Im Durchschnitt sind sie rund 20 Jahre älter als die Frauen. Viele der Befragten bauen zunächst ein Vertrauensverhältnis zu ihnen auf und offenbaren ihnen ihre Probleme: „Es war ein großes Vertrauen entstanden, weil er mich immer aufgefangen hat, wenn es mir schlecht ging, am Telefon immer getröstet hat und wir dann stundenlange Gespräche hatten”, erzählt eine der Frauen, die an der Studie teilgenommen hat.
Irgendwann kommt dann der Punkt, an dem den betroffenen Frauen klar wird: Hier finden sexuelle Handlungen statt. Einen solchen Moment beschreiben einige der Frauen als eine Art Kipppunkt. Das zuvor vertrauensvolle, vielleicht auch freundschaftliche Verhältnis wandelt sich in eine Beziehung der sexuellen Ausbeutung oder Gewalt.
Manche Frauen würden sich so schämen und schuldig fühlen, dass sie mit Dissoziation reagieren: einem Schutzmechanismus der Psyche, bei dem die Betroffenen Gefühle und Erfahrungen, die sie nicht in ihr Selbstbild integrieren oder emotional verarbeiten können, abspalten. Haslbeck beschreibt diese Abspaltung aus der Sicht der Betroffenen so: „Hier findet etwas statt, das verletzt mich in meiner tiefsten Identität. Eigentlich darf das als Ordensfrau ja gar nicht stattfinden.” Deswegen würden manche das Ganze als eine Art Paralleluniversum erleben.
Warum es so schwer ist, sich zu wehren
Zweidrittel der befragten Frauen berichten davon, dass sie bereits als Kind sexuell missbraucht wurden. „Das heißt, sie haben schon die Erfahrung machen müssen, dass ihre Grenzen nicht respektiert werden”, sagt Haslbeck. Dies macht es schwer, sich zu wehren.
Hinzu kommen „spirituelle Ideale”, die sich ungünstig auswirken können – beispielsweise das Ideal des Gehorsams oder der Hingabe. Diese „theologischen Argumente” würden die Tatpersonen gezielt nutzen, um die Frauen zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Dabei gibt es der Studie zufolge zwei Varianten: Entweder sie betonen, der Missbrauch solle die Liebe Gottes versinnbildlichen. „Da deuten Täter die sexuellen Handlungen als Heilungshandeln”, so Haslbeck. Eine der in der Studie Befragten schildert das wie folgt: „Und dann hat er gesagt, dadurch will Gott mir eine besondere Gnade schenken. Gott will mir dann helfen. Er will mich dadurch heilen. Und nur mit Liebe kann man geheilt werden.”
In der anderen Variante deutet der Täter den Missbrauch als eine Unterordnung. „Dass es Gottes Wille sei, dass diese Situation so stattfinden soll”, so Haslbeck.
Die geistliche Begleitung stellt also – so Haslbeck in ihrer Studie – ein Risiko-Setting dar. „Der Beichtpriester hat einen strukturellen und spirituellen Machtüberhang. Wenn mit diesem Unterschied nicht reflektiert und bewusst umgegangen wird, erhöht sich das Risiko für Manipulation durch die Begleitpersonen.”
Weitere Aspekte religiöser Gemeinschaften, die Missbrauch Vorschub leisten können, sind hierarchische Strukturen, dysfunktionale, hierarchische Kommunikation und die Tabuisierung von Sexualität. Gemeinschaften, in denen das Individuum in besonders starker Weise von der Ideologie der Gemeinschaft vereinnahmt wird, bezeichnet Haslbeck daher auch als „Hoch-Risiko-Gemeinschaften". „Kennzeichen dafür sind Abschottung von der Außenwelt, starke Kontrolle und Isolierung der Mitglieder sowie zensierte Kommunikation in der Gruppe, kein oder nur wenig Zugang zu Medien, kaum Kontakte nach außen.”
Frauen als Täterinnen
In den meisten Fällen, die in der Studie beschrieben werden, sind die genannten Täter männlich. In der Studie werden aber auch Frauen als Täterinnen genannt. Und es gibt Frauen, die als Komplizinnen fungieren.
Ein offenes Geheimnis
Viele der betroffenen Frauen schildern, dass sie nicht die Einzigen waren, die Missbrauch durch den genannten Täter oder die Täterin erfahren haben. Auch bestätigen manche, dass es Mitwisser gegeben habe. Es scheint also eine Art offenes Geheimnis zu sein.
Trotzdem betont die Theologin Barbara Haslbeck, aus ihrer Sicht sei das Thema bei der katholischen Kirche „absolut angekommen“. Wichtig sei, „dass die Orden eine eigene Systemlogik haben und dass dort dann auch die Verantwortung dafür liegt, dieses Thema in der Intervention und in der Prävention aufzugreifen”. Das geschehe – je nach Gemeinschaft – unterschiedlich gut. „Es gibt nach wie vor sehr viel Abwehr und es gibt Protagonistinnen und Protagonisten, die sich sehr bemühen.”
Gegen fünf der in der Studie genannten mutmaßlichen Täter wurde ein kirchliches Verfahren eingeleitet, das für vier von ihnen Konsequenzen hatte. Einer wurde aus seiner Gemeinschaft ausgeschlossen. Bei zwei der mutmaßlichen Täter, gegen die ein Kirchenverfahren lief, wurde zusätzlich ein staatliches Strafverfahren eröffnet; eines davon wurde eingestellt. In zwei weiteren Fällen wurden keine Verfahren mehr eingeleitet, weil die betreffenden mutmaßlichen Täter bereits verstorben waren.
Onlinetext: Leila Knüppel