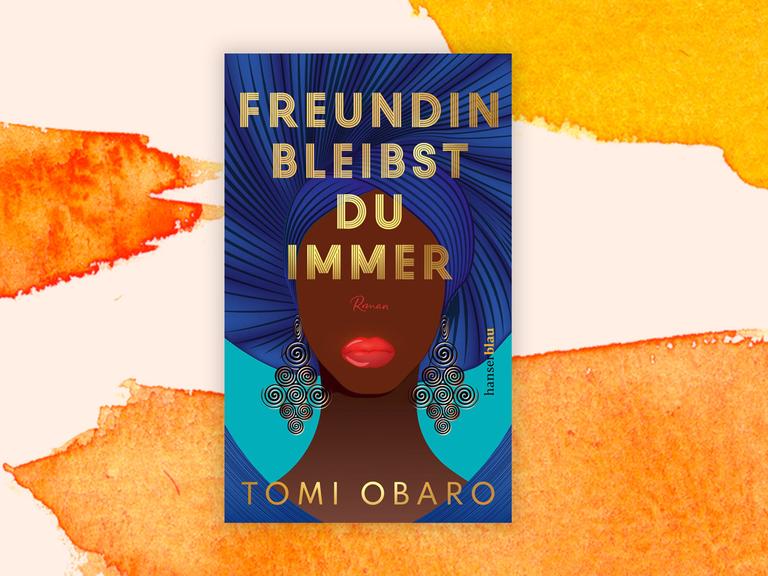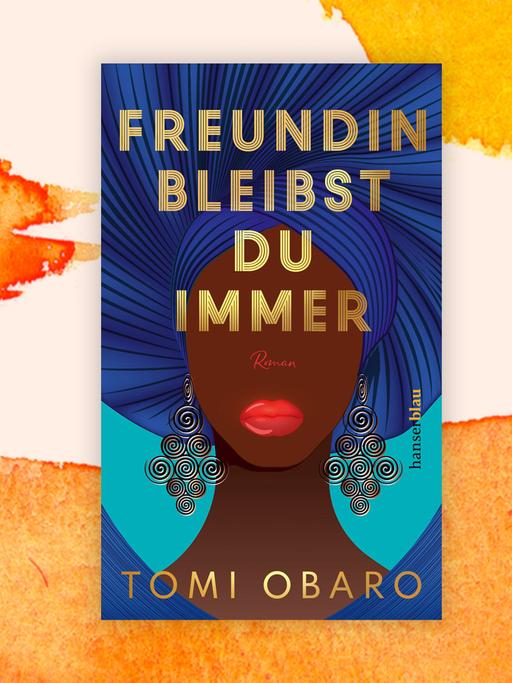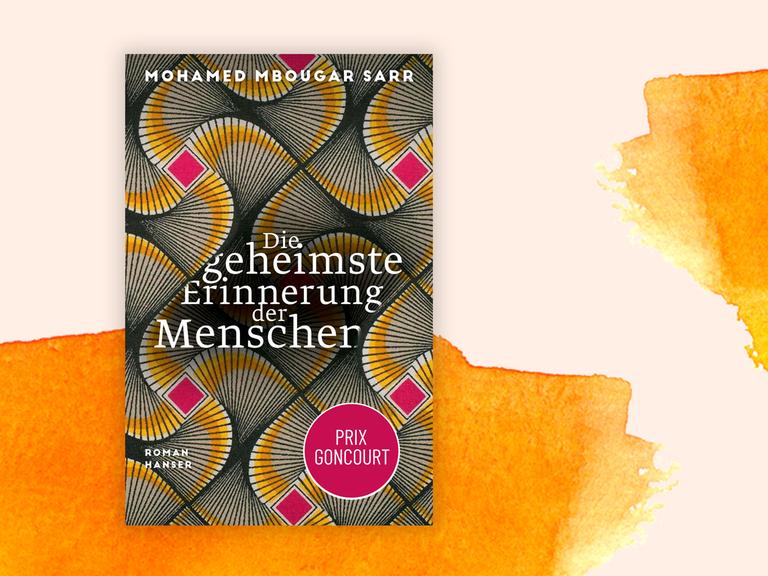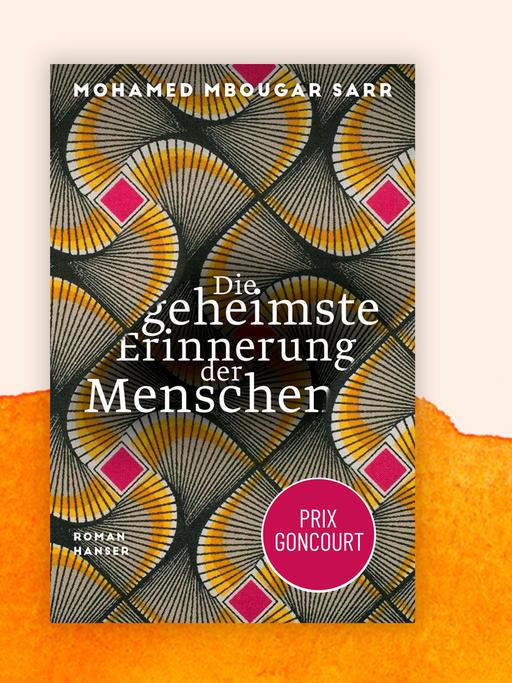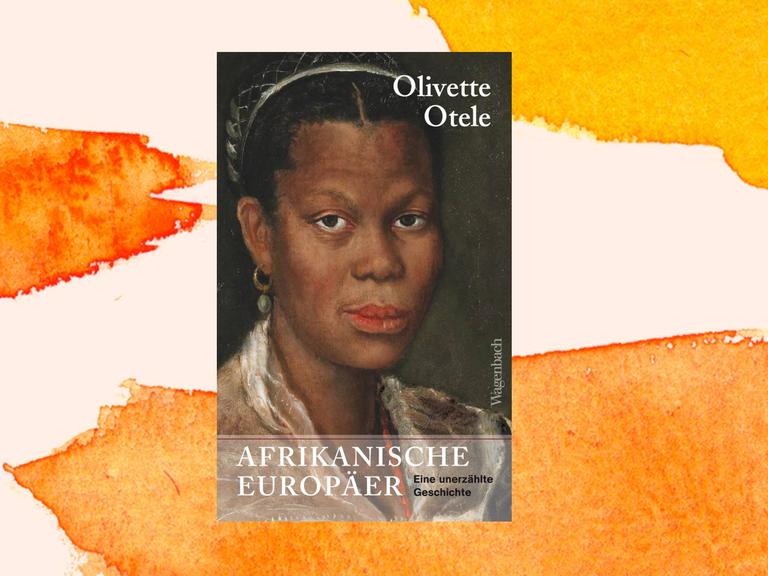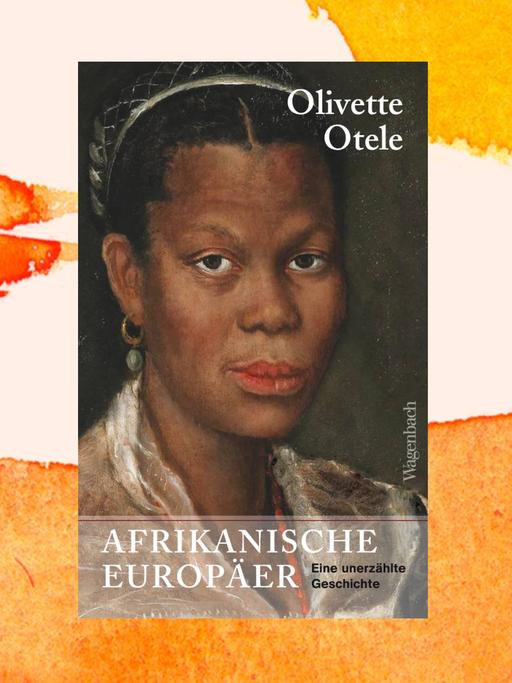Sefi Atta: "Ein sonderbarer Immigrant"
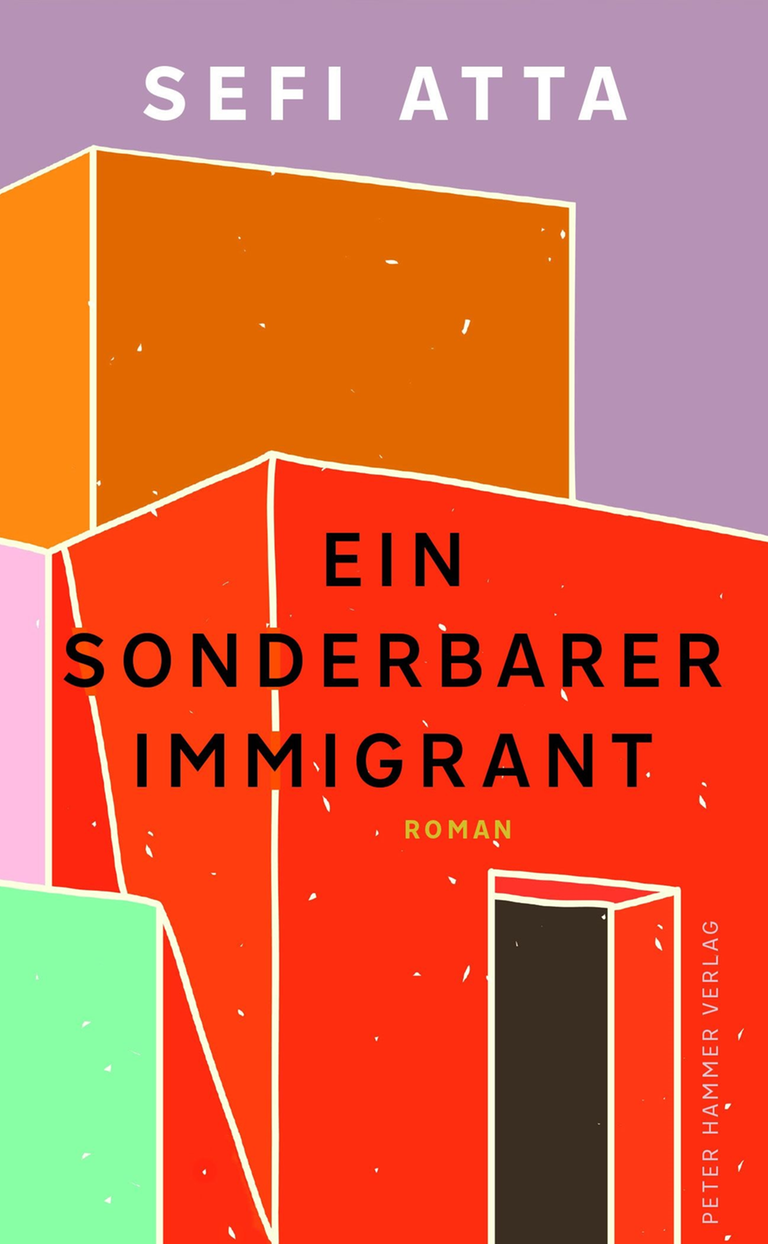
© Peter Hammer
Kein "Weißer ehrenhalber"
06:00 Minuten
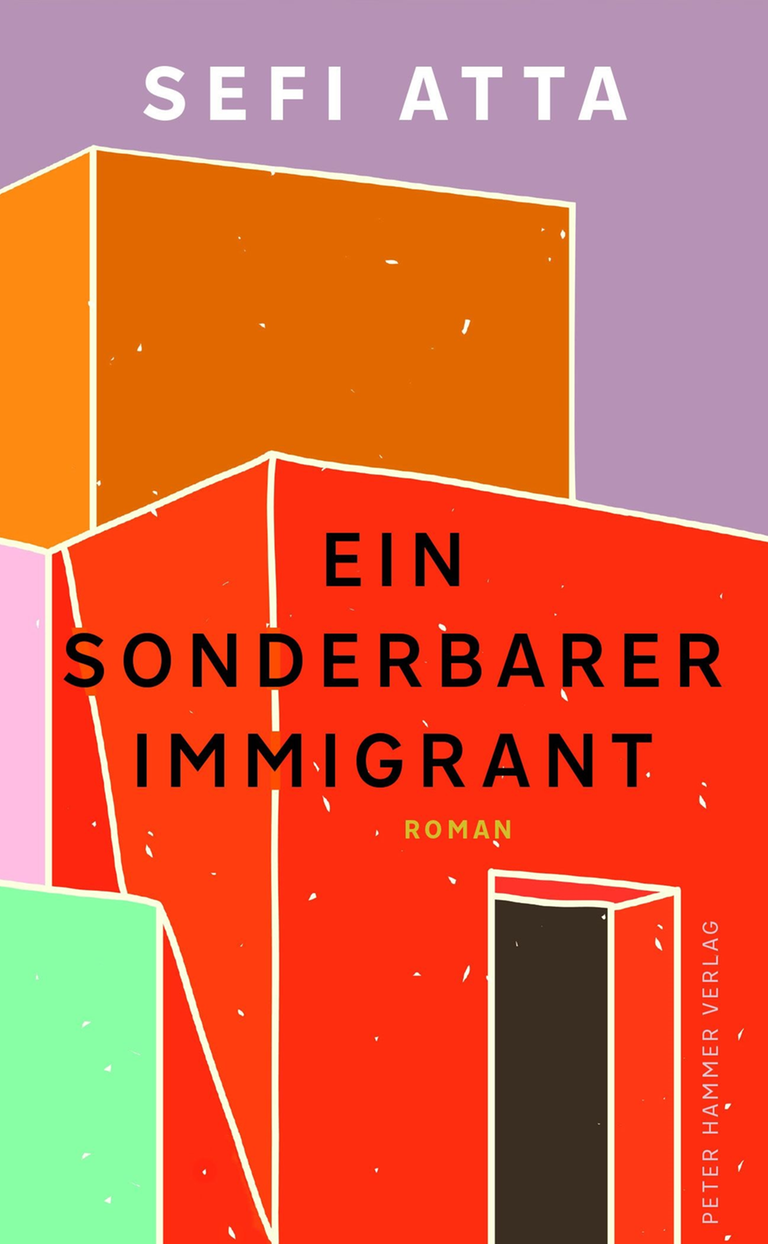
Sefi Atta
Übersetzt von Simone Jakob
Ein sonderbarer ImmigrantPeter Hammer , Wuppertal 2022456 Seiten
30,00 Euro
Einer dieser guten Einwanderer will er nicht sein. Erwartungen sind Lukom Karim, dem Protagonisten in "Ein sonderbarer Immigrant", zuwider. Schmerzlich treffend und unterhaltsam erzählt die Autorin Sefi Atta vom Auswandern und Ankommen in einem anderen Land.
Allein wäre der Literaturwissenschaftler Lukmon Karim nicht auf die Idee gekommen, in die USA auszuwandern. Aber seine Frau Moriam weiß, dass sie sich die Ausbildung ihrer Kinder in Nigeria nicht leisten können, nimmt an der Green-Card-Lotterie teil und gewinnt.
Die Familie zieht 1999 in die USA und kommt zunächst in New Jersey unter, drei Umzüge später landet sie letztlich in Mississippi. Dort lebt auch die Autorin Sefi Atta, die ebenfalls in Nigeria geboren wurde, genauso wie der Protagonist, Erzähler und „sonderbare Immigrant“ aus ihrem neuen Roman.
Die Kinder haben es leichter als die Eltern
Eine Familiengeschichte wie die der Karims ist aus vielen Einwanderungsromanen bekannt: Die Kinder gehen zur Schule und passen sich sehr viel leichter an die US-amerikanische Gesellschaft an als die Eltern.
Moriam macht einen Weiterbildungskurs, um in den USA als Krankenschwester zu arbeiten. Lukmon sucht sich zunächst einen Job, um Geld zu verdienen. Später wird er vorübergehend Hausmann, weil seine Frau eine Anstellung hat und er noch herausfinden muss, wie er einen Lehrauftrag an einem US-amerikanischen College bekommen kann.
Lukmon betrachtet die USA mit Argwohn. Er will ein schlechter Einwanderer sein, keiner der vielen Einwanderer, die „Weiße ehrenhalber“ werden wollen. Da er der Ich-Erzähler dieses Romans ist und vor allem in inneren Dialogen spricht, liefert er Kommentare und Einschätzungen zu jedem und allem: sei es zu seinem Cousin, der sich völlig dem Kapitalismus verschrieben hat, oder zu einem ehemaligen Kollegen, der als Autor mit einem als Memoir vermarkteten Buch über seine gänzlich erfundene Kindheit erfolgreich ist.
Rassismus und Klassismus
Ob es um Rassismus in den USA, Klassismus in Nigeria, die Identifikation als Yoruba oder Igbo in Westafrika geht – Lukmon benennt, kritisiert und zieht seine Schlüsse. Es gelingt Atta, dass Lukmons Einschätzungen und Kommentare aus seiner Perspektive nachvollziehbar sind, ohne dass man sie teilen muss.
Lukmon weiß, warum er in die USA gekommen ist. Dennoch missfällt ihm der amerikanische Akzent seiner Kinder und viele ihrer Entscheidungen, auch wenn sie letztlich zum Erfolg führen.
Moriam ist für ihn vor allem eine nörgelnde Ehefrau mit zu viel Freude an Klatsch und Tratsch – die Lesenden aber sehen, wie hart sie arbeitet und dass sie am neuen Wohnort Freundschaften schließt.
Annäherungen über die Literatur
Lukmon ist ein Mann, der in einer anderen Gesellschaft leben muss, und seinen Weg nur widerwillig sucht. Er wird ihn über die Literatur finden – zum Glück. Denn dadurch enthält „Ein sonderbarer Immigrant“ viele Einblicke in die US-amerikanische und afrikanische Literatur.
So bringt Lukmon westliche Leseerwartungen auf den Punkt: Bürgerkrieg und Diktatur müssen in einem Roman aus Afrika schon vorkommen, während weiße US-Amerikaner ganze Bücher über Alkoholismus oder außereheliche Affären schreiben.
Er sieht, dass Titel aus anglophonen gegenüber frankophonen Ländern und Autoren gegenüber Autorinnen bevorzugt werden. Und er liefert allerhand bissige Urteile zu Büchern, beispielsweise zu den Kurzgeschichten von Ernest Hemingway: „Der Mann ging nach Afrika, um Tiere zu töten. Es war ihm egal, was die Kolonialherren dort trieben, und alles, was er von Afrikanern hören wollte, war: 'Ja, Bwana“'.
Immigranten sind keine fehlerlosen Menschen
Bei alldem spielt Attas Roman selbst mit den Erwartungen, die man an einen Einwanderungsroman stellt. Immigranten sind keine fehlerlosen Menschen, auch sie haben Vorurteile.
Lukmons scharfe Beobachtungen sind oft schmerzlich treffend und sehr unterhaltsam. Er lehnt Kategorien ab und denkt doch selbst in welchen. Am Ende glaubt er zwar nicht, dass Literatur die Welt verändert. Aber immerhin hat sie ihm geholfen, seine Frau, seine Kinder und die Menschen um ihn herum besser zu verstehen.