Mit Karaoke und menschlicher Zuwendung gegen die Nöte an Bord
13:30 Minuten
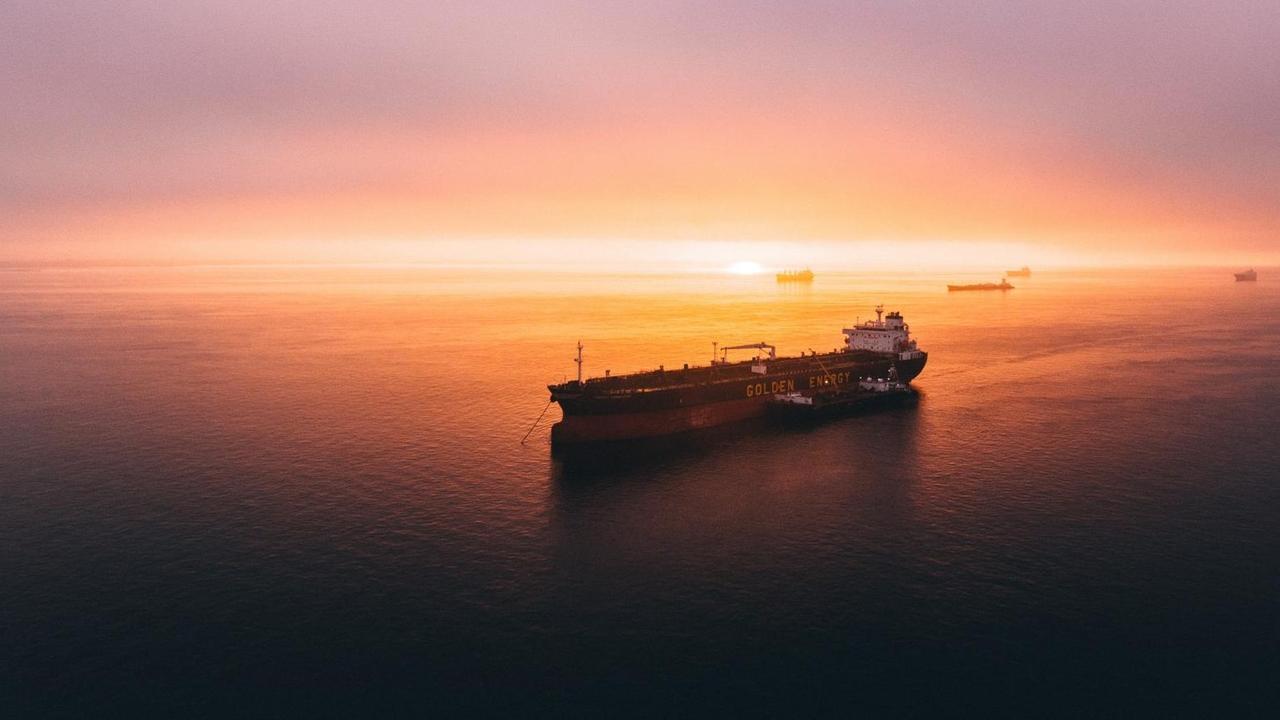
Piraten, Todesfälle und verlassene Crews, die monatelang auf dem Schiff ausharren - in Kameruns Hafenstadt Douala kümmert sich die Seelsorgerin Silvie Boyd um ihre Sorgen und Nöte. Sie organisert Essen, Medizin und manchmal sogar Karaoke-Shows.
Anne Françoise Weber: In der vergangenen Woche hatte ich die Gelegenheit, eine Seelsorgerin zu treffen, die mit Menschen zu tun hat, die wochenlang in ziemlicher Einsamkeit festsitzen – und zwar auf Schiffen. Silvie Boyd arbeitet seit mehr als einem Jahr für die Deutsche Seemannsmission in Kamerun. Zuvor war sie in der Jugendarbeit der Evangelischen Kirche in Hamburg tätig. Jetzt ist die ausgebildete Diakonin und Sozialarbeiterin Hafenseelsorgerin und zugleich Leiterin des Seemannsheims in der Wirtschaftsmetropole Douala. Dort konnte ich sie sprechen und habe sie zunächst gefragt, wieso es überhaupt eine Station der Deutschen Seemannsmission in Douala in Kamerun gibt.
Silvie Boyd: In den 60er Jahren gab es hier am Hafen und in seiner Umgebung - wie in vielen anderen Hafenstädten weltweit - sehr viele Vorfälle mit, ich sage mal, eher angetrunkenen Seeleuten, die nicht wussten, wo sie hinkommen, die keine Unterstützung hatten, wenn sie hier in der Stadt Bedürfnisse hatten, also etwas einkaufen wollten oder medizinische Versorgung brauchten. Damals hat man weltweit geguckt, wo ist Bedarf da? Und es gab hier nichts in der Gegend und niemanden, der das machte.

Als Hafenseelsorgerin kämpft Silvie Boyd auch gegen die "Seeblindheit" vieler Leute an Land: Die Leistung schlecht bezahlter Seeleute werde zu wenig gewürdigt.© Roméo Ghislain Zafack
1964 gab es einen Pakt mit dem Auswärtigen Amt und der République du Cameroun. Wir haben einen Partner hier vor Ort gefunden, da wir immer mit Partnern zusammenarbeiten. Da es hier keine deutsche Gemeinde gibt, arbeiten wir mit der Eglise Evangélique du Cameroun. Der Pakt ist für 60 Jahre geschlossen, das heißt, er läuft 2024 aus. Wir sind hoffentlich dabei, ihn zu erneuern.
Zusammenarbeit mit Künstlern aus Kamerun
Weber: Aber sicherlich hat sich die Arbeit verändert seit 1964. Was ist heute anders?
Boyd: Wir haben – wie überall weltweit – mit einem relativ kleinen Haus angefangen, mit maximal zwölf Zimmern. Das haben wir eigentlich überall so gemacht: Erst mal klein anfangen und gucken, wie hoch ist der Bedarf. Früher war das auch so, dass die Liegezeiten der Schiffe länger waren, weil es einfach alles noch nicht so automatisiert war. Und auch der Austausch der Crew findet logischerweise in Hafenstädten statt. Da Douala auch einen Flughafen hat, haben viele Seeleute auch hier übernachtet.
Heutzutage sind die Liegezeiten viel kürzer. Wir haben immer mal wieder Übernachtungen von Seeleuten, aber insgesamt ist das stark zurückgegangen. Wir haben viel mehr Offshore Companys, die im Hafen arbeiten, aber die hier dauerhaft ihre Techniker und Kapitäne und so weiter einquartieren, die dann sozusagen die Schiffe umsiedeln. Insgesamt ist seit ungefähr 20 Jahren eine Öffnung auch zu der kamerunischen Bevölkerung zu verzeichnen. Wir bieten eben nicht nur Aktivitäten für Seeleute, sondern eben auch kulturelle Dinge mit kamerunischen Künstlern, um auch ein bisschen was für die Restaurantgäste zu bieten oder für die internationalen Hotelgäste, die hier übernachten.
Notfall-Versorgung für verlassene Schiffscrews
Weber: Sie sind aber hier nicht nur für das Heim verantwortlich, sondern Sie gehen auch in den Hafen und machen wirklich Seelsorge mit den Seeleuten?
Boyd: Ja! Wir sind jeden Morgen im Hafen von montags bis samstags. Ich würde auch sonntags gehen. Die arbeiten auch durch im Hafen. Aber für die Außenwelt sozusagen ist er geschlossen – und das ist hier leider an den Feiertagen genauso, dass von oben entschieden wird, der Hafen ist dicht. Wir hatten zum Beispiel, seit ich übernommen habe, zwei Fälle von verlassenen Schiffen, wo die Crew halt für neun Monate bis anderthalb Jahre nicht bezahlt wurde. Wir haben dann die Versorgung übernommen mit Lebensmitteln, mit Trinkwasser, mit Gasol für den Generator, damit die keine Malaria kriegen, mit Medikamenten.
Das ist nicht nur Seelsorge, die wir machen, das ist auch Beratung im Bezug auf ihre Rechte, die sie haben. Arbeitsrecht genauso wie Menschenrechte. Wie geht man um mit dem Reeder, der einen liegenlässt, wenn es einen Motorschaden gibt, den man hier anscheinend nicht reparieren kann? Oder wenn der Cashflow beim Reeder nicht mehr stimmt?
Wir hatten zwei Crews, interessanterweise beides indische Crews: Der eine Reeder war Inder, der andere Reeder Libanese. Die haben wirklich monatelang hier gewartet, dass sie irgendwie bezahlt werden und dass sie hier irgendwie weg können. Und wir haben sie unterstützt und die letzte Crew haben wir sogar hierhergeholt und einquartiert. Die quartieren wir dann kostenlos ein, so lange, bis der Fall gelöst ist. Das hört sich so doof an, "Fall", weil das alles Menschen sind. Also so lange bis die alle Papiere haben, bis sie Flugtickets haben und wirklich zurückgeführt werden können.
Und dann hatten wir noch einen Todesfall an Bord auf einem türkischen Schiff, das war ein Superintendent. Zum Glück sind ja die Superintendenten nicht wirkliche Crewmitglieder, sondern kommen halt, gucken, ob alles so läuft, wie es sein soll. Die sind nicht so im Team oder in der Crew drin, sodass wir noch gesegnet waren, weil es nur diese Position war. Aber die Leute, die ihn tot in seiner Kabine entdeckt haben, die waren natürlich sehr aus den Socken. Sie wollten das nicht zugeben, weil sie ja starke Männer sind. Da haben wir an Bord und auch hier im Foyer mehrmals Gespräche geführt, um einfach zu gucken: Wie man das gut verarbeiten kann, wen man ansprechen kann, wenn man auch in der Türkei zurück ist. Wo man sich Hilfe suchen kann, und wie vielleicht die Familie auch eine Ressource sein kann, um das wirklich nicht in ein Trauma ausarten zu lassen. Der Glaube an sich gibt Hoffnung
Religiöse Unterschiede spielen kaum eine Rolle
Weber: Nun sind die Seeleute ja nicht alle Christen und noch weniger Protestanten. Wie wird da darauf reagiert, dass Sie als Protestantin mit einer Mission kommen? Spielt das eine Rolle?
Boyd: In den meisten Fällen spielt das keine Rolle. Bei den 60 Prozent Philippinos, die wir haben, ist es einfach nur: Okay, sie ist von der Kirche, wir sind alle Christen. Ich wurde sogar schon nach einer Messe gefragt auf einem Schiff. Da habe ich auch klar gesagt, also, Leute, offiziell seid ihr Katholiken und dann müsstet ihr für euch gucken, ob das so richtig ist. Natürlich können wir das gerne machen, aber wir sind nun mal lutherische Kirche. Und die haben gesagt: Für sie ist das überhaupt kein Problem, wir haben alle eine Bibel und wir glauben alle an einen Gott, von daher spielt das nicht so primär eine Rolle.
Es ist eher der Glaube an sich und die Spiritualität, die mitklingt, und auch dieses Hoffnung geben. Es ist nicht in erster Linie, dass ich da rauf gehe und sage: Okay, wenn ich runter gehe, seid ihr jetzt alle bitte evangelisch-lutherisch, und ich konfirmiere euch mal eben schnell. Sondern die Idee ist, das Werk am Nächsten zu tun. Wirklich das Wort, das wir mitbekommen haben, das ist der Auftrag der Diakone, am Nächsten das auszuführen, was in der Theorie, in der Kirche, gepredigt wird.
Auch harte Seeleute brauchen Zuhörer
Weber: Dass Sie da als Frau zelebrieren, mag ja für manche auch besonders ungewöhnlich sein. Haben Sie da manchmal Reaktionen drauf? Überhaupt ist das ja ein ziemliches Männermilieu: Ich weiß nicht, wie viele Frauen da an Bord sind.
Boyd: Ich glaube, das ist manchmal ein Problem. Wenn es zum Beispiel um Gewalt an Bord geht oder eventuell auch sexuelle Übergriffigkeiten, dass es dann natürlich schwierig ist für Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund, das einer Frau anzuvertrauen. Generell fühle ich mich als Frau im Hafen eher angenommen als sonst hier in diesem System. Dass man eher einer Frau anvertraut, wenn man in der Familie ein Problem hat. Das ist ja auch eine Mutter, und dass man einer Frau wahrscheinlich eher dieses Empathische zuschreibt. Von daher denke ich, es sind einige Bereiche, die sind Tabuthemen sicherlich zwischen Mann und Frau. Das respektiere ich auch.

Frachter im Hafen von Douala, Kamerun: 60 Prozent der Seeleute hier sind Philippinos, sagt Silvie Boyd.© Imago / photothek / Thomas Imo
Wir haben auch immer ein gemischtes Team. Es gibt also auch immer einen männlichen Schiffsbesucher, der mit an Bord ist, der ist auch noch Muslim. Per se kann man sagen, dass Ukrainer oder Philippinos schon eher eine christliche Prägung haben. Und die Inder, selbst wenn sie Hindi sind und das praktizieren und andere Nationalitäten da sind, dass das nicht primär Thema ist, dass ich eine Frau bin.
Es ist sogar so, dass sie mich dann eher als Mutterfigur auch ansehen, obwohl ich meistens jünger bin als die Hierarchie, sage ich jetzt mal. Und dann werden vielleicht auch Themen angesprochen, die eher im Bereich von Familie liegen, weil sie weit weg sind und weil sie gehört haben, dass ich Zwillinge habe. Und dann frage ich nach Fotos, und so bekommt man relativ schnell Zugang zu den Männern, die auch Familienväter sind. Und deshalb sind sie ja auch auf See – um ihre Familie zu ernähren. Ich empfinde da eher Willkommen als Abwehr oder Zweifel. Das ist mir fast nie begegnet, würde ich sagen. Niemand wird nach seinem Konfirmationsspruch gefragt
Die einzigen Seelsorger vor Ort
Weber: Sind denn andere religiöse Gemeinschaften im Hafen aktiv? Oder sind Sie sozusagen die einzigen, die überhaupt ein spirituelles Angebot da leisten?
Boyd: Wir sind die einzigen. Wir sind auch die einzigen, die Port Welfare machen. Gerade hat sich hier ein Port-Welfare-Komitee gegründet. Soweit ich das von den Namen her sehen kann, die Leute, die ich kenne, ist da niemand, der irgendeine Glaubensgemeinschaft repräsentiert. Die Port Authorities, die hier den Hafen leiten, sind auch eher zurückhaltend. Wenn sie wissen, was wir schon geleistet haben, sind sie offen – zum Beispiel der Commandant du Port, der ist uns sehr zugewandt.
Aber es gibt kleinere Beamte, die mir schon ganz klar gesagt haben: 'Eigentlich dürften Sie gar nicht in den Hafen. Wir sind ein laizistischer Staat, wir wollen nicht, dass Sie da missionieren.' Aber es ist immer die Frage, wie groß dieses Licht ist. Zum Glück waren es bisher eher kleinere Lichter, und da stehe ich dann halt auch auf und sage: Ich frage niemanden nach seinem Taufschein oder nach seinem Konfirmationsspruch. Und die, denen wir bisher geholfen haben, waren primär keine Christen. Das waren einfach Menschen. Das ist der Nächste, und deshalb ist das unser Auftrag. Ich glaube, die meisten, die das mal irgendwie eine kleine Geschichte mitgekriegt haben, wissen sehr wohl, das wir hier leisten, was sonst niemand hier tut.
Angst vor Piraten, die Seeleute kidnappen
Weber: Wissen Sie denn auch von Seeleuten, die in Kontakt mit Flüchtlingen auf dem Meer waren? Das ist natürlich hier in der Gegend weniger der Fall, aber vielleicht kommen die vom Mittelmeer oder von der westafrikanischen Küste?
Boyd: Nein. Das war noch nie Thema in irgendwelchen Gesprächen, die ich an Bord hatte. Thema ist hier eher die Piraterie, weil es Anfang April leider einen Vorfall gab und ihn auch noch gibt, weil der anscheinend noch nicht aufgeklärt ist. Vier Seeleute, die eine Meile vor dem Hafen hier in Douala auf Anker lagen, wurden gekidnappt: drei Ukrainer und ein Philippino.
Und bis dato haben wir keine Neuigkeiten darüber. Das heißt, die verhandeln noch. Letzten Sonntag gab es einen Überfall auf ein Schiff vor Äquatorialguinea, wo sie anscheinend das ganze Schiff piratiert haben. Das hat sich aber dadurch, dass da auch relativ viele Sicherheitsboote waren, relativ schnell aufgelöst und wurde sozusagen befriedet. Es ist wohl niemand zu Schaden gekommen. Aber es ist ja trotzdem so, dass das per se den Seeleuten Angst macht.
Gestern Abend sprach ich mit einem Kapitän aus Cabo Verde von den Kapverdischen Inseln, der nachts mit einem Flug von Air France ankam. Und der sagte mir, als er das letzte Mal sein Schiff nach Lomé oder Abidjan, also Elfenbeinküste, bringen wollte, sei er extra durch Príncipe und São Tomé durchgefahren, um zu vermeiden zu nah an der nigerianischen Küste zu sein, damit er seiner Crew mit Sicherheit garantieren kann, dass nichts passiert.
Globalisierung verursacht Leiden auf See
Weber: Was haben Sie denn an Programm, was Sie einerseits den Seefahrern bieten, andererseits aber vielleicht auch der Bevölkerung bieten, um überhaupt auf die Seefahrer aufmerksam zu machen?
Boyd: Wir haben im Juni zwei große Events. Einmal ist das für die Seeleute selber ein Karaoke-Wettbewerb. Weil Karaoke bekannterweise eines der größten Hobbys von Philippinos zu sein scheint – und Seefahrer machen da keine Ausnahme. Was mir besonders am Herzen liegt, ist eine Arbeit gegen die sogenannte Seeblindheit. Weltweit ist es so, dass 90 Prozent aller Produkte, die wir konsumieren und von denen wir uns ernähren und leben, über die See zu uns kommen. Fakt ist aber, dass diese Menschen, die dafür sorgen, dass wir an diese Produkte kommen, also die Seeleute, unter Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen auf Schiffen hausen müssen, die vielen nicht bewusst sind.
Wenn ich sage, ich bin Seemannspastorin, dann fragen die mich immer: Was machst du da? Gehst du dahin und betest? Nein! Mir ist es ein Anliegen, dass die Welt versteht, dass das, was wir an Reichtum haben, wie unser ganzes Wirtschaftssystem funktioniert, wie die Globalisierung funktioniert, dass es dank dieser Menschen funktioniert. Gerade in der unteren Hierarchie, also die Techniker, die Deckleute, die werden relativ geringfügig bezahlt. Die, die gut verdienen – davon sind wenige an Bord. Und die Reedereien versuchen natürlich, so viel wie möglich zu sparen.
Das ist eigentlich niemandem bewusst. Das ist egal, ob das in Europa ist oder hier. Ich versuche gerade auch den Kamerunern das ein bisschen näherzubringen. Denn das ist schließlich eine Hafenstadt. Das ist das Wirtschaftszentrum hier. Damit sie verstehen, dass wir alle etwas davon haben, wenn es diesen Menschen besser geht. Denn auf lange Sicht sind wir sozusagen die Ursache für deren Leiden auf See und für die Menschenrechtsverletzungen, die da auch passieren. Und auch für die Arbeitsrechtsverletzungen, denen sie ausgesetzt sind. Wo es einfach schwierig ist, das zu kontrollieren.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.




