Sebastian Junger: Tribe. Das verlorene Wissen um Gemeinschaft und Menschlichkeit
Aus dem Amerikanischen von Teja Schwaner
Blessing Verlag, München 2017
192 Seiten, 19,99 Euro
Ein Appell an die Mitmenschlichkeit
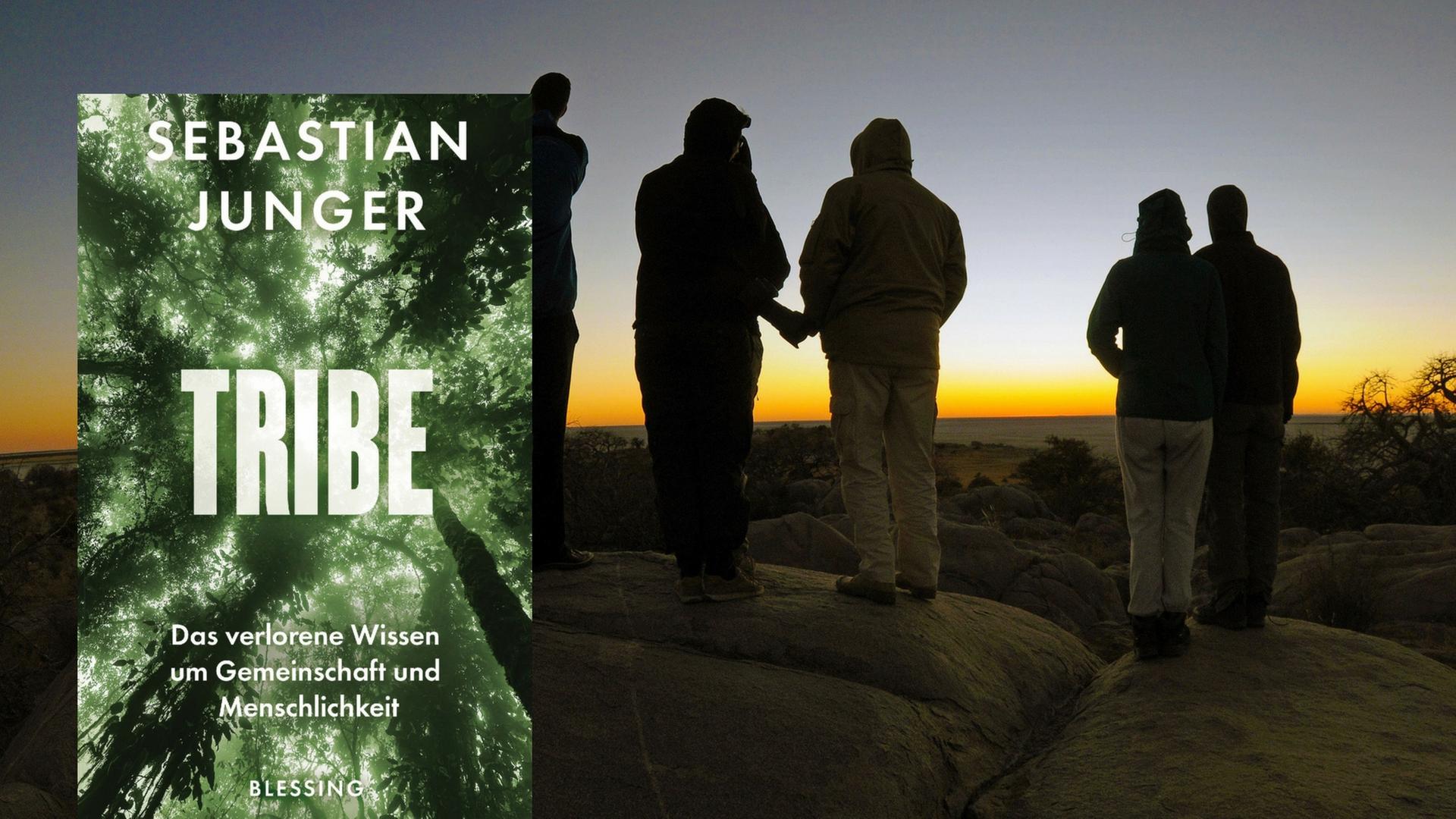
Die moderne Gesellschaft gebe dem Menschen das Gefühl, nutzlos zu sein, meint der Autor Sebastian Junger. Es sei an der Zeit, dem ein Ende zu setzen. In "Tribe" fordert er eine Rückkehr zu einer "Stammeskultur", in der mehr Gleichheit und Gemeinsinn herrsche.
Bosnien-Herzegowina, mitten im Krieg. Einer verletzten jungen Frau gelingt die Evakuierung ins Ausland. Wenig später kehrt sie trotz Krankheit zurück zu ihrer Familie nach Sarajevo, obwohl dort noch immer geschossen wird.
Das ist nur eine von mehreren überraschenden Geschichten, von denen der amerikanische Journalist Sebastian Junger in seinem neuesten Buch erzählt. Menschliches Handeln in Extremsituationen ist sein Thema. Berühmt wurde er mit dem Roman "Sturm", der den Heldenmut von Seeleuten beschreibt, die in Seenot geraten, oder mit "War", einem Buch über seine Zeit als Reporter in Afghanistan, als er mit US-Soldaten in Gefechte mit den Taliban geraten war.
Der fundamentale Mangel an Verbundenheit
Diesmal aber blickt Sebastian Junger auf die Kehrseite solch leidvoller, brutaler Erfahrungen. Den studierten Anthropologen interessiert dabei vor allem die Frage: Warum zieht es Menschen zurück an den Ort des Grauens? Denn das betrifft viele. Wie sonst ließe sich erklären, dass die Einwohner Londons nach dem Zweiten Weltkrieg die gefahrvollen Tage des "Blitz" vermissen, als die Deutschen ihre Stadt bombardierten? Oder weshalb sehnen sich Soldaten nach dem Krieg zurück, aus dem sie gerade heimgekehrt sind? Jungers Antwort ist eine Anklage gegen die moderne Gesellschaft: Krieg und Katastrophen ließen die Menschen zusammenrücken. Sie helfen einander ungeachtet von Herkunft, Rasse oder Religion. Die Geschlossenheit aber verschwinde, sobald der Alltag einkehrt. Übrig bleibe bei vielen daher das Gefühl, nutzlos zu sein.
Dieser "fundamentale Mangel an Verbundenheit" sei es, der etwa Soldaten nach einem Einsatz psychisch krank mache. Zum Beleg seiner These beruft sich Junger auf Studien, die zeigen, dass Depressionen und Traumata viel häufiger bei den Soldaten auftreten, deren soziale Bindungen schwach sind und die über ihre Kriegszeit nicht mit anderen sprechen können.
Die Nähe zu anderen bietet Schutz
Wie sinnlos muss ihnen das eigene Tun erscheinen, wenn die Gesellschaft sich nicht dafür interessiert, fragt der Autor berechtigterweise. Junger fordert deshalb eine Rückkehr zu einer Art "Stammeskultur", wie sie etwa die Ureinwohner Amerikas leben. Deren Gemeinschaftssinn erinnere an den Zusammenhalt, der sich in der modernen Welt nur noch in Ausnahmesituationen herstelle.
Über die Anziehungskraft dieser engen Verflechtungen hatte sich schon Benjamin Franklin gewundert. Selbst weiße Gefangene der Indianer, die befreit wurden, zog es zurück ins Stammesleben der Ureinwohner. Eine Beobachtung, die Junger nicht überrascht. Der Wohlstand werde dort gleich verteilt. Jeder erhalte Anerkennung. Die Nähe zu anderen böte Schutz. Erfahrungen, die die moderne Gesellschaft viel zu wenig macht, mahnt Junger. Das zeige sich nicht nur an der starken Individualisierung, sondern auch an der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich.
Jungers Argumentation liest sich schlüssig und trifft einen Nerv, denn er spricht gesellschaftliche Defizite an, die schon lange diskutiert werden. Wie eine Rückkehr zur "Stammeskultur" konkret aussehen könnte, lässt er allerdings offen. Deshalb bleibt sein – lesenswertes – Buch vor allem eines: ein Appell an die Mitmenschlichkeit.




