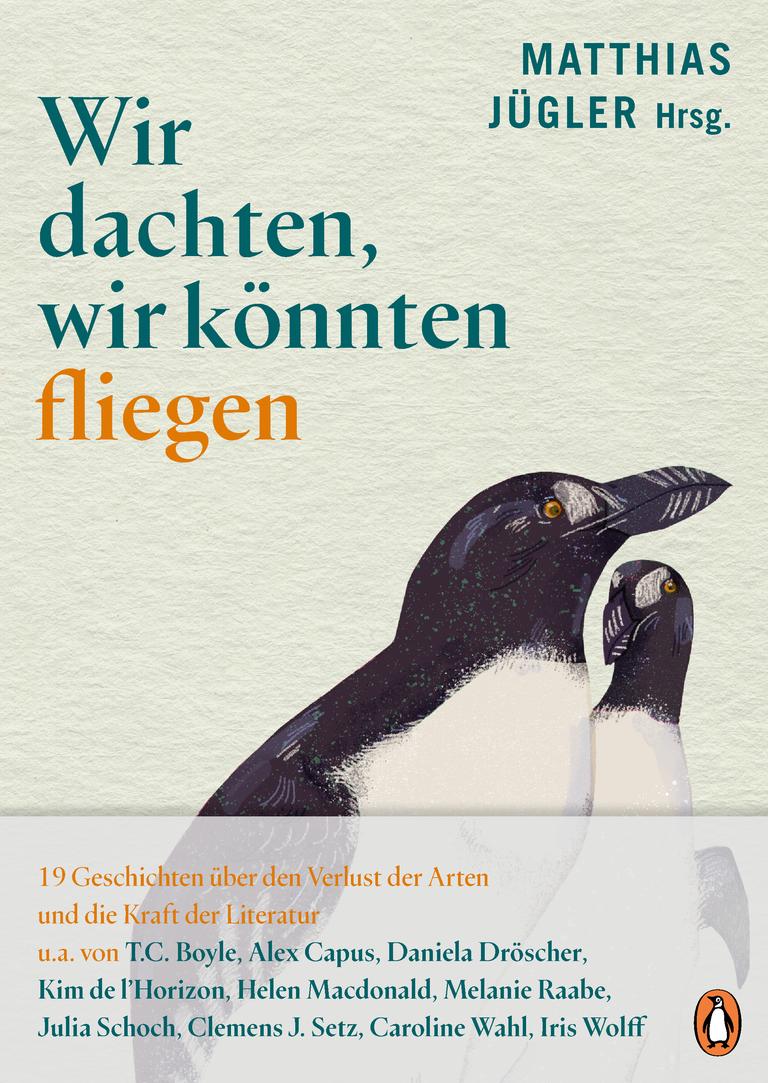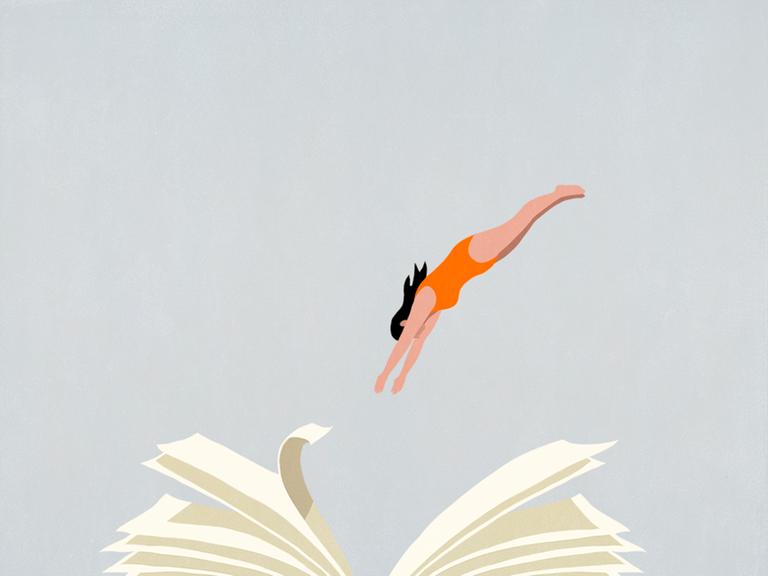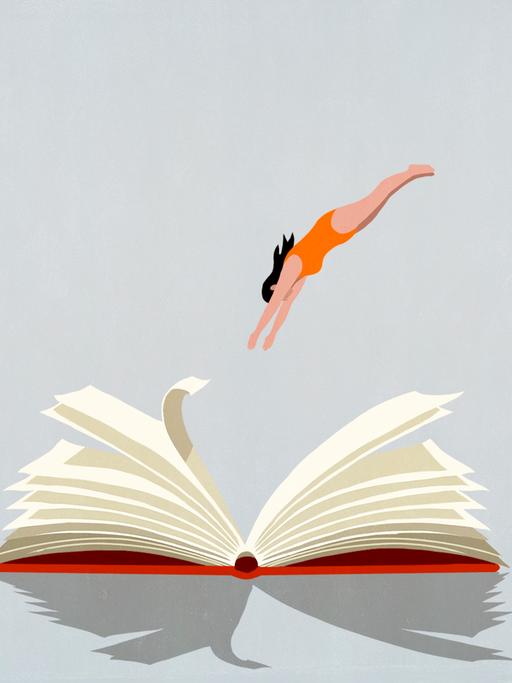Wenn alles zu spät ist, bleiben nur Frust, Trauer und vielleicht das Bedürfnis nach Trost. Die Tier- und Pflanzenarten, denen sich die neunzehn Autorinnen und Autoren in dieser Anthologie zuwenden, waren Teil des natürlichen Lebens auf der Erde – und sind doch für immer verschwunden. Schlimmer noch: Das Sterben geht weiter.
Matthias Jügler wollte angesichts dieser so verheerenden Entwicklung nicht untätig bleiben und hat neunzehn Kolleginnen und Kollegen um das literarische Porträt einer ausgestorbenen Art gebeten. Nicht nur, um das erschreckende Geschehen zu dokumentieren oder gar, um Lösungen zu suchen, sondern weil er überzeugt davon ist, dass die Literatur hier geradezu magische Fähigkeiten entwickeln kann:
Literatur lässt uns die Welt, in der wir leben, mit anderen Augen sehen: Wer liest, kann an zwei Orten gleichzeitig sein. Wer liest, kann mühelos durch alle Zeiten reisen. Und wo sonst, wenn nicht in der Literatur, ist es uns gegeben, Tote wiederauferstehen zu lassen. […] Ich bin der festen Überzeugung, dass die bloße Beschreibung einer Art nicht ausreicht, um sie von den Toten zu erwecken. Für diesen Zauber brauchen wir die Literatur.
Who's who der Gegenwartsliteratur
Gemessen an den Teilnehmern, ist sein Projekt ein großer Erfolg, denn das Inhaltsverzeichnis liest sich fast wie ein Who's who der Gegenwartsliteratur. Clemens J. Setz und Antje Rávik Strubel sind darunter, T.C. Boyle und der 2024 selbst verstorbene John Burnside, Daniela Dröscher und Caroline Wahl.
Die Texte selbst beeindrucken durch Vielfalt – manche ganz faktengetreu, andere frei fabulierend, und einige entfalten einen ganz eigenen Charme und Witz. Denn viele lösen die Hoffnung des Herausgebers auf ganz buchstäbliche Weise ein, indem sie nämlich die von ihnen gewählte Art fiktional wiederbeleben. So etwa Katerina Poladjan und Henning Fritsch, die der letzten Stellerschen Seekuh, einem Tier, das bis zu acht Meter lang werden konnte, einen glamourösen Abschiedsauftritt auf einem Ballabend in Ostrussland verschaffen.
Nicht nur ihre Größe, vor allem ihre Grandezza zog alle in ihren Bann. Sie trug ein rotes Paillettenkleid an ihrem tonnenschweren Körper, und ein Graf von Sowieso wich keinen Augenblick von ihrer Seite, stets bemüht, sie mit Champagner zu versorgen, und stets der Erste, dessen Feuerzeug aufflammte, wenn sie die lange Zigarettenspitze zu ihrem enormen Maul hob. Die Luft um sie herum schien sich zu verflüssigen, sie glitt mit weichen Bewegungen von hier nach da, schaute mal dem einen, mal dem anderen Gast tief in die Augen.
Am experimentierfreudigsten ist Kim de l'Horizons Text über den Schuppenkehlmoho, einen Sperlingsvogel, der ausschließlich auf Hawaii gelebt hat. De l'Horizon liefert den QR-Code zur Tonaufnahme des letzten Exemplars, und verstrickt dieses dann in ein sehr sprachspielerisches Streitgespräch mit einem Ornithologen über die Ursachen seines Verschwindens.
Denn der Verlust einer Art kann durch sehr unterschiedliche Dinge ausgelöst werden, an erster Stelle stehen aber fast immer die offenbar nahezu grenzenlose Habgier und die ökologische Ignoranz des angeblich doch vernunftbegabten Homo sapiens. Manche Beitragende lassen eine tiefgreifende Trauer spüren, wie Julia Schoch, die sich in den letzten Auerochsen hineinversetzt:
Hat keine Angst, zittert jetzt aber doch ungewohnt heftig. Wundert sich selbst ein bisschen. Was jetzt wohl los ist? So zu zittern. […] Wird schon seine Richtigkeit haben, dass er verschwinden muss. Irgendwann ist es Zeit für jeden. […] Vielleicht kann er entkommen, wenn er einfach davontrottet, ganz so, als wäre nichts. Einfach weitergehen. So wie jemand aus einem Bild geht, lautlos und unauffällig, über den Rand hinaus.
Mischung aus Faktenwissen und Fiktion
Gemeinsam ist allen Texten, dass die Schreibenden das Lebewesen, dem sie sich widmen, nie mit eigenen Augen gesehen haben. So hat diese Anthologie in ihrer Mischung aus Faktenwissen und Fiktion auch einiges gemeinsam mit vormodernen naturhistorischen Enzyklopädien, in denen aus heutiger Sicht die Grenze zwischen Literatur und Wissenschaft noch fließend war.
In der Gegenwart aber ist das ungenannte Vorbild von Jüglers Projekt die großartige Gedichtsammlung „Dodos auf der Flucht“ von Mikael Vogel, der damit schon vor einigen Jahren lyrische Trauerarbeit über das Artensterben geleistet hat und ein würdiger zwanzigster Autor gewesen wäre. Schade, dass er nicht dabei ist.
Dennoch: Dieses großformatige, mit Illustrationen von Barbara Dziadosz prachtvoll ausgestattete Buch ist berührend, manchmal auch schockierend, und bringt uns dankenswerterweise einige der Tiere und Pflanzen tatsächlich noch einmal sehr nahe.