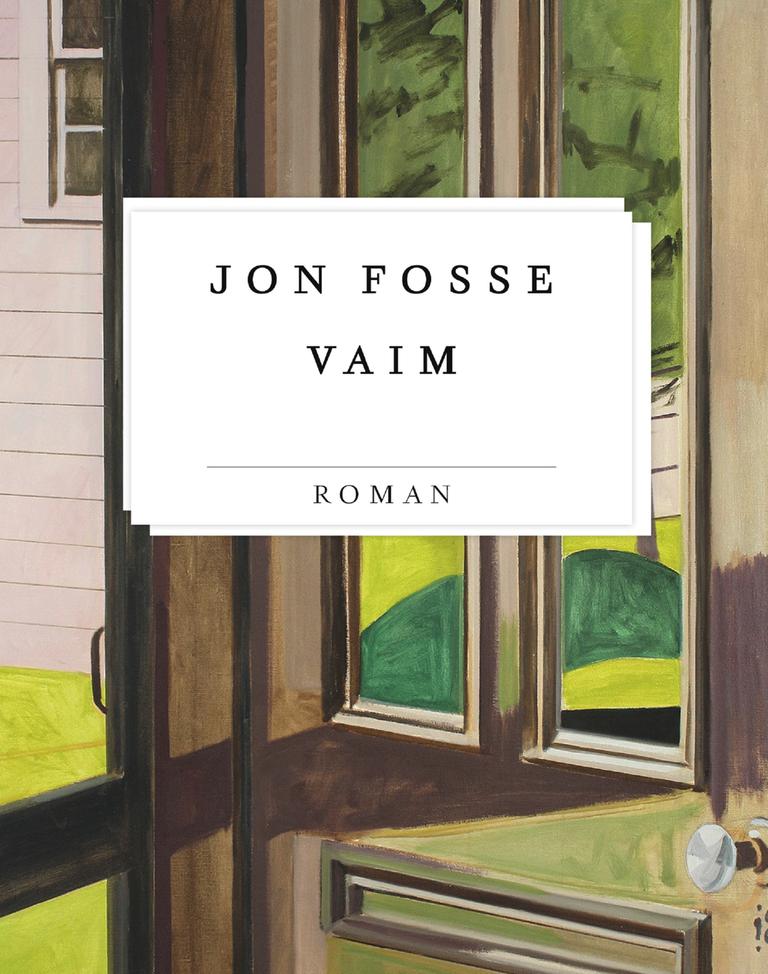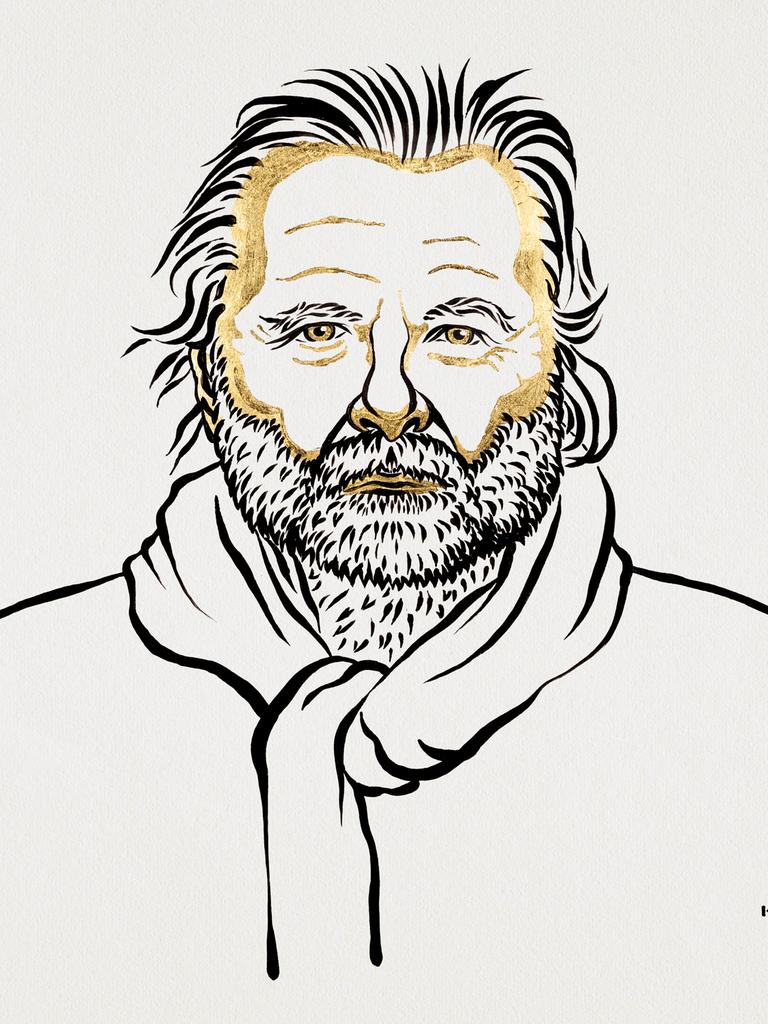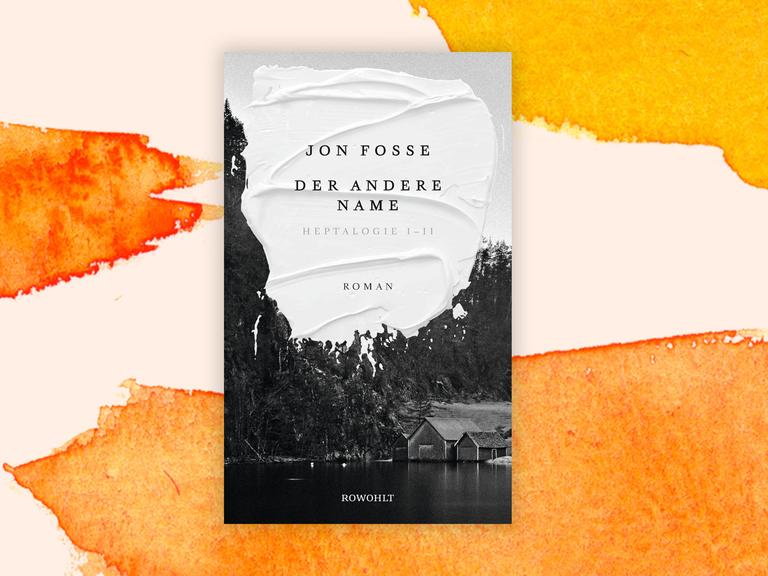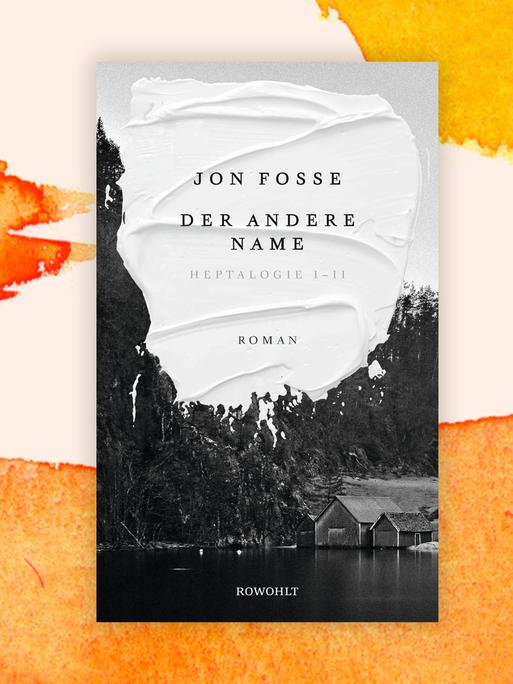Norwegens bezaubernde Fjorde wirken harmlos auf den ersten Blick, aber sie sind von einer atemberaubenden Tiefe. Das kann ganz ähnlich von den Geschichten Jon Fosses gesagt werden, deren kunstvolle Reduktion nicht mit Schlichtheit verwechselt werden darf. Vor der Kulisse der norwegischen Küste entwirft dieser Autor vielmehr Szenen von mythischer Kraft, traumartig und zeitlos, die dennoch keine Parabeln sind, sondern ganz gegenwärtig.
Jetzt erscheint Fosses erster Roman nach der Zuerkennung des Literaturnobelpreises vor zwei Jahren. Er handelt von zwei Männern des Meeres und einer resoluten Frau, die zwischen ihnen hin und her pendelt wie zwischen zwei Inseln. Das eigentliche Thema dabei ist das unbegreifliche Leben selbst – ein kompliziertes Navigieren zwischen Nähe und Distanz.
Begegnung mit einer heimlichen Liebe
Dreimal wechselt der Ich-Erzähler. Der erste ist Jatgeir, zu Beginn des Buchs ein älterer Junggeselle, der im heimischen Vaim nur einen einzigen Freund besitzt, den ebenso soziopathischen Elias. Jatgeir ist mit seinem Boot namens Eline auf sommerlicher Vergnügungsfahrt, die ihn über Bjørgvin auf die Insel Sartor führt.
Als er im dortigen Hafen gerade darüber reflektiert, dass man ihn bei Einkäufen gleich zweimal übers Ohr gehauen hat, scheint ihm das Schicksal zum Ausgleich gnädig gestimmt zu sein, denn Jatgeier hört, wie vom Anleger her sein Name gerufen wird:
„ich hatte ja gehört, dass Eline irgendwo auf Sartor wohnen solle, aber jetzt hatte ich wohl geradezu Halluzinationen, es konnte doch nicht meine alte heimliche Liebe da stehen und zu meiner Schnigge runterschauen, an deren Steuerhaus auf beiden Seiten so stolz Eline stand, jetzt stand Eline da, denn es war tatsächlich sie, die ohne ihr Wissen meiner Schnigge den Namen gegeben hatte, denn ich hatte ja nie, natürlich nie, Eline etwas von meinen Gefühlen für sie verraten, nie, niemals im Leben hätte ich es gewagt, so etwas zu einer Frau zu sagen, nein so war ich nicht gemacht, ich nicht“
aus: Jon Fosse: "Vaim"
Was sofort auffällt, ist der für Fosse so typische hypnotische Tonfall, auf dessen äußere Ähnlichkeit mit dem Stil Thomas Bernhards notorisch verwiesen wird.
Aber wichtiger ist doch, dass diese kreisende, repetitive Bewegung bei Fosse nicht expressiv wirkt, sondern poetisch-meditativ, ganz nach innen gerichtet: wie eine Windung um Windung von Ängsten und Hoffnungen vorangetriebene Tiefenbohrung in die Psyche der Handelnden. Ein sichtbar gemachter Gedankenstrudel.
Tatsächlich hat Jatgeir seine heimliche Liebe wiedergefunden. Und mehr noch: Eline springt in sein Boot, möchte zurück nach Vaim, weg von ihrem Ehemann, einem Fischer, den sie Frank nennt, aber der eigentlich Olav heißt. Und so kommt Jatgeir an diesem Tag zu einer Frau, mit der er danach mehrere Jahre in sündiger Ehe in Vaim lebt.
Eine Störung der Harmonie zwischen Himmel und Meer
Das erfahren wir – im Rückblick – vom zweiten Erzähler, von Elias nämlich, der auf diese Weise aus Jatgeirs Leben herausgedrängt wurde:
„es ist irgendwie nicht mehr dasselbe, seitdem diese Frau da, ja wie heißt sie noch mal, ja Eline war das, mit ihm in seiner Schnigge zurückgekommen ist, nachdem er wie sonst auch in den Sommerferien seine übliche Bootstour nach Bjørgvin unternommen hatte“
aus: Jon Fosse: "Vaim"
Was nach einer Alltäglichkeit klingt, nach der Flucht aus einer Beziehung in eine andere, wird bei Fosse zu einer Art Störung der zwischen Himmel und Meer herrschenden Harmonie. Das hat Folgen – wie die Wellen eines ins stille Gewässer geworfenen Steins, die immer weitere Kreise ziehen.
Rivalen sind dabei weniger Jatgeir und Olav als Elias und Eline. Sie tragen nicht nur ähnliche Namen, sie konkurrieren zudem um die Nähe zu Jatgeir. Die etwas rätselhafte Eline setzt sich quasi natürlich durch. Aber nachdem die Erzählung sich zur Gespenstergeschichte hin geöffnet hat, triumphiert wiederum Elias auf sehr eigentümliche Weise.
Dass sich die Erzählung im Kern um die Frage dreht, was besser zur fjordtiefen Seeleneinsamkeit der Männer passt – Freundschaft oder Partnerschaft –, zeigt sich auch im dritten Kapitel, diesmal erzählt von Olav respektive Frank. Er berichtet – wiederum einige Jahre später –, wie Eline eines Tages plötzlich erneut bei ihm auftauchte und ganz wie beim ersten Mal die Initiative übernahm:
"Ja jetzt fahren wir zu mir nach Hause, sagt sie
und ich sage nichts
Jetzt werden du und ich wieder zusammenleben, sagt sie
Ja, so ist das, sagt sie
und mir fällt dazu nichts ein
Jetzt können wir zusammenleben, du Frank und ich, sagt sie
und ich verstehe, was sie sagt und ich verstehe, dass das, was ich will oder nicht will, nichts zu bedeuten hat, Elines Wille herrscht, jetzt wie früher, jetzt wie immer"
aus: Jon Fosse: "Vaim"
Trost durch eine perfekt austarierte Form
Ein Vorwurf ist das nicht, einfach eine Anerkenntnis der Machtverhältnisse. Die Männer in diesem Buch, allesamt Asketen, wirken wie Treibholz in der Strömung – und auch nicht viel emotionaler. Verwundert nehmen sie den Lauf der Dinge zur Kenntnis.
"Alles war wundersam", möchte einer von ihnen sogar auf seinem Grabstein stehen haben. Nähe lassen sie zu, wenn diese wie ein Sturm über sie kommt, aber wirklich nah fühlen sie sich nur anderen Eigenbrötlern.
Das klingt nicht nur nach atavistischer Geschlechterpsychologie, sondern auch nach einem radikalen Pessimismus, der auf einen Schlag alle Liebesanrufungen seit der Antike als Irrtum oder Ideologie diskreditiert.
Dass das Buch trotzdem nicht wie eine verbitterte Abrechnung wirkt, liegt an dem freundlichen Humor, der das Geschehen in ein warmes Licht taucht. Und an der perfekt austarierten Form: Nur zwei Punkte finden sich im gesamten Text, in dem damit schon sprachlich alles ineinanderfließt. Und kompositorisch runden sich die drei Kapitel zum Rondo. Es gelingt Jon Fosse, den Eindruck zu erwecken, als wäre in diesem seltsamen Kreistanz von allen mit allen doch der Kern der Liebe erfasst.