Recherchen unter Lebensgefahr
Wie ein Land auch von den eigenen Herrschern ausgebeutet werden kann, dafür ist der Kongo ein erschreckend gutes Beispiel. Mehr als dreißig Jahre lang führte dort Präsident Mobutu ein korruptes Regime und hinterließ einen bis heute dysfunktionalen Staat.
Das Bild, das sich der Westen von Afrika macht, sei von Stereotypen geprägt: Hauptsache wild, Hauptsache schwarz. Und natürlich grausam, blutig und korrupt. Dagegen schreibt der promovierte Archäologe an und fragt, wie ein Land mit solchen Bodenschätzen derart in die Armut abstürzen kann. Außerdem bewegt David Van Reybroucks noch etwas Persönliches.
Sein inzwischen verstorbener Vater war als junger Ingenieur Anfang der sechziger Jahre in der kongolesischen Provinz Katanga tätig. Gesprochen hat er darüber nie, und so versucht der Sohn, durch sein Buch auch dem Vater näher zu kommen.
Entstanden ist eine mitreißende "Biographie" des zentralafrikanischen Landes, fast 800 Seiten dick, die er aus der Sicht der einheimischen Bevölkerung erzählt. Das ist ungewöhnlich.
"Es gibt abertausende Bücher über den Kongo, in denen die Perspektive meist die der Weißen, der Europäer ist. Für mich war es wichtig, die Kongolesen selbst zu Wort kommen zu lassen. Anfangs dachte ich, nur über sie zu schreiben. Aber dann fand ich, dass es eine Art umgekehrter Rassismus wäre, wenn ich die Weißen ausschließen würde. Denn es gab auch großartige Leute während der Kolonialzeit."
Ausgangspunkt aber ist die Zeit um 90.000 vor Christus. David Van Reybrouck schildert in Momentaufnahmen Szenen aus dem Leben eines zwölfjährigen Jungen, den er durch die Zeit schickt und immer wieder innehalten lässt. Er, der flämische Autor, hielte es nämlich für bizarr, die Geschichte des Kongo mit Europäern beginnen zu lassen.
"Geht es noch eurozentrischer? Es war in Afrika, als sich die Entwicklungslinie des Menschen vor fünf bis sieben Millionen Jahren von der des Menschenaffen trennte. Es war in Afrika, als der Mensch vor vier Millionen Jahren begann, aufrecht zu gehen."
Für die Meisten beginnt die wechselhafte Geschichte des zentralafrikanischen Landes allerdings erst 1884/85, als auf einer Konferenz in Berlin Afrika in Kolonien aufgeteilt und dem belgischen König Leopold II. der Kongo, das rohstoffreichste Gebiet Afrikas, zugesprochen wird – als Privatbesitz. Er regiert es von Belgien aus und setzt nie einen Fuß in das Land, das siebzig Mal so groß ist wie sein Königreich.
Und so erzählt der Autor in fünfzehn Kapiteln, chronologisch aufeinander aufbauend, erst über die Kolonialzeit, über diesen Leopold II., der die Einwohner zur Kautschukernte zwingt und ihnen die Hände abhaken lässt, wenn das Soll nicht erfüllt wird. Dann schreibt er über die Unabhängigkeit im Jahr 1960, als es in dem Riesenland nur sechzehn Kongolesen mit Universitätsabschluss gab. Der Leser erfährt viel über Musik, Boxkämpfe und Brauereien, über größenwahnsinnige Despoten wie Sese Seko Mobuto, über dessen Vorgänger Lumumba und die Nachfolger Kabila, den Vater wie den Sohn.
David Van Reybrouck hat zahlreiche spannende, zum Teil unveröffentlichte Quellen und Dokumente verarbeitet und diese geschickt mit persönlichen Begegnungen verknüpft: Oral history mit Missionaren, Musikern, Journalisten, Bauern, Hausfrauen, Kindersoldaten oder Regierungsmitarbeitern.
"Wenn ich mit alten Kongolesen über die Kolonialzeit spreche, frage ich nicht, was sie damals über die Weißen dachten, sondern ich möchte wissen: Welche Sprache haben Sie damals zuhause gesprochen? Haben Sie mit Messer und Gabel oder mit den Fingern gegessen? Mit wem teilten Sie das Zimmer? Das ist doch interessant. Das ist der Archäologe in mir, es ist ‚history from below’. Archäologie ist für mich die Geschichte der Demokratie."
Dabei wahrt er eine wohltuende Distanz. Einer seiner zahlreichen Zeitzeugen ist der vermutlich 128-jährige Etienne Nkasi, eine Ausnahmegestalt in einem Land, in dem die durchschnittliche Lebenserwartung bei 45 Jahren liegt. Ihm hat David Van Reybrouck das Buch gewidmet.
Überhaupt hat er keine Mühen gescheut, Gesprächspartner ausfindig zu machen. Zum Beispiel Antoine Vumilia, der in Kabilas Sicherheitsdienst arbeitete und im Nebenzimmer war, als der Präsident 2001 in seinem Büro ermordet wurde. Seitdem sitzt Vumilia in Makala, dem Zentralgefängnis von Kinshasa. Taxifahrer weigern sich, dorthin zu fahren.
"Aus dem grellen Tageslicht trete ich in einen langen düsteren Gang mit Zellen zu beiden Seiten. Ein paar Türen stehen offen, Wäsche ist zum Trocknen aufgehängt. Stimmengewirr. Im Dunkeln sehe ich hier und da Gesichter von Inhaftierten um Kohlefeuer aufleuchten. Es sind zum Tode Verurteilte, die sich auf einfachen Kochern ihr Essen zubereiten, denn Verpflegung gibt es in Makala nicht. Wenn die Familie nichts zu essen vorbeibringt, muss man eben Gras oder Steine essen."
Bei seinen Recherchen geriet er manchmal selbst in Lebensgefahr, zum Beispiel, als er den Rebellenführer Laurent Nkunda besucht – es war ihm die Sache wert.
"Ich wusste sehr gut, dass, wenn ich dieses Buch schreibe, es gefährlich sein könnte. Ich bin kein Abenteurer, der die Gefahr sucht. Aber ich wollte das Buch schreiben, und ich habe die Konsequenzen angenommen. Ich sagte mir: Okay, wenn mir etwas geschieht, dann lieber bei einem Buch, das aufs Ganze geht als bei einem mittelmäßigen."
"Kongo. Eine Geschichte" ist ein besonderes unter den historischen Sachbüchern: packend, mitreißend, informativ, warmherzig, literarisch. Stellenweise erinnert es an die großartigen Reportagen Richard Kapuzinskis. Es ist ein lebendiges Land, kein totes, das David Van Reybrouck beschreibt.
David van Reybrouck: Kongo. Eine Geschichte
Suhrkamp Verlag Berlin
Sein inzwischen verstorbener Vater war als junger Ingenieur Anfang der sechziger Jahre in der kongolesischen Provinz Katanga tätig. Gesprochen hat er darüber nie, und so versucht der Sohn, durch sein Buch auch dem Vater näher zu kommen.
Entstanden ist eine mitreißende "Biographie" des zentralafrikanischen Landes, fast 800 Seiten dick, die er aus der Sicht der einheimischen Bevölkerung erzählt. Das ist ungewöhnlich.
"Es gibt abertausende Bücher über den Kongo, in denen die Perspektive meist die der Weißen, der Europäer ist. Für mich war es wichtig, die Kongolesen selbst zu Wort kommen zu lassen. Anfangs dachte ich, nur über sie zu schreiben. Aber dann fand ich, dass es eine Art umgekehrter Rassismus wäre, wenn ich die Weißen ausschließen würde. Denn es gab auch großartige Leute während der Kolonialzeit."
Ausgangspunkt aber ist die Zeit um 90.000 vor Christus. David Van Reybrouck schildert in Momentaufnahmen Szenen aus dem Leben eines zwölfjährigen Jungen, den er durch die Zeit schickt und immer wieder innehalten lässt. Er, der flämische Autor, hielte es nämlich für bizarr, die Geschichte des Kongo mit Europäern beginnen zu lassen.
"Geht es noch eurozentrischer? Es war in Afrika, als sich die Entwicklungslinie des Menschen vor fünf bis sieben Millionen Jahren von der des Menschenaffen trennte. Es war in Afrika, als der Mensch vor vier Millionen Jahren begann, aufrecht zu gehen."
Für die Meisten beginnt die wechselhafte Geschichte des zentralafrikanischen Landes allerdings erst 1884/85, als auf einer Konferenz in Berlin Afrika in Kolonien aufgeteilt und dem belgischen König Leopold II. der Kongo, das rohstoffreichste Gebiet Afrikas, zugesprochen wird – als Privatbesitz. Er regiert es von Belgien aus und setzt nie einen Fuß in das Land, das siebzig Mal so groß ist wie sein Königreich.
Und so erzählt der Autor in fünfzehn Kapiteln, chronologisch aufeinander aufbauend, erst über die Kolonialzeit, über diesen Leopold II., der die Einwohner zur Kautschukernte zwingt und ihnen die Hände abhaken lässt, wenn das Soll nicht erfüllt wird. Dann schreibt er über die Unabhängigkeit im Jahr 1960, als es in dem Riesenland nur sechzehn Kongolesen mit Universitätsabschluss gab. Der Leser erfährt viel über Musik, Boxkämpfe und Brauereien, über größenwahnsinnige Despoten wie Sese Seko Mobuto, über dessen Vorgänger Lumumba und die Nachfolger Kabila, den Vater wie den Sohn.
David Van Reybrouck hat zahlreiche spannende, zum Teil unveröffentlichte Quellen und Dokumente verarbeitet und diese geschickt mit persönlichen Begegnungen verknüpft: Oral history mit Missionaren, Musikern, Journalisten, Bauern, Hausfrauen, Kindersoldaten oder Regierungsmitarbeitern.
"Wenn ich mit alten Kongolesen über die Kolonialzeit spreche, frage ich nicht, was sie damals über die Weißen dachten, sondern ich möchte wissen: Welche Sprache haben Sie damals zuhause gesprochen? Haben Sie mit Messer und Gabel oder mit den Fingern gegessen? Mit wem teilten Sie das Zimmer? Das ist doch interessant. Das ist der Archäologe in mir, es ist ‚history from below’. Archäologie ist für mich die Geschichte der Demokratie."
Dabei wahrt er eine wohltuende Distanz. Einer seiner zahlreichen Zeitzeugen ist der vermutlich 128-jährige Etienne Nkasi, eine Ausnahmegestalt in einem Land, in dem die durchschnittliche Lebenserwartung bei 45 Jahren liegt. Ihm hat David Van Reybrouck das Buch gewidmet.
Überhaupt hat er keine Mühen gescheut, Gesprächspartner ausfindig zu machen. Zum Beispiel Antoine Vumilia, der in Kabilas Sicherheitsdienst arbeitete und im Nebenzimmer war, als der Präsident 2001 in seinem Büro ermordet wurde. Seitdem sitzt Vumilia in Makala, dem Zentralgefängnis von Kinshasa. Taxifahrer weigern sich, dorthin zu fahren.
"Aus dem grellen Tageslicht trete ich in einen langen düsteren Gang mit Zellen zu beiden Seiten. Ein paar Türen stehen offen, Wäsche ist zum Trocknen aufgehängt. Stimmengewirr. Im Dunkeln sehe ich hier und da Gesichter von Inhaftierten um Kohlefeuer aufleuchten. Es sind zum Tode Verurteilte, die sich auf einfachen Kochern ihr Essen zubereiten, denn Verpflegung gibt es in Makala nicht. Wenn die Familie nichts zu essen vorbeibringt, muss man eben Gras oder Steine essen."
Bei seinen Recherchen geriet er manchmal selbst in Lebensgefahr, zum Beispiel, als er den Rebellenführer Laurent Nkunda besucht – es war ihm die Sache wert.
"Ich wusste sehr gut, dass, wenn ich dieses Buch schreibe, es gefährlich sein könnte. Ich bin kein Abenteurer, der die Gefahr sucht. Aber ich wollte das Buch schreiben, und ich habe die Konsequenzen angenommen. Ich sagte mir: Okay, wenn mir etwas geschieht, dann lieber bei einem Buch, das aufs Ganze geht als bei einem mittelmäßigen."
"Kongo. Eine Geschichte" ist ein besonderes unter den historischen Sachbüchern: packend, mitreißend, informativ, warmherzig, literarisch. Stellenweise erinnert es an die großartigen Reportagen Richard Kapuzinskis. Es ist ein lebendiges Land, kein totes, das David Van Reybrouck beschreibt.
David van Reybrouck: Kongo. Eine Geschichte
Suhrkamp Verlag Berlin
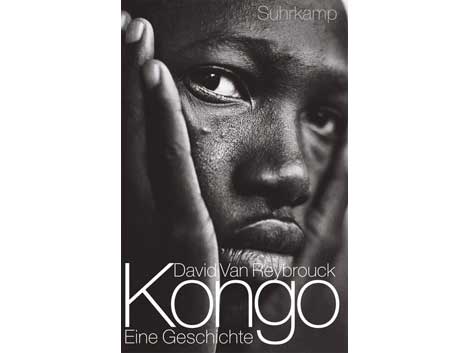
David van Reybrouck: Kongo. Eine Geschichte© Suhrkamp
