Radikalisierung des Vernichtungskrieges
Helmut Walser Smith stellt sich in "Fluchtpunkt 1941" die Aufgabe, die Vorgeschichte des Holocausts in einer Langzeitstudie zu deuten. Das Jahr bezeichnet die Radikalisierung des Vernichtungskrieges im Osten und die schnelle Expansion der Massenmorde.
Dieses Buch ist zwar eher schmal, könnte aber in Anlage und Ziel kaum anspruchsvoller sein. Mit großem Selbstbewusstsein stellt sich Walser Smith die Aufgabe, die Vorgeschichte des Holocausts in einer Langzeitstudie neu zu deuten. Für seine Erzählung wählt er das Jahr 1941 als Fluchtpunkt.
In perspektivischen Abbildungen, etwa in der Malerei und in der Fotographie, bezeichnet ein Fluchtpunkt den Ort, an dem sich die Linien eines Bildes schneiden. Der Blick des Betrachters wird von diesem Punkt an-, ja in ihn hineingezogen. Fluchtpunkte machen es dem Betrachter leicht, tendenziell betrügen sie den Blick auch um vieles, was ohne den Sog des Fluchtpunktes sichtbar würde.
In seiner Auseinandersetzung mit bisherigen Erklärungen von Diktatur, Vernichtungskrieg und Völkermord plädiert Helmuth Walser Smith überzeugend dafür, als zentralen Fluchtpunkt einer Langzeitanalyse nicht die Jahre 1871, 1914, 1918 oder 1933, sondern das Jahr 1941 zu wählen.
Das Jahr bezeichnet die Radikalisierung des Vernichtungskrieges im Osten und die schnelle Expansion der Massenmorde durch die sogenannten Einsatzgruppen, die hier noch in brutaler Handarbeit vorgehen. Diesen Zivilisationsbruch bezeichnet er mit einer Formel der politischen Philosophen Hannah Arendt und Alain Finkielkraut:
"In meinem Buch geht es um die Frage nach dem Zusammenbruch der Mitmenschlichkeit und damit um die Hauptideologien, die dafür verantwortlich waren: Nationalismus, Antisemitismus und Rassismus. Ich habe ganz bewusst das Jahr 1941 und nicht Auschwitz als Fluchtpunkt gewählt. Weder Hochtechnologie noch ausgeklügelte Organisation kennzeichneten die Morde, die mit den Einsatzgruppen im Sommer 1941 begannen. Es war vielmehr ein brutales Morden aus nächster Nähe. Anders formuliert: der Beginn des Völkermords deutet nicht auf eine hochtechnisierte Modernität, sondern auf eine mit Methoden des 19. Jahrhunderts ausgeführte Brutalität."(8)
Vor etwa 15 Jahren hatte Daniel Goldhagen mit seinen Thesen zur Kontinuität des "eliminatorischen Antisemitismus" der Deutschen sagenhaftes Medieninteresse, einen phänomenalen Bestsellererfolg sowie eine Flut von Verrissen durch die internationale Fachwissenschaft geerntet. Auch Walser Smith geht klar auf Distanz, stellt jedoch Goldhagens Fragen explizit neu.
Anders als Goldhagens simple und auf einer einzigen Bahn gleitende Erklärung bietet Walser Smith einen komplexen, intelligent aufgebauten Analyse- und Darstellungsapparat an. Seine historische Rückwärtsfahrt führt in einzelnen Passagen bis an die Ränder des Mittelalters. Der Fokus jedoch liegt auf dem langen 19. Jahrhundert. Die Erzählung bewegt sich auf vier, eher lose verbundenen Pfaden der Analyse.
Behandelt werden erstens frühe Deutungen der Nation mit ihren Ein- und Ausschlüssen, zweitens die Erinnerung an die äußert gewalttätigen konfessionellen Auseinandersetzungen zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, drittens Begründung und Praxis antijüdischer Pogrome im Europa des späten 19. Jahrhunderts und viertens Theorie und Praxis des Rassedenkens im Zeitalter des Hochimperialismus - Walser Smith nennt diesen Abschnitt eliminatorischer Rassismus.
Jeder dieser vier Pfade bietet originelle Perspektiven auf die lange Geschichte der Ausgrenzung und gewalttätigen Vertreibung von Minderheiten, insbesondere der Juden. Nun gehören die vier gewählten Pfade zu den Haupttrassen der Wissensproduktion zur deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Auf keiner dieser vier Haupttrassen wartet der Autor mit atemberaubenden Neuigkeiten oder spektakulären Quellenfunden auf. Allerdings gelingt es ihm, wichtige Verbindungen zwischen den vier bereits bestehenden Trassen zu bauen.
Die Tiefe des historischen Raumes, den der Autor mit der denkbar selbstbewussten Anlage seiner Erzählung schafft, zwingt freilich zur Konzentration auf wenige Leittexte, wenige Autoren, wenig Interpretationsbreite. So wie die vier Stränge hier konstruiert sind, gleichen sie weniger den mühsamen Wanderpfaden gelehrter Präzision als Autobahnen, auf denen die Thesen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung reisen.
In wenigen Minuten liest man sich von 1519 nach 1941, auf 30 Seiten von den Kartographen des 16. Jahrhunderts über Adolf Arndt bis Heinrich Claß. Auch das hochkomplexe Dickicht europäischer Kolonialpolitik und Kolonialmassaker durchquert man wie auf einer urplötzlich deutsch daherrollenden Planierraupe. Über den Kommandeur der deutschen Kolonialtruppen, die sich im Jahre 1904 in Südwestafrika einem Völkermord entgegenschießen, heißt es:
"Von Trotha hatte im Grunde die Schlacht von Waterberg verpfuscht, indem er den Fluchtweg in die Wüste unversperrt gelassen hatte, doch genau dieser Augenblick des Versagens förderte die Eskalation zum Massenmord – den Übergang, wie es Rohrbach formulierte, von der Zerstörung des Widerstands des Feindes zur physischen Vernichtung des gesamten Stammes. Gegen Untermenschen lässt sich nicht menschlich Krieg führen, soll er neun Tage vor der Schlacht gesagt haben."
Kritik und Diskussion des Buches werden vor allem an drei Punkten ansetzen: Erstens ist die Einbettung der deutschen Langzeitstränge in europäische Kontexte sehr inkonsequent. Weite Streckenabschnitte sind europäisch erzählt, enden aber auf nicht immer plausible Weise als plötzlich deutsche Wege.
Zweitens verschlingt der gewählte Fluchtpunkt 1941 allerhand Linien und Störgrößen, die sich in das Crescendo von Ausgrenzung - Vertreibung - Vernichtung nicht einfügen wollen. Dazu gehört, im Blick auf die deutsch-jüdischen Traditionslinien, die Wahrnehmung jüdischer Geschichte in Deutschland als einer Erzählung von Erfolg, Fortschritt, Integration und Aufstieg. Ein nicht kleiner Teil der internationalen Fachhistoriker hat diesen Zug immer wieder betont.
Drittens lädt das Buch dazu ein, das Verhältnis von Kontinuitäten und Brüchen neu zu diskutieren. Im Wesentlichen stoppt die Analyse im Jahre 1914. Für ein Buch, dessen Fluchtpunkt der Massenmord an den europäischen Juden sein soll, ist dies ein gewagtes Bremsmanöver. Der katastrophal verlorene Erste Weltkrieg, der im Buch ein Schattendasein führt, fehlt hier als zentraler Bruch und wird mit den Kontinuitätslinien nur wenig verschaltet. Genau an dieser Stelle aber weicht die deutsche Geschichte beschleunigt von den Hauptströmen westeuropäischer Geschichte ab.
Die Frage, wann und warum es zu solchen deutschen Abkoppelungen von zuvor zweifellos europäischen Traditionssträngen kam, wird vom Autor nicht gelöst, die Diskussion aber um wichtige Anregungen bereichert.
"Dass die Politik auf Massenmord hinauslief, war vor dem Krieg nicht erkennbar. Dass der systematische Mord - bis zum letzten Juden auf der Erde - Ziel der Politik wurde, ergab sich erst im Sommer 1941. Worin besteht dann die Kontinuität? Nicht im Völkermord, sondern in der Vorstellung der Vertreibung, in der Durchtrennung der Bindung an andere und in den gewaltsamen Ideologien - Nationalismus, Antisemitismus und Rassismus."
Walser Smiths Insistieren auf der Bedeutung von Kontinuitätslinien, in denen sich Nationsbildung, Rassismus sowie die gewaltreiche Ausgrenzung und Vertreibung von Minderheiten verbinden, ist überzeugend. Das Buch liefert keine wasserdichten Ergebnisse, dafür aber eine ganze Reihe von Provokationen und produktiven Anregungen. Ob man dies im Abgleich mit Büchern, die sichere Ergebnisse aber keinerlei Ideen liefern, kritisieren oder feiern mag, hängt von den Lesererwartungen ab. Helmuth Walser Smith hat ein sehr lesenswertes Buch geschrieben.
Helmut Walser Smith: Fluchtpunkt 1941
Kontinuitäten der deutschen Geschichte
Reclam Verlag, Ditzingen 2010
In perspektivischen Abbildungen, etwa in der Malerei und in der Fotographie, bezeichnet ein Fluchtpunkt den Ort, an dem sich die Linien eines Bildes schneiden. Der Blick des Betrachters wird von diesem Punkt an-, ja in ihn hineingezogen. Fluchtpunkte machen es dem Betrachter leicht, tendenziell betrügen sie den Blick auch um vieles, was ohne den Sog des Fluchtpunktes sichtbar würde.
In seiner Auseinandersetzung mit bisherigen Erklärungen von Diktatur, Vernichtungskrieg und Völkermord plädiert Helmuth Walser Smith überzeugend dafür, als zentralen Fluchtpunkt einer Langzeitanalyse nicht die Jahre 1871, 1914, 1918 oder 1933, sondern das Jahr 1941 zu wählen.
Das Jahr bezeichnet die Radikalisierung des Vernichtungskrieges im Osten und die schnelle Expansion der Massenmorde durch die sogenannten Einsatzgruppen, die hier noch in brutaler Handarbeit vorgehen. Diesen Zivilisationsbruch bezeichnet er mit einer Formel der politischen Philosophen Hannah Arendt und Alain Finkielkraut:
"In meinem Buch geht es um die Frage nach dem Zusammenbruch der Mitmenschlichkeit und damit um die Hauptideologien, die dafür verantwortlich waren: Nationalismus, Antisemitismus und Rassismus. Ich habe ganz bewusst das Jahr 1941 und nicht Auschwitz als Fluchtpunkt gewählt. Weder Hochtechnologie noch ausgeklügelte Organisation kennzeichneten die Morde, die mit den Einsatzgruppen im Sommer 1941 begannen. Es war vielmehr ein brutales Morden aus nächster Nähe. Anders formuliert: der Beginn des Völkermords deutet nicht auf eine hochtechnisierte Modernität, sondern auf eine mit Methoden des 19. Jahrhunderts ausgeführte Brutalität."(8)
Vor etwa 15 Jahren hatte Daniel Goldhagen mit seinen Thesen zur Kontinuität des "eliminatorischen Antisemitismus" der Deutschen sagenhaftes Medieninteresse, einen phänomenalen Bestsellererfolg sowie eine Flut von Verrissen durch die internationale Fachwissenschaft geerntet. Auch Walser Smith geht klar auf Distanz, stellt jedoch Goldhagens Fragen explizit neu.
Anders als Goldhagens simple und auf einer einzigen Bahn gleitende Erklärung bietet Walser Smith einen komplexen, intelligent aufgebauten Analyse- und Darstellungsapparat an. Seine historische Rückwärtsfahrt führt in einzelnen Passagen bis an die Ränder des Mittelalters. Der Fokus jedoch liegt auf dem langen 19. Jahrhundert. Die Erzählung bewegt sich auf vier, eher lose verbundenen Pfaden der Analyse.
Behandelt werden erstens frühe Deutungen der Nation mit ihren Ein- und Ausschlüssen, zweitens die Erinnerung an die äußert gewalttätigen konfessionellen Auseinandersetzungen zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, drittens Begründung und Praxis antijüdischer Pogrome im Europa des späten 19. Jahrhunderts und viertens Theorie und Praxis des Rassedenkens im Zeitalter des Hochimperialismus - Walser Smith nennt diesen Abschnitt eliminatorischer Rassismus.
Jeder dieser vier Pfade bietet originelle Perspektiven auf die lange Geschichte der Ausgrenzung und gewalttätigen Vertreibung von Minderheiten, insbesondere der Juden. Nun gehören die vier gewählten Pfade zu den Haupttrassen der Wissensproduktion zur deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Auf keiner dieser vier Haupttrassen wartet der Autor mit atemberaubenden Neuigkeiten oder spektakulären Quellenfunden auf. Allerdings gelingt es ihm, wichtige Verbindungen zwischen den vier bereits bestehenden Trassen zu bauen.
Die Tiefe des historischen Raumes, den der Autor mit der denkbar selbstbewussten Anlage seiner Erzählung schafft, zwingt freilich zur Konzentration auf wenige Leittexte, wenige Autoren, wenig Interpretationsbreite. So wie die vier Stränge hier konstruiert sind, gleichen sie weniger den mühsamen Wanderpfaden gelehrter Präzision als Autobahnen, auf denen die Thesen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung reisen.
In wenigen Minuten liest man sich von 1519 nach 1941, auf 30 Seiten von den Kartographen des 16. Jahrhunderts über Adolf Arndt bis Heinrich Claß. Auch das hochkomplexe Dickicht europäischer Kolonialpolitik und Kolonialmassaker durchquert man wie auf einer urplötzlich deutsch daherrollenden Planierraupe. Über den Kommandeur der deutschen Kolonialtruppen, die sich im Jahre 1904 in Südwestafrika einem Völkermord entgegenschießen, heißt es:
"Von Trotha hatte im Grunde die Schlacht von Waterberg verpfuscht, indem er den Fluchtweg in die Wüste unversperrt gelassen hatte, doch genau dieser Augenblick des Versagens förderte die Eskalation zum Massenmord – den Übergang, wie es Rohrbach formulierte, von der Zerstörung des Widerstands des Feindes zur physischen Vernichtung des gesamten Stammes. Gegen Untermenschen lässt sich nicht menschlich Krieg führen, soll er neun Tage vor der Schlacht gesagt haben."
Kritik und Diskussion des Buches werden vor allem an drei Punkten ansetzen: Erstens ist die Einbettung der deutschen Langzeitstränge in europäische Kontexte sehr inkonsequent. Weite Streckenabschnitte sind europäisch erzählt, enden aber auf nicht immer plausible Weise als plötzlich deutsche Wege.
Zweitens verschlingt der gewählte Fluchtpunkt 1941 allerhand Linien und Störgrößen, die sich in das Crescendo von Ausgrenzung - Vertreibung - Vernichtung nicht einfügen wollen. Dazu gehört, im Blick auf die deutsch-jüdischen Traditionslinien, die Wahrnehmung jüdischer Geschichte in Deutschland als einer Erzählung von Erfolg, Fortschritt, Integration und Aufstieg. Ein nicht kleiner Teil der internationalen Fachhistoriker hat diesen Zug immer wieder betont.
Drittens lädt das Buch dazu ein, das Verhältnis von Kontinuitäten und Brüchen neu zu diskutieren. Im Wesentlichen stoppt die Analyse im Jahre 1914. Für ein Buch, dessen Fluchtpunkt der Massenmord an den europäischen Juden sein soll, ist dies ein gewagtes Bremsmanöver. Der katastrophal verlorene Erste Weltkrieg, der im Buch ein Schattendasein führt, fehlt hier als zentraler Bruch und wird mit den Kontinuitätslinien nur wenig verschaltet. Genau an dieser Stelle aber weicht die deutsche Geschichte beschleunigt von den Hauptströmen westeuropäischer Geschichte ab.
Die Frage, wann und warum es zu solchen deutschen Abkoppelungen von zuvor zweifellos europäischen Traditionssträngen kam, wird vom Autor nicht gelöst, die Diskussion aber um wichtige Anregungen bereichert.
"Dass die Politik auf Massenmord hinauslief, war vor dem Krieg nicht erkennbar. Dass der systematische Mord - bis zum letzten Juden auf der Erde - Ziel der Politik wurde, ergab sich erst im Sommer 1941. Worin besteht dann die Kontinuität? Nicht im Völkermord, sondern in der Vorstellung der Vertreibung, in der Durchtrennung der Bindung an andere und in den gewaltsamen Ideologien - Nationalismus, Antisemitismus und Rassismus."
Walser Smiths Insistieren auf der Bedeutung von Kontinuitätslinien, in denen sich Nationsbildung, Rassismus sowie die gewaltreiche Ausgrenzung und Vertreibung von Minderheiten verbinden, ist überzeugend. Das Buch liefert keine wasserdichten Ergebnisse, dafür aber eine ganze Reihe von Provokationen und produktiven Anregungen. Ob man dies im Abgleich mit Büchern, die sichere Ergebnisse aber keinerlei Ideen liefern, kritisieren oder feiern mag, hängt von den Lesererwartungen ab. Helmuth Walser Smith hat ein sehr lesenswertes Buch geschrieben.
Helmut Walser Smith: Fluchtpunkt 1941
Kontinuitäten der deutschen Geschichte
Reclam Verlag, Ditzingen 2010
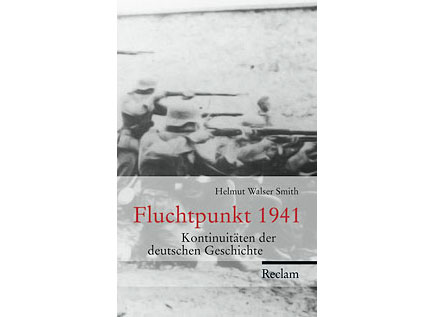
Cover: "Helmut Walser Smith: Fluchtpunkt 1941"© Reclam Verlag
